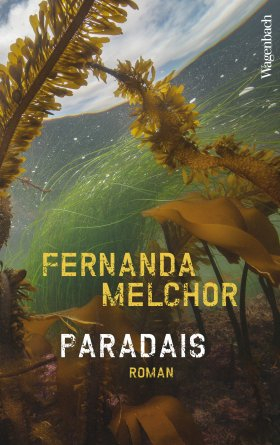Für die deutschsprachige Version hier klicken
¿Según ustedes cuáles serán los problemas más agudos e inmediatos que se vienen con la legalización de la porta de armas en el Ecuador?
PachaQueer: Lo que hace el decreto 707 es exacerbar la violencia y poner en una mucha más amplia vulnerabilidad a los grupos que ya estaban vulnerados y que ya somos vulnerables. Al mismo tiempo esto también significa darle más poder al patriarcado, y armar a los agresores.
Uno de los problemas principales es que justamente las poblaciones de las comunidades históricamente más desamparadas como somos las personas trans, mujeres, niñez y adolescencia, personas de movilidad, de personas también racializadas, empobrecidas seamos pues, una vez más las que quedarán desprotegidas en el contexto de esta propuesta de ley. Si ya en una vida sin armas somos asesinadas, somos desaparecidas y torturadas. En un marco en el que obviamente somos consideradas población de tercera clase en la sociedad ecuatoriana, en Latinoamérica, y creo que en general en el mundo, la legalización del porte de armas significa legalizar nuestras muertes.
¿Según sus experiencias quien va a beneficiarse de este decreto? ¿Qué tipo de seguridad se está priorizando?
PachaQueer: Lo que el presidente está aplicando con el decreto no es algo que no ha pasado antes. Quienes generalmente usan armas son los grupos de poder y el decreto está legalizando el acceso a los grupos de personas que desde siempre lo han tenido. Esos son los grupos, que, si bien no tienen un arma en su bolsillo, tienen una agencia de seguridad o guardias de sus empresas, en sus casas. Al mismo tiempo se desprotege a quienes nunca hemos tenido el acceso a armas. Estamos hablando de un país donde ni siquiera tenemos dinero para la medicina básica. ¿No? Cómo vamos a tener dinero para un examen psicológico que es unos de los requisitos necesarios para el permiso, o el dinero para sacar un certificado del ministerio. Porque todo va a tener un costo. ¿Entonces, realmente a quién está sirviendo esta ley?
¿De qué forma se representa el acceso facilitado a las armas un peligro para poblaciones marginalizadas?
PachaQueer: Esas son las personas que sí pueden cumplir con los requisitos para acceder a un permiso. Y esas son las personas que tienen más acceso a dinero y en mejores condiciones económicas. Ellas son las “ciudadanas de bien” quienes, por lo general, irónicamente, son las personas anti-derechos que no van a pensarse dos veces en disparar a una a una persona trans, una trabajadora sexual o una persona en situación de calle. Porque también el decreto para nosotras tiene mucho que ver con una limpieza social. Y esto es algo que hemos observado especialmente en cuanto a la situación de las trabajadoras sexuales trans.
¿Qué papel desempeña la escalada de esta violencia por parte de las bandas criminales?
PachaQueer: Si es que esto es un fenómeno que se viene naturalizando desde la pandemia en el Ecuador. En esta fase es que se instauran mafias de extorsión, y el uso de violencia hacia trabajadoras sexuales trans y mujeres cis también que ejercen el trabajo sexual precarizado, para forzarlas a tomar parte en la venta de drogas. Pues la narcoviolencia es como una bola de nieve que de alguna forma iba expandiéndose, iba creciendo y la situación que atravesó Jéssica Martínez es un claro ejemplo de la naturalización del narcoestado y la normalización de toda esta red de violencia.
El recrudecimiento de la violencia en el Ecuador está directamente relacionado a las enormes desigualdades sociales y el racismo estructural que existe en el país. Eso se ve en las condiciones de vida de millones de niñas y niños adolescentes empobrecidos, racializados, obligados a ejercer labores deshumanizantes como el sicariato, por ejemplo. Eso da paso a que incremente la exclusión, la discriminación y fomenta y normaliza la inaccesibilidad a la educación, a la cultura, al arte, al espacio público, a la salud, al empleo. Al final es como una matriz estructural de violencia. Y no solo fue Jéssica a quien asesinaron el último año. Nosotras en septiembre del año pasado, hace ocho meses aproximadamente también atravesamos un intento de asesinato. En ese entonces no pasaban ni tres semanas del asesinato de Jéssica Martínez, que nos indignó y nos dolió mucho. Pero su muerte se sumó a tantos crímenes de odio que han atravesado hermanas y compañeros de lucha en los últimos 10 años. ¡Por eso nuestra denuncia sigue latente, NOS ESTÁN MATANDO!
¿Nos podrían contar más sobre el ataque que sufrieron el año pasado?
PachaQueer: Lo que nosotras vivimos el año pasado fue justamente un producto de la transfobia. Porque si bien comenzó como un intento de asalto, la situación cambió el momento en el que las personas se dieron cuenta de que nosotras somos trans, que nosotras somos travestis. Ahí empezó la acción de odio con insultos, con empujones, con golpes y finalmente con un disparo. Entonces, esto da cuenta de que el hecho de que haya un arma de por medio permite finalmente materializar ese odio que existe en la sociedad hacia nosotras, las personas trans.
Una de las cosas que nos agravaba mucho es no saber a qué se debía la situación por la que estábamos atravesando. No sabíamos si era una consecuencia de toda la delincuencia bajo el régimen del neoliberalismo en el que estamos viviendo. O si era una forma de persecución política a líderes y lideresas de movimientos sociales, lo que nosotras somos. Nosotras levantamos la voz, para decir que asesinaron a Jéssica y en dos semanas después nos pasa todo eso.
¿La violencia que sufrieron es en cierta forma una continuación de la violencia que sufren a diario?
PachaQueer: Sí, digamos. Yo creo que más allá del tema actual del porte de armas, volvemos al punto de que estas personas son consideradas como el desprecio de la sociedad o digamos personas que se pueden fácilmente desechar. Somos básicamente las personas pertenecientes a diversidades sexo genéricas, personas que no encajamos en la normatividad hetero, la normatividad “blanca y de clase” e incluso la normatividad de la educación. A esto se suma que obviamente no tenemos protección del estado y en ese sentido siempre hemos estado a la merced de cualquier tipo de ataque en cualquier momento.
Entonces ponemos en reflexión de que lo que ahora la población en general está sintiendo en cuanto a escalación de la violencia en el país, nosotras como personas trans, travestis y disidentes sexuales, lo vivimos a diario. Esa es la situación que vivimos desde el momento en el que asumimos nuestra identidad ajena al régimen normal. Ese reclamo no es nuevo, hemos estado reclamando hace tiempo que nos están torturando, matando o simplemente haciéndonos desaparecer.
¿Qué consecuencias tendría el acceso libre a las armas, y, por ende, un posible aumento de la violencia armada en cuanto a la situación de precaria seguridad que ya viven activistas sociales, ambientales y políticas como ustedes?
PachaQueer: Es decir, lo que estamos diciendo ahora es que es una estrategia de conseguir ciertos fines políticos a través de la violencia. Porque finalmente todo apunta a esto: lo que pasa últimamente en el Ecuador, las masacres en las cárceles, los paros, todas desapariciones de líderes y lideresas sociales, la criminalización a la lucha social que se vio crudamente durante en el paro. Y que se puede ver nuevamente en el tema de Jéssica Martínez y en nuestro caso. Nosotras como fundadoras del colectivo que busca cambiar los paradigmas sobre el género, identidad y sexualidades diversas, vivimos directamente esta violencia en nuestras propias vidas, en nuestras propias cuerpas. Esa forma de silenciamiento vivió el mismo colectivo al que pertenecía Jéssica Martínez. Después de su muerte las compañeras trabajadoras sexuales que eran parte de la Fundación Nueva Esperanza, decidieron suspender sus actividades y cerrar la asociación.
¿Cerraron la organización porque se sentían amenazadas también por lo ocurrido?
PachaQueer: Por supuesto, por el amedrentamiento, por el silenciamiento, por la misma extorsión que denunciaba Jéssica y la instauración del miedo estatal.
¿La instauración del miedo estatal? ¿Qué papel juega el estado en el silenciamiento a activistas?
Eso es algo que también, obviamente no podemos dejar de lado. O sea, lo que pensamos es que este gobierno está tratando de poner ejemplos claros ¿no? Ahora mismo hay un enjuiciamiento a todas estas personas por motivos de terrorismo o lo que el estado define como “terrorismo”. En este caso entran en esta categoría pensadores comunistas o socialistas, pensadores libres y son castigados con condenas absurdas de hasta 13 años, simplemente por legitimar la posibilidad de la organización y de la lucha social.
Entonces la criminalización de la lucha social de parte del estado en consecuencia deja a activistas en diferentes campos más vulnerables a la violencia. ¿Violencia que viene de parte del estado, pero también por parte de otros actores?
PachaQueer: Exacto, por eso en este contexto no podemos dejar de lado los asesinatos de muchas personas que se están defendiendo la libertad, la justicia, la dignidad en muchos campos. No, no solamente digamos en el campo de género, el campo de sexualidad o de identidades, sino también en el campo de la minería, en el campo de la agricultura, digamos en todas, en muchos, en muchos de estos espacios políticos está habiendo asesinatos. No todos son tan polémicos, o salen a la luz.
Porque si vamos ya a la practicidad: quienes no creemos que las armas nos van a ayudar a sentirnos más seguras. Quienes nunca las hemos portado, no lo vamos a hacer ahora por un cambio de ley. En cambio, sí va a beneficiar a las personas que ya desde siempre usaban las armas para silenciar a otras. Quienes ya están acostumbradas a armas y a violencia con armas, pues simplemente para ratificar su poder y van a ratificar su hegemonía. Finalmente, el decreto lo que hace es evadir que se haga un juicio político al presidente, que se hagan reformas populares que beneficien a la clase trabajadora. Y sobre todo sirve para seguir fracturando el tejido social. Lo que es lo que generan estas políticas es la más polarización. El fin es desviar la atención publicada por la atención social para que siga habiendo impunidad, para que siga habiendo injusticia, explotación y toda la dictadura, la opresión que se vive, pues.
En el marco de la falta de seguridad y la implementación de una ley que no corresponde a las necesidades de comunidades vulnerables, ¿cuáles son sus exigencias? ¿Que sería realmente necesario para mejorar la situación?
PachaQueer: Pues yo creo que las organizaciones feministas, transfeministas, las mujeres, las disidencias, sabemos que el libre porte de armas en manos de agresores es poner en riesgo nuestras vidas. El decreto naturaliza la violencia, incrementa la impunidad de los agresores, los encubrimientos sistemáticos de la policía, de los militares por parte del Estado. Y lo que nosotros pedimos es primero la destitución del Decreto 707 y la destitución del presidente actual.
Estos son tiempos de mucha rabia, de mucha indignación, pero también, creo que ha tenido un gran efecto unir a las organizaciones trans feministas, las organizaciones feministas, el movimiento indígena, como vimos en el paro del 2022. Fue histórico ver cómo por primera vez en la historia de muchos paros en el Ecuador, hubo una mayor representatividad y la visibilization de disidencias, de discursos transfeministas, de grupos migrantes, de compas con diversidad funcional. Por eso no estamos demandando una cultura de paz, porque muchas veces la cultura de paz tiene un costo muy elevado de las mismas poblaciones históricamente excluidas. Es que no se puede vivir en paz con menos de salario mínimo. No se puede vivir en paz sin tener acceso a la salud integral, educación libre de discriminación o un CUPO LABORAL TRANS y de diversidades sexuales ¿Como podemos vivir en paz cuando a las personas nos siguen limitando acceso a vivienda o cuando aún siguen tratando de forma ajena a nuestra identidad de género? O sea, esa paz no existe.
Lo que nosotras exigimos sobre todo es poder vivir con dignidad. Y yo creo que cada vez en este Ecuador tan violento, se nos se nos despoja con cada día que pasa, con cada asesinato más, con cada masacre, cada coche bomba, con cada persona desaparecida de nuestra dignidad. Entonces lo que demandamos son las políticas y medios necesarios para recuperarla.