Lies den gesamten Text in unserer April-Ausgabe!
Im Sand verlaufen

© Felipe Larozza / Salvatore Filmes
Zauberhaft sieht sie aus, die Region um den Nationalpark Lençois Maranhenses ganz im Nordosten Brasiliens. Riesige weiße Sanddünen erstrecken sich kilometerweit die Küste entlang bis weit ins Landesinnere, unterbrochen von blauen Lagunen, die zum Baden einladen. Die Lençois sind eines der größten Naturwunder Brasiliens und damit auch eine der bekanntesten Tourismusattraktionen des Landes. Ihre Bewohner*innen stellt die geschützte Landschaft aber auch vor Herausforderungen.
Dies ist das Setting von Marcelo Bottas Debütfilm Betânia, der auf der Berlinale 2024 Weltpremiere feierte. Der Film folgt der titelgebenden Großmutter Betânia (Diana Mattos) und ihrer Familie, die in einfachen Verhältnissen am Rande der Dünen lebt. Betânia war ihr Leben lang Hebamme und hat laut eigener Aussage im Laufe ihres Lebens so gut wie jedes Kind der Region zur Welt gebracht. Die männlichen Freunde und Familienmitglieder verdingen sich vor allem als Tourist*innenführer, während die weiteren im Film vorkommenden Frauen meist älteren Semesters sind und Hausarbeit verrichten. Ausnahme: Betânias Enkelin Vitória (Nádia de Cássia), die auf Reggae steht, für den der brasilianische Bundesstaat Maranhão landesweit berühmt ist, und DJ werden möchte. Dies wiederum bringt ihre erzchristliche Mutter Irineusa (Michelle Cabral) an den Rand des Nervenzusammenbruchs.
Eine Kritik über Betânia zu schreiben, ist nicht einfach, weil der Film die wahrscheinlich größte Bild-Text-Schere des Festivaljahrgangs aufweist. Die fantastische Dünen- und Mangrovenlandschaft der Lençois Maranhenses fängt der geübte Dokumentarfilmer Botta in faszinierenden, fast überrealistisch schönen Bildern ein. Vor allem die Drohnenaufnahmen von den sich wellenden, weißen Sandbergen unter blauem Himmel sind spektakulär. Leider belässt es Botta aber nicht bei diesen zauberhaften Eindrücken, sondern möchte dazu noch eine Geschichte erzählen, was ihm gnadenlos misslingt. Banale Dialoge, altbackene Figurenzeichnung und unnütze Nebenhandlungen, die noch dazu meist – pardon – im Sande verlaufen, machen den flunderflachen Plot zu einer schmerzhaften Aneinanderreihung kitschiger Plattitüden. Dazu werden die Szenen derartig oft von Musik-Performances unterbrochen (es sind insgesamt über 60 Einspielungen!), dass sich selbst die größten Liebhaber*innen brasilianischer Folklore irgendwann fragen dürften, was hier eigentlich Mittel und was Zweck sein soll. Der dramatische Höhepunkt des Films nähert sich, als Tonhão (Caçula Rodrigues), Betânias Schwiegersohn und Dorftrottel in Personalunion, ein entnervend überzeichnetes französisches Tourist*innenpärchen in die Wüste führt und dort dann prompt nicht mehr herausfindet. Doch da ist schon so viel honigsüß-konfliktfreies Wasser die Dünen heruntergeflossen, dass sich wirklich niemand mehr vorstellen mag, hier könne noch irgendetwas Böses passieren.
Die seichte Handlung von Betânia, die sich irgendwo zwischen Homevideo und drittklassiger Telenovela einpendelt, stört den visuellen Genuss mit der Zeit dann doch erheblich. Zumal der Film auch noch viel zu lange zwei Stunden läuft. Dabei wäre es auch anders gegangen. Denn die Figur der Großmutter Betânia basiert auf der wahren und erzählenswerten Lebensgeschichte von Maria do Celso, die ihr Leben lang dafür kämpfte, den malerischen Dörfern am Nationalpark Wasser- und Stromanschluss zu ermöglichen. Genau wie die Umweltprobleme, die die Versandung der Mangrovenlandschaft mit sich bringt, geht das aber leider in zu viel rührseligem Gemenschel unter. Vielleicht hätte Marcelo Botta einfach nur einen weiteren Dokumentarfilm drehen sollen. Den Zuschauer*innen von Betânia sei jedenfalls empfohlen, die wunderschönen Bilder in vollen Zügen zu genießen und ansonsten das Hirn auf Durchzug zu stellen.
LN-Bewertung: 2 / 5 Lamas
Zwischen Nordatlantik und Amazonas

© Cesar Salgado
Aguacuario (Mexiko)
Zwei Jungen fahren auf einem Tandem durch Coatzacoalcos an der Golfküste von Mexiko und liefern Wasser aus. Die Sonne brennt und die Kundschaft schimpft, weil es nicht schnell genug geht. Der zehnjährige Vinzent wartet auf einer Treppe und bewacht das Fahrrad, während sein älterer Bruder Alan die schweren Kanister in die Appartements des umliegenden Viertels schleppt. Als die freche Viviana vorbeikommt, die auf Vergnügen aus ist, wird Vinzents Loyalität und Verantwortungsbewusstsein auf die Probe gestellt.
Aguacuario, der Debütfilm des mexikanischen Regisseurs José Eduardo Castilla Ponce ist ein warmherziger und beschwingter Exkurs in die Freuden und Verpflichtungen der Kindheit. Die Gespräche zwischen Vinzent und Viviana sind schlagfertig und erfrischend und die Story überzeugend. Großer Tiefgang auf der Meta-Ebene wird hier zwar nicht geboten. Trotzdem schade, dass der Film in der Berlinale-Jugendsektion Generations nicht zumindest lobend erwähnt wurde.
LN-Bewertung: 4 / 5 Lamas
Aguacuario, Mexiko 2023, 20 Minuten, Regie: José Eduardo Castillo Ponce

© Nathalia Cordeiro
Lapso (Brasilien)
Zwei Teenager in der Peripherie der Großstadt Belo Horizonte, die das gleiche Schicksal eint: Beide wurden wegen Vandalismus zu Sozialstunden in einer Bibliothek verdonnert. „Der erste Tag vom Ende der Welt“ sei heute, so hat es Juliano an die Wand gesprayt. Diese No-Future-Einstellung legt er auch im normalen Leben an den Tag. Weswegen bis auf seine Großmutter auch niemand daran glaubt, dass aus ihm noch einmal etwas wird – er selbst am allerwenigsten. Die taubstumme Bel ist da einen Schritt weiter. Sie scheint schon viel mehr zu wissen, was sie will, und ist dazu noch ein Ass auf dem Skateboard. Nach und nach lockt sie auch Juliano aus seiner Lethargie und bringt ihn unter anderem dazu, Gebärdensprache zu lernen.
Regisseurin Caroline Cavalcanti ist selbst schwerhörig und thematisiert Hörbeeinträchtigung eindrucksvoll in ihren Filmen und Drehbüchern. Zwei davon wurden bereits mit Preisen ausgezeichnet und auch Lapsoerhielt auf der Berlinale eine Lobende Erwähnung – zu Recht. Denn die authentische Story, der pulsierende Soundtrack aus brasilianischem Rap und Baile Funk und das einnehmende Spiel der Hauptdarsteller*innen (besonders überzeugend: Beatriz Oliveira als Bel) machen Lapso zu einem Kurzfilm, der auch über die Berlinale-Jugendfilmsektion Generation hinaus interessant ist. Einzig den titelgebenden Lapso (Zeitsprung) hätte es nicht unbedingt gebraucht. Auch ohne dieses eher verwirrende Element würde die Geschichte prima funktionieren.
LN-Bewertung: 4 / 5 Lamas
Lapso, Brasilien 2023, 25 Minuten, Regie: Carolina Cavalcanti
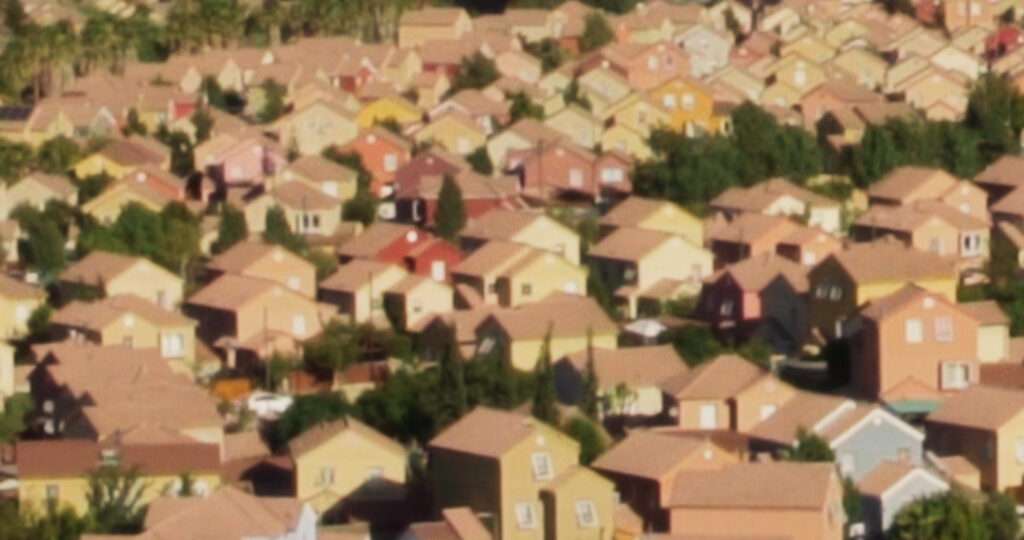
© Luciana Merino & Pascal Viveros
Al sol, lejos del centro (Chile)
Ein sonnendurchfluteter Tag in Santiago de Chile. Die Kamera zeigt den Himmel, fährt langsam von oben oder von der Seite Reihenhäuser, Wellblechdächer, Wohnblocks, Seitenstraßen ab. Manchmal folgt sie auch Passant*innen auf der Straße, die Alltagsbeschäftigungen nachgehen. Die Stimmung ist gelöst und unbeschwert, im Hintergrund hört man Obstverkäufer, Gesprächsfetzen, manchmal auch ein paar sphärische Elektroklänge. Al sol, lejos del centro (In die Sonne, weit weg vom Zentrum) von den chilenischen Regisseur*innen Luciana Merino und Pascal Viveros zeigt in harmonischen Bildern und Klängen die Utopie von Stadtleben in der Peripherie. Dabei wird durch Unschärfe und Distanz mehr ein Gefühl vermittelt als eine Geschichte erzählt. Obwohl nicht viel passiert, funktioniert das ziemlich gut: Der Film ist harmonisch komponiert und hat meditative Qualitäten. Al sol lejos del centro wurde von der Berlinale ins offizielle Kurzfilm-Programm des Festivals aufgenommen.
LN-Bewertung: 3 / 5 Lamas
Al sol, lejos del centro, Chile 2024, 17 Minuten, Regie: Luciana Merino und Pascal Viveros

© Emilia Beatriz
Barrunto (Puerto Rico / Großbritannien)
Barrunto, so heißt ein Song des berühmten New Yorker Salsa-Musikers Willie Colón. Im puertorikanischen Spanisch steht das Wort für eine körperliche Unruhe, ein Omen oder die Vorahnung eines Ereignisses. Regisseurin Emilia Beatriz, die nun eine experimentelle Filmcollage mit demselben Namen gedreht hat, kommt ursprünglich aus Puerto Rico, lebt aber schon seit ihrer Studienzeit im schottischen Glasgow. Ihr Film lief auf der Berlinale in der Sektion Forum Expanded. Barrunto verknüpft filmisch ihre Erfahrungen und Eindrücke in der Diaspora mit denen ihres Heimatlandes, greift Motive wie Nähe und Distanz, Trauer und Verlust oder Militarismus auf. Am auffälligsten ist der Kontrast zwischen Bild und Sound: Über wunderschönen, gestochen scharfen Aufnahmen der rau-romantischen schottischen Küstenlandschaft um ein militärisches Testgelände spielen oft karibische Rhythmen von Salsa bis Reggaeton. Erstaunlicherweise fügt sich das meist zu einem sehr organischen und stimmigen Ganzen zusammen. Aus Puerto Rico gibt es zwar nur wenig Material zu sehen, vor allem Archivaufnahmen von Straßenprotesten. Das Gefühl der Diaspora im 21. Jahrhundert, an einem völlig anderen Ort zu leben und trotzdem jederzeit und überall digital verbunden mit der Heimat zu sein, transportiert barrunto dennoch sehr überzeugend. Weniger klar wird, welcher Zusammenhang mit dem Planeten Uranus besteht, der im Film als handelnder Akteur auftritt und sogar eine eigene Stimme bekommt. Und auch die eingesprochenen philosophischen Textfragmente kommen manchmal etwas arg bedeutungsschwanger daher. Eine interessante audiovisuelle Erfahrung, in der man sich träumerisch verlieren kann, ist barrunto aber allemal geworden.
LN-Bewertung: 3 / 5 Lamas
barrunto, Puerto Rico / Großbritannien 2024, 70 Minuten, Regie: Emilia Beatriz

© Janaina Wagner
Quebrante (Brasilien)
Der Highway BR-30, auch bekannt als Transamazônica, durchquert Brasilien auf einer Strecke von 4.200 Kilometern von Ost nach West, von Cabedelo am Atlantik bis Lábrea mitten im Amazonasgebiet. Er war ein Prestigeprojekt der Militärdiktatur von Garrastazu Médici, das die hohen Erwartungen nie erfüllen konnte. Die Transamazônica sollte Brasilien mit seinen Nachbarländern verbinden, wurde aber nie fertiggestellt und weitgehend nicht einmal asphaltiert.
Der Kurzfilm Quebrante (Bruch) von Janaina Wagner (Berlinale-Sektion Forum Expanded) folgt nur lose der Geschichte vom geplatzten Traum, der ein ganzes Land verbinden sollte. Er verlässt dabei oft die Fernstraße und konzentriert sich visuell mehr auf die Höhlen unter der Siedlung Rurópolis, die am Rande der Autobahn während ihres Baus errichtet wurde. Die Lehrerin Erismar de Sousa Silva erkundet diese weitläufigen unterirdischen Systeme nur mit einer Kerze und einem Feuerzeug ausgerüstet seit den 1970er Jahren. Quebrante zeigt viele Aufnahmen aus diesen Höhlen, aber auch unbelebte Straßen von Rurópolis oder einen riesigen aufblasbaren Mond, der von Kindern zum Spielen benutzt oder mit einem Lastwagen über die Transamazônica gefahren wird. Eine Verbindung zwischen dem Mond, den Höhlen unter Rurópolis und dem Autobahnprojekt, das das Land zerschnitten hat, soll durch in Untertiteln eingeblendete Reflexionen über Steine hergestellt werden, erschließt sich aber nicht wirklich. Der Film wirft trotzdem ein interessantes Schlaglicht auf ein Brasilien jenseits der bekannten Tourismusziele und die dortigen gescheiterten, gigantischen Infrastrukturprojekte.
LN-Bewertung: 3 / 5 Lamas
Quebrante, Brasilien 2024, 23 Minuten, Regie: Janaina Wagner

© 36 caballos
Un movimiento extraño (Argentinien)
Eine Geschichte aus Buenos Aires: Lucrecia arbeitet als Museumswärterin, fliegt aber aus ihrem Job raus, weil sie den Walkie-Talkie-Kanal des Museums für schlüpfrige Gespräche mit einem Kollegen nutzt. Zum Glück hat sie einen Anstieg des Dollars vorausgesehen, was ihre Abfindung fast verdoppelt. Ihr neues Leben führt sie als Security-Guard in eine Fabrik und zu unverbindlichen privaten Treffen mit einem Wechselstuben-Mitarbeiter.
Un movimiento extraño (Eine eigenartige Bewegung) ist ein locker und vergnüglich anzusehender Kurzfilm, was vor allem am präsent-unbekümmerten Spiel von Hauptdarstellerin Laila Maltz liegt. Der Geschichte fehlt es aber insgesamt ein wenig an Richtung: Es werden viele Fässer in kurzer Zeit auf- aber nicht immer zugemacht. So vermittelt der Film zwar die Ziellosigkeit des Großstadtlebens, verpasst dafür aber die Chance, aus interessanten Figuren auch einen stringenten Plot zu stricken. Etwas überraschend deswegen, dass Regisseur und Kurzfilm-Spezialist Francisco Lezama mit seinem schon vierten Werk den Goldenen Bären für den besten Short der Berlinale gewann. Ein schöner Erfolg in jedem Fall!
LN-Bewertung: 3 / 5 Lamas
Un movimiento extraño, Argentinien 2024, 22 Minuten, Regie: Francisco Lezama

© David Correa
Uli (Kolumbien)
Rafaela langweilt sich. Ihre Eltern sind nicht da und haben ihre ältere Schwester Laura beauftragt, auf die 8-jährige aufzupassen. Doch Laura schleppt sie mit zu einem Besuch bei Alex, an dem sie offenkundig ziemlich interessiert ist. Als die beiden sich in Alex’ Zimmer einschließen, beginnt Rafaela das Haus zu erkunden. Dabei trifft sie zunächst auf eine sprechende Hündin und dann auf die queere Uli, zu der diese gehört. Schon bald wird sie von ihrer neuen Bekanntschaft mit der Aufgabe betraut, Friseurin zu spielen.
Uli zeigt zwar schöne Bilder, die Geschichte wirkt aber über weite Strecken konstruiert. Dazu bleiben einige Dinge ohne Erklärung: Warum hört Rafaela, die unerklärlicherweise die Hundesprache verstehen kann, plötzlich auf, mit der Hündin zu reden? Wieso vertraut Uli einem völlig unbekannten 8-jährigen Mädchen an, ihr die Haare zu schneiden? Was passiert mit Laura und Alex? Wie ist Ulis Verhältnis zu ihrem Bruder? Der Internationalen Kurzfilm-Jury, die Uli mit einer lobenden Erwähnung versah, gefiel es laut Begründung, dass in dem Film „keine Antworten erzwungen“ wurden. Auch wenn das, vor allem auf die Geschlechtsidentitäten bezogen, so richtig ist: Regisseurin Mariana Gil Ríos hat hier ein paar Rätsel und Ungereimtheiten zu viel aufgeworfen.
LN-Bewertung: 2 / 5 Lamas
Uli, Kolumbien 2023, 17 Minuten, Regie: Mariana Gil Ríos

© Bølier Films
Un pájaro voló (Kuba / Kolumbien)
Boloy ist der beste Spieler seines kubanischen Jugend-Volleyballteams. Doch heute kann er sich nicht aufs Training konzentrieren: Ein Freund ist gestorben und seine Gedanken sind immer noch bei ihm. Sein Trainer kritisiert die fehlende Spannung bei den Übungen und weist auf die wichtigen Spiele hin, die bald anstehen. Doch Boloy kann die Erinnerung nicht verdrängen.
Der kolumbianische Regisseur Leinad Pájaro de la Hoz verarbeitet mit dem Film seine eigenen Erfahrungen vom Verlust eines geliebten Menschen. Schade, dass in Un pájaro voló (Ein Vogel ist weggeflogen) über weite Strecken nichts anderes als Volleyballtraining zu sehen ist. Auch über den Freund erfährt man nichts weiter, als dass wohl auch er Mitglied der Mannschaft war. Fast ohne Interaktion zwischen den Charakteren bleibt die Geschichte so im Ungefähren und macht es dadurch auch schwer, Empathie aufkommen zu lassen. Die Internationale Jury der Berlinale konnte Un pájaro voló aber überzeugen: Der Film erhielt den Spezialpreis für den besten Kurzfilm in der Sektion Generation 14 Plus.
LN-Bewertung: 2 / 5 Lamas
Un pájaro voló, Kuba / Kolumbien 2024, 20 Minuten, Regie: Leinad Pájaro de la Hoz
Der Himmel über Mexiko

© Coproduction Office – Mantarraya – NoDream Cinema
Der mexikanische Film Batalla en el cielo wurde im Jahr 2023 in Mexiko restauriert und während der Berlinale erneut veröffentlicht. 2005 wurde der Film zum ersten Mal gezeigt und kontrovers diskutiert. Zu Beginn des Films werden die Hauptfiguren Ana (Anapola Mashkadiz) und Marcos (Marcos Hernandes) in einer expliziten Oral-Sex-Szene eingeführt. Für die Premiere in Mexiko wurden aufgrund der sehr freizügigen Darstellung von Sex Teile des Films herausgeschnitten.
Die Handlung folgt Marcos, der in Mexiko-Stadt lebt und als Fahrer für die Tochter eines Armee-Generals arbeitet. Nachdem er mit seiner Frau ein Baby entführt hat, stirbt dieses. Marcos ringt mit der Schuld des begangenen Verbrechens, während er gleichzeitig gegen seine Fantasien für Ana, die Tochter des Generals, kämpft. Nach einem sexuellen Zusammentreffen zwischen Ana und Marcos gesteht letzterer die Tat, und Ana überredet ihn, sich der Polizei zu stellen. Auf der Suche nach Erlösung begibt sich Marcos in die Basilika von Guadalupe, während die Polizei die begangenen Verbrechen aufdeckt.
Carlos Reygadas, geboren 1971 in Mexiko-Stadt, ist einer der bekanntesten mexikanischen Filmregisseure. Er wurde mit dem Jurypreis beim Cannes Film Festival 2007 und dem Preis für den besten Regisseur beim Cannes Film Festival 2012 ausgezeichnet. Im Jahr 2000 gründete er seine Produktionsfirma NoDream Cinema und debütierte mit seinem ersten Film Japón. Sein einzigartiger und kontemplativer filmischer Stil wurde international gelobt. Im Laufe seiner Karriere hat Reygadas soziale und existenzielle Themen erforscht und visuelle und narrative Elemente verwendet, um Filme zu schaffen, die über die einfache Handlung hinausgehen. Sein Fokus auf menschliche Intimität und seine Arbeit mit Nicht-Schauspielern waren Höhepunkte seines Werkes, das sich durch emotionale Tiefe und die Suche nach innerer Wahrheit auszeichnet.
Batalla en el cielo ist sicher nicht für alle Geschmäcker geeignet, da die Plansequenzen sehr lang sind und der Film generell im Tempo eher langsam ist. Viele Dinge bleiben ohne Erklärung und es mangelt an Kontext. Die Dialoge wirken zudem oft energielos. Dennoch gelingt es dem Regisseur, eine Atmosphäre der Fremdheit und Intrige zu schaffen. Aus einem Interview mit Reygadas ist bekannt, dass er bewusst Personen ohne Schauspielerfahrung einsetzte, um seine Protagonist*innen zu verkörpern. Zudem bekamen diese oft wenige Kontextinformationen zu ihren Szenen. Was damit geschaffen wird, ist diese Aura der Fremdheit, von Charakteren ohne Seele, die keine Vergangenheit oder Zukunft haben, und nur während des Films existieren. Insgesamt stellt sich Batalla en el cielo trotz der teils chaotischen Stimmung, die er transportiert, so doch als interessantes Kinoerlebnis dar.
LN-Bewertung: 3 / 5 Lamas
Applaus für die Filme, nicht fürs Drumherum
Jung und innovativ, frech und kritisch: Die lateinamerikanischen Filme der Berlinale 2024 zeigten wieder einmal deutlich, in welcher Hochphase sich aktuell das Kino des Subkontinents befindet. Ob gut beobachtete Dokumentationen wie Oasis über die Proteste in Chile, einfühlsame Jugendfilme wie Raíz oder frische und unbekümmerte Kurzbeiträge wie Aguacuario oder Lapso – auf allen Ebenen konnten die Filmemacher*innen von Mexiko bis Argentinien punkten. Das schlug sich auch in der Preisvergabe nieder.
Den Goldenen Bären für den besten Kurzfilm schnappte sich der Argentinier Francisco Lezama mit Un movimiento extraño (An Odd Turn), in dem er die Suche einer jungen Frau nach Glück in der Liebe und im Beruf mithilfe eines Pendels verfolgt. Das zweite Preis-Highlight war der Silberne Bär für die beste Regie des Wettbewerbs für den Film Pepe. Der dominikanische Regisseur Nelson De Los Santos Arias verleiht in diesem mutigen und wilden cineastischen Stilmix den Flusspferden des kolumbianischen Drogenbarons Pablo Escobar eine antikoloniale Stimme. Auch in der Sektion Encounters ging der Preis für die beste Regie nach Lateinamerika: Juliana Rojas (Brasilien) gewann mit ihrem wunderschön warmherzigen Episodenfilm Cidade; Campo die Herzen der Jury und der Zuschauer*innen. Gezeigt werden dort Außenseiter*innen, die unter schwierigen Bedingungen vom Land in die Stadt und umgekehrt migrieren und sich dabei gegen Widerstände durchsetzen. Begeistern konnte auch Antonella Sudasassi Furniss (Costa Rica) mit der Doku-Fiction Memories of a Burning Body. Ihre poetische und berührende Visualisierung der Lebens- und Liebesgeschichten älterer lateinamerikanischer Frauen gewann völlig zu Recht den Panorama Publikumspreis.
Zum Glück schafften es die Filme der Berlinale so wieder einmal, die Misstöne in der Organisation des Festivals zu überdecken. Und davon gab es leider einige: Die Arbeitsbedingungen für Journalist*innen wurden durch eine Erhöhung der Akkreditierungsgebühr und vor allem durch eine völlig unverständliche Zugangseinschränkung für die Pressevorführungen erschwert. Seit diesem Jahr dürfen nur noch akkreditierte Journalist*innen vorab die Filme im Kino sehen. Das macht die Arbeit für ein Redaktionskollektiv wie LN nicht einfacher.
Schockierend war auch, dass Vertreter*innen der AfD offizielle Einladungsschreiben für die Berlinale erhielten und erst heftige Proteste von Filmschaffenden und der Zivilgesellschaft nötig waren, damit sie wieder ausgeladen wurden. Eine Partei, die Abschiebungen, Queerfeindlichkeit und offenen Rassismus propagiert, hat nichts zu suchen auf einem Festival, das sich Vielfalt und Akzeptanz diverser Lebensrealitäten auf die Fahne schreiben möchte.
Dieser Anspruch darf allerdings beim Blick auf die Preisvergabe zum wiederholten Male in Zweifel gezogen werden: Wenn ein Film wie L’Empire (Frankreich) nicht nur für den Wettbewerb ausgewählt wird, sondern dort auch noch einen wichtigen Preis gewinnen darf, schadet das dem Ansehen der Berlinale. So hat Schauspielstar Adèle Haenel (Porträt einer jungen Frau in Flammen) den Film mit dem durchaus berechtigten Verweis auf dessen „dunklen, sexistischen und rassistischen“ Inhalt kritisiert. Daher war sie auch während des Drehs ausstiegen.
Vielleicht ist es deshalb gut, dass sich etwas ändert. Ab nächstem Jahr wird die Amerikanerin Tricia Tuttle als erste Frau die alleinige Leitung des Festivals übernehmen und mit dem Blick von außen hoffentlich notwendige Verbesserungen anstoßen.
Von Nonnen und Nilpferden

Raul Briones (Schauspieler, Mexiko, Hauptrolle in La Cocina) über toxische Männlichkeit:
Für mich als nicht-binäre Person ist das ein besonders wichtiges Thema. Ich habe meine Transition vor fünf Jahren begonnen. Das ist meine erste männliche Figur, die ich seitdem spiele. Seit einer Weile schon hinterfrage ich die Charaktere, die ich spiele. Ich wurde ja oft als Auftragskiller oder Bösewicht gecastet, wegen der Energie, die ich ausstrahle. Für La Cocina habe ich zum ersten Mal eine männliche Figur, Pedro, konstruiert, die scheitert. Sie rutscht in eine Katastrophe, weil sie sich ihre Trauer nicht eingestehen kann. Oft habe ich mich gefragt, ob für Männer unter diesen toxischen und gewaltvollen sozialen Umständen überhaupt ein anderes Schicksal als ein tragisches möglich ist. Denn sie zerstören sich selbst. Ich habe mir bei den Dreharbeiten einen Finger gebrochen. Und ich habe mich gefragt, warum ich diesen Schmerz ertragen muss. Warum Männer sich in dieser Weise verteidigen müssen. Ob dieser Schmerz wirklich die Konsequenz davon war, dass ich mich in Pedros Lage versetzt habe. In jemanden, der versucht, ein „echter Mann“ zu sein. Ich denke, es muss sich an der momentanen Konstruktion von Männlichkeit etwas ändern. Wir müssen diese Vorstellungen hinter uns lassen. Denn andernfalls werden wir selbst zu unseren schlimmsten Feinden werden.
Juliana Rojas (Regisseurin Cidade, Campo, Brasilien, Gewinnerin des Preises für die beste Regie in der Sektion Encounters) über die Inspiration für die Geschichten und die Figuren ihrer Filme:
Ich arbeite viel mit Beobachtung. Es gibt ein Universum von Themen, die mich interessieren. Einige sind auch in meinen anderen Filmen präsent. Zum Beispiel Arbeitsverhältnisse, Klassenverhältnisse, weibliche Figuren, Liebesbeziehungen. Außerdem beeinflusst mich normalerweise die Realität stark, zum Beispiel Nachrichten oder Erzählungen. Die Figur der Joana in meinem Film basiert auf einer wirklichen Person, die ich in einem Shoppingcenter getroffen habe. Dort habe ich einige Reinigungskräfte bei der Arbeit gesehen. Eine Frau sprach darüber, dass sie das Leben auf dem Land, die Beziehung zur Natur, die Gemeinschaft und die Gespräche mit den anderen Menschen dort vermisst. Das hat mich sehr berührt und mich zur Figur im Film inspiriert. Genau wie die Berichte, die ich über die Katastrophen beim Bruch der Staudämme Brumadinho und Mariana in Minas Gerais gelesen habe, durch die Dörfer zerstört und die Umwelt verseucht wurden. Für diese Katastrophen waren multinationale Firmen aus verschiedenen Ländern verantwortlich, unter anderem aus Deutschland. Die Berichte der Betroffenen haben mich sehr berührt. Nicht nur wegen der Tragödie und der Traumata, die sie erlebt haben. Sondern auch wegen der Schwierigkeit, nun vorübergehend an einem anderen Ort, in der Stadt, leben zu müssen. Ohne die Routinen, die sie auf dem Land hatten. Das Hauptthema des Films sollte aber nicht diese Tragödie sein. Da müsste man einen eigenen Film darüber drehen, um die Komplexität der Katastrophe aus verschiedenen Perspektiven zu zeigen.
… über Migrationsprozesse innerhalb Brasiliens:
Der Bevölkerungsfluss vom Land in die Stadt ist in Brasilien viel stärker als umgekehrt. Denn es gibt im ländlichen Raum das Problem des Anbaus von Monokulturen. Hier werden Kleinbäuer*innen und Dorfgemeinschaften mit Gewalt vertrieben, damit die großen Agrarfirmen Land für die Pflanzung von Soja, Mais oder Zuckerrohr besetzen können. Es ist deshalb nicht so üblich, aus der Stadt aufs Land zu ziehen. Aber auch hier basiert die Geschichte im Film auf echten Erzählungen von Menschen, die diese gegenläufige Bewegung gemacht haben. Die eine andere Art von Leben, eine andere Lebensqualität auf dem Land gesucht haben. Und auf ihren Schwierigkeiten mit dem Kulturschock in einer Umgebung, die gegenüber bestimmten Personengruppen feindseliger eingestellt ist. Und der täglichen, harten Arbeit auf dem Bauernhof.
… über die Ausblendung der aggressiven Diskurse der Bolsonaro-Zeit in Cidade, Campo:
Die Idee zum Film ist schon vor der Amtszeit von Bolsonaro entstanden. Der Film ist aber nicht komplett konfliktfrei, es gibt nur nicht diese Polarisierung. Die zentralen Themen sind auch nicht Frauenfeindlichkeit, Homophobie oder Rassismus – Phänomene, die während der Regierungszeit Bolsonaros viele Spannungen verursacht haben und auch immer noch sehr präsent in der Gesellschaft sind. Dennoch werden komplexe Fragen angesprochen. Joana ist eine verletzliche Person. Es geht bei ihr um die Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen, sie wird von diesem System unterdrückt. Und auch im zweiten Teil auf dem Land liegt von Anfang an Spannung in der Luft. Der Verwalter des Landguts bietet den beiden Frauen bei ihrer Ankunft eine Waffe an, damit sie sich verteidigen können. Und dann gibt es noch den Sojaanbau, der ihre Farm umzingelt.
Nelson De Los Santos Arias (Regisseur des Films Pepe, Dominikanische Republik, Gewinner des Silbernen Bären für die beste Regie) über postkoloniales Kino in Lateinamerika:
Als ich 24 Jahre alt war, habe ich begonnen, mich als Filmemacher mit postkolonialer Theorie zu beschäftigen. Ich habe gefühlt, dass ich Dinge kombinieren und vermischen musste, um Geschichten zu erzählen. Die lateinamerikanischen Länder sind stark US-amerikanisiert. Das ist durch die Produktion von Subjektivität, die Homogenisierung von Menschen passiert. Durch die Kämpfe um Pluralität und Diversität sehen wir aber, dass die Welt sehr heterogen ist. Und diese Heterogenität wird auch neue Formen und Bilder produzieren.
Das Nilpferd Pepe habe ich ausgewählt, weil es das erste Tier war, das außerhalb seines Heimatkontinents Afrika eine wilde Herde gegründet hat. Pablo Escobar hat viele Tiere auf seine Finca in Kolumbien gebracht. Leoparden oder Geparde zum Beispiel. Aber alle diese Tiere blieben in seinem Zoo und starben irgendwann einfach, weil sie menschliche Unterstützung brauchten. Aber die Flusspferde haben sich an ihre Umgebung angepasst. Und das war für mich der Anlass, es als Parabel für die historische Migration zwischen Afrika und den Amerikas zu benutzen.
… über ideologische Emanzipationsprozesse in Lateinamerika:
Ich nutze Pepe auch als Fabel, als Mittel zur Produktion von Vorstellungskraft. Ich mag das Spielerische, das Fantastische. Und ein Nilpferd erschien mir perfekt für die Personifizierung. Aber US-Produzenten haben dieses Universum für Kinder in Lateinamerika für sich in Beschlag genommen: Disney, Cartoon Network, die Feuersteins. Das hat für mich auch eine politische Bedeutung. Denn für mich besteht die gegenwärtige politische und philosophische Krise in einem Mangel an Vorstellungskraft. Dem Unvermögen, über den Eurozentrismus, den Kapitalismus oder auch sein Gegenstück, Sozialismus und Kommunismus, hinauszudenken. Stattdessen könnten wir uns auch indigene oder afro-indigene gemeinschaftliche Organisationsformen vorstellen.
…über den Einfluss von Netflix auf die lateinamerikanische Kinolandschaft:
Netflix zerstört mit seiner Arbeitsweise die nationalen Kinolandschaften. Ein Beispiel: Verglichen mit den USA zahlt es in manchen Ländern Lateinamerikas extrem wenig Lohn – aber nicht wenig für lateinamerikanische Verhältnisse. Das ist auch eine Form von Kolonialismus: Ein großes Unternehmen kommt in arme Länder auf der Suche nach billiger Arbeitskraft. Genau das macht Netflix. Und mit unserer Filmkommission kämpfen wir dagegen an. Denn die Regierungen in Lateinamerika bekommen eine Menge Geld von Netflix – für Filme wie Pepe bekommen sie dagegen kein Geld. Dann macht vielleicht der Botschafter hier auf dem Festival ein Foto mit mir. Aber das war’s dann. Netflix verdrängt die nationalen Filmindustrien. Zum Beispiel kommen sie in die Dominikanische Republik und machen eine Menge Fernsehshows. Und wir haben dann keine Leute mehr, die mit uns arbeiten wollen. Die sagen dann zu mir: „Hey Nelson, tut mir leid, dein Dreh dauert vier Wochen und die geben mir einen Vertrag für sieben Monate und ich habe Familie.“ Was soll ich da denn sagen?
Antonella Sudasassi (Regisseurin Memories of a Burning Body, Costa Rica, Gewinnerin des Panorama Publikumspreises) über das Brechen von Tabus in ihrem Film:
Das Filmprojekt hat beim letzten Gespräch mit meiner Großmutter mütterlicherseits begonnen. Bevor sie gestorben ist. Nach meinem letzten Film blieben mir viele Fragen darüber, wie ihre Generation von Frauen aufgewachsen ist: in einem viel repressiveren Umfeld als ich. Viele Sachen, die sie erzählte, kamen mir bekannt vor. Zugleich gab es nach wie vor eine Tabuisierung rund um diese Themen. Diese Tabuisierung wollte ich auflösen.
Im Film erzählen insgesamt acht ältere Frauen ihre Geschichten. Alle wollten anonym bleiben, das haben sie mir von Anfang an gesagt. Aber sie sagten auch: „Wenn mich niemand sieht, dann erzähle ich gerne.“ Am meisten Angst hatten sie davor, ihren Angehörigen zu schaden. Gar nicht einmal so sehr ihren Kindern, sondern vor allem ihren Enkeln. Es wäre ihnen peinlich gewesen, dass ihre Enkel diese Geschichten hören und schlecht von ihren Großmüttern denken könnten. Denn die Großmutter sehen wir immer noch als etwas Heiliges, als eine Art Jungfrau. Das ist zum Beispiel immer noch ein enormes Tabu. Eine ältere Frau zu zeigen, die ihre Sexualität voll und bewusst auslebt – niemals! Einige wussten bis spät in ihrem Leben nicht, was ein Orgasmus ist. Bis sie einen zweiten oder dritten Ehemann hatten. Mein Film gibt mir aber auch Hoffnung, dass sich etwas zum Guten verändert. Diese Frauen, die durch die Hölle gegangen sind, sind jetzt empowert. Mit 70 Jahren nehmen sie jetzt ihre Sexualität an und leben sie aus.
… über die weiblich dominierte Filmindustrie Costa Ricas:
Zum Glück gibt es in Costa Rica sehr viele Frauen, die Kino machen. Ich bin Mitglied in der Gewerkschaft der Regisseurinnen von Costa Rica. Wir sind über 27 Frauen, die alle schon mindestens einen Langfilm veröffentlicht haben. Für eine kleine Filmindustrie wie die in Costa Rica ist das eine ungeheure Leistung. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass es eine sehr neue Industrie ist. Sie wächst ohne die Laster einer älteren Industrie. Eine männlich dominierte Filmindustrie ist in Costa Rica nie entstanden. Sie wurde von uns Frauen erfunden. Weil wir so viele sind, die Kino machen, haben wir uns einen Raum erobert. Das Kino aus Costa Rica ist Kino, das von Frauen gemacht wird. Man sieht es auf den großen Festivals. Es repräsentiert das Land und erschafft sein Bild. Deswegen gibt es in der Filmindustrie in Costa Rica keinen Widerstand gegenüber Frauen. Im Gegenteil besteht eine große Offenheit für sie, wenn sie ihre eigenen Geschichten erzählen wollen.
Poesie für Fortgeschrittene

© Películas mirando el techo
Einfach macht es Matías Piñeiro seinen Zuschauer*innen meistens nicht. Die Werke des argentinischen Independent-Filmemachers sind mit ihren verschachtelten Narrativen und oft außerhalb des lateinamerikanischen Kontextes stehenden Leitmotiven nicht einfach zu entschlüsseln. Bislang standen oft Shakespeare oder auch mal asiatische Philosophie im Zentrum von Piñeiros Schaffen. In Tú me abrasas ist Lateinamerika nun bis auf Regisseur und Schauspieler*innen komplett außen vor. In seinem Berlinale-Beitrag verfilmt der Regisseur einen literarischen Dialog der antiken, griechischen Lyrikerin Sappho mit dem 2.500 Jahre später geborenen italienischen Schriftsteller Cesare Pavese.
Klingt kompliziert? Ist es auch und Piñeiros Herangehensweise macht den Einstieg in den Film nicht unbedingt leichter. Aneinandergereiht werden sich wiederholende Bildkompositionen gezeigt: Blumen, Äpfel, Gebäude, eine Spüle, eine Türklingel und immer wieder das Meer. Einige Bilder werden als visuelle Entsprechungen für einzelne Begriffe etabliert, zum Beispiel für die drei Wörter des Filmtitels. Wer sich darauf einlässt, dem erschließt sich – wie so oft bei Piñeiro – die narrative Struktur dann nach einer Weile. Stück für Stück fließen biographische Informationen zu Pavese und Sappho ein, Parallelen werden klar: Unerfüllte Liebe und die Frage nach Akzeptanz oder Lenkung des eigenen Schicksals waren bei beiden Schriftsteller*innen präsent. Gedichte Sapphos und Paveses Text „Meeresschaum“ werden zitiert und auf Buchseiten eingeblendet – Letzteres sehr ausführlich und deutlich. Für das Verständnis ist das von großem Vorteil, man kann Matías Piñeiro also nicht vorwerfen, dass er gar nicht an seine Zuschauer*innen denkt. Elliptisch werden zentrale Themen, Begriffe, Namen (vor allem aus der griechischen Mythologie) und Bilder akustisch und visuell wiederholt. Es stellt sich ein Rhythmus ein und langsam auch ein Verständnis für den philosophischen Dialog über die Jahrtausende, den Pavese mit Sappho führt. Dazu sind Piñeiros Bilder in körnigen 16-Millimeter-Aufnahmen geschickt und poetisch komponiert. Gerade die häufigen Aufnahmen von Meer, Felsen und Wellen fügen sich sehr harmonisch in die akustische Erzählung ein. Auch einige Schauspielerinnen dürfen ab und zu durch Städte, Gärten oder Museen laufen und Tiere wie Vögel, Krebse oder Schildkröten sorgen für Vitalität in der visuellen Sprache. Die ausgewählten Texte thematisieren dagegen meist verzweifeltes Begehren und die Unmöglichkeit glücklicher Liebe und durchziehen Tú me abrasas so mitmelancholischer Stimmung, passend zum traurigen Ende Paveses, der sich selbst das Leben nahm – genau wie der Legende nach auch Sappho, was allerdings historisch nicht gesichert ist.
Tú me abrasasfordert viel von seinem Publikum: Das exotische Thema, die sperrige, nicht-lineare Erzählweise und eine collagenartige, repetitive Bildsprache machen den Film zu einem sehr speziellen Kinoerlebnis, das nicht alle Kinogänger*innen in gleichem Maße ansprechen wird. Wer sich aber nach den ersten Minuten nicht abschrecken lässt und der intellektuellen und ästhetischen Reise des Films weiter folgt, wird mit einer interessanten audiovisuellen Erfahrung, einem Erkenntnisgewinn zum Dialog zweier Dichter*innen und einem überraschend guten Gefühl beim Verlassen des Kinos belohnt.
LN-Bewertung: 3 / 5 Lamas
Stadt, Land, Kuss

© Cris Lyra / Dezenove Som e Imagens
As boas maneiras (Gute Manieren), der Überraschungserfolg über ein Werwolfbaby in São Paulo gilt bis heute über Brasilien hinaus als Kultfilm im Horrorgenre. Nicht nur das ungewöhnliche Narrativ, auch die gelungenen Schockmomente, der überraschende Stilmix und die warmherzige Darstellung der Protagonist*innen sorgten für Aufsehen und einen Preisregen auf internationalen Festivals. Nun ist Juliana Rojas, die Co-Regisseurin von As boas maneiras, mit dem Episodenfilm Cidade; Campo (Stadt; Land) zum ersten Mal auf der Berlinale zu Gast. Diesmal ist sie allein verantwortlich für Regie und Drehbuch. Und auch wenn Cidade; Campo thematisch eine ganz andere Richtung einschlägt als sein Vorgänger – Rojas’ Handschrift ist unverwechselbar und macht die 42-jährige aktuell zu einer der aufregendsten Stimmen im lateinamerikanischen Kino.
Dabei klingt das Konzept des Films zunächst etwas sperrig: Cidade; Campo besteht aus zwei einstündigen Episoden, die sich inhaltlich nicht überschneiden. Dabei geht es um Migrationsgeschichten vom Land in die Stadt und umgekehrt. Die erste Episode folgt Joana (Fernanda Vianna), die durch den Bruch des Staudamms Brumadinho und den nachfolgenden Erdrutsch ihre Farm und ihre Tiere verloren hat. Nun zieht sie in die Millionenmetropole São Paulo zu ihrer Schwester Tânia (Andrea Marquee), die sie herzlich aufnimmt. Obwohl Joana nach wie vor traumatisiert ist, schafft sie es schnell, Arbeit bei einem Putzdienst zu finden, was ihr findiger Großneffe Jaime (Kalleb Oliveira) für sie per App organisiert. Dort freundet sie sich mit ihren Kolleginnen an und kämpft mit ihnen gegen die fortschreitende Prekarisierung ihrer Arbeitsverhältnisse. Weil Rojas es schafft, der eigentlich unspektakulär verlaufenden Geschichte durch einen genauen Blick auf ihre Hauptfiguren und liebevoll inszenierte Details einen Spannungsbogen zu geben, fällt Abschied von der ersten Episode nach einer Stunde schwer. Doch auch die zweite Episode hat es in sich. Hier zieht Flavia (Mirella Façanha) gemeinsam mit ihrer Partnerin Mara (wie immer großartig: Bruna Linzmeyer) aus der Stadt auf die verlassene kleine Farm ihres verstorbenen Vaters. Von Beginn an werfen sich die beiden Frauen voll ins Land- und Liebesleben (die ästhetisch inszenierten und choreografierten Liebesszenen sind ein Highlight des Films). Dabei herrscht klare Arbeitsteilung: Mara ist Tierärztin und kümmert sich vor allem um das Vieh, Flavia übernimmt die Knochenarbeit auf dem Feld. Nach und nach wird allerdings klar, dass mit der Farm etwas nicht stimmt. Und ohne zu viel zu verraten, zeigt die Regisseurin spät im Film, aber dafür umso gekonnter, dass sie auch an der Klaviatur des Horrorgenres nichts verlernt hat.
Es ist die Mischung aus originellen Inszenierungen, Stilsicherheit in den verschiedenen Genres (Joanas fiktive Putz-App möchte man sich nach den Werbe-Jingles im Film am liebsten sofort herunterladen) und dem Gefühl für Stimmungen, die Cidade; Campo sehr sehenswert macht. Ganz besonders fällt aber immer wieder auf, wie sehr Juliana Rojas ihre Figuren liebt: Oft sind es Außenseiter*innen, die nicht gesellschaftlichen oder körperlichen Idealbildern entsprechen, aber durch ihr Handeln und ihren ehrlichen, liebevollen Umgang miteinander im Handumdrehen das Herz des Publikums gewinnen. Figuren, die das Land Brasilien nach den polarisierenden und auch für die Außenwirkung verheerenden Bolsonaro-Jahren dringend gebrauchen kann. Man wünscht allen, die ihnen zusehen, dass sie sich von ihrer Empathie und Aufrichtigkeit eine Scheibe abschneiden. Und natürlich, dass es bald wieder mehr solcher wunderbaren brasilianischen Filme wie Cidade; Campo gibt.
LN-Bewertung: 5 / 5 Lamas
Moby Dick im Río Magdalena

© Monte & Culebra
In den späten 1970er-Jahren brachte der Drogenbaron Pablo Escobar auf illegale Weise drei Flusspferde aus Namibia nach Kolumbien in seinen Privatzoo. Nach seinem Tod flohen sie aus seiner Finca Nápoles zwischen Bogotá und Medellín in den nahe gelegenen Río Magdalena, wo sie sich unter tropischen Bedingungen seither prächtig vermehren: Aus dem ursprünglichen Trio sind mittlerweile geschätzt 160 Tiere geworden. In einigen Jahren könnten es Tausende sein, was zu unvorhersehbaren Folgen für Mensch und Ökosystem führen würde. Das Erbe von Escobar macht der Region auch so bis heute zu schaffen. Aktuell plant die kolumbianische Regierung, die Tiere entweder zu sterilisieren oder in ein anderes Land umzusiedeln.
Der dominikanische Regisseur Nelson Carlos De Los Santos Arias stolperte als Rucksacktourist in Kolumbien über die Geschichte und beschloss, einen Film darüber zu machen – die Idee zu Pepe war geboren und hat es in den Wettbewerb der Berlinale geschafft. Seinen Titel gibt dem Film dabei das wohl bekannteste Exemplar der Flusspferdherde: Pepe, ein Bulle, der von der Gemeinschaft ausgestoßen wurde und sich deshalb als erster daran machte, das Territorium um den Río Magdalena auf eigene Faust zu erkunden. Da die kolumbianischen Flusspferde schon einige Spuren in der Popkultur hinterlassen haben – es gibt Podcasts und sogar eine Doku-Soap des National Geographic Channel mit dem reißerischen Titel Cocaine Hippos über sie – musste ein frischer Ansatz her. Der vom experimentellen Film kommende De Los Santos Arias entschied sich dafür, ihre Geschichte aus ihrer eigenen Perspektive zu erzählen, mit dezidiert antikolonialer Perspektive.
Den Tieren eine glaubwürdige Stimme zu geben, war dabei eine der wichtigsten Aufgaben. Pepe löst diese auf interessante Weise, indem professionelle Sprecher in verschiedenen Sprachen (Spanisch, Afrikaans, Mbukushu) eingesetzt werden, die ihre von banal bis philosophisch reichenden Monologe häufig mit Tierlauten untermalen. Geschickt zieht der Film so mit antikolonialem Dreh eine Parallele zum hunderte Jahre zuvor erfolgten Sklavenhandel: Wie damals Menschen, so wurden hier Tiere gegen ihren Willen von ihrem Heimatkontinent auf einen neuen verschleppt, an den sie sich anpassen mussten. Die Monologe der Flusspferde sind vor allem in der ersten Hälfte des Films zu hören und drehen sich nur am Rand um die Beteiligung Escobars an ihrer Zwangsumsiedlung. Stattdessen geht es mehr um Rangkämpfe, Beschreibung der Umwelt und die Erinnerung und Bedeutung der eigenen Herkunft.
Doch Pepe belässt es nicht nur bei der Flusspferd-Nabelschau, sondern begibt sich ab etwa der Hälfte der Laufzeit auf das Territorium der menschlichen Bewohner*innen am Río Magdalena. Die Szenen dort sehen dokumentarisch aus, sind aber komplett fiktionalisiert. Dieser Abschnitt des Films beginnt mit einer lustigen Episode über zwei junge Handlanger Escobars, die die undankbare Aufgabe haben, die ersten Flusspferde ihres patrón mit einem Lastwagen zu ihrem Bestimmungsort zu bringen. Im weiteren Verlauf kümmert sich der Film dann vor allem um den Fischer Candelario und seine Familie. Candelario stolpert als erstes über einen der nun frei im Fluss herumstreunenden Dickhäuter und wird nicht müde, allen die es interessiert (oder auch nicht), immer wieder seine Geschichte von dem „Baumstamm, Krokodil oder Ungeheuer“, das ihn fast aus dem Boot geworfen hätte, zu erzählen. In seinem Eifer, die Tiere vertreiben zu wollen, wirkt er fast wie ein kolumbianischer Käpt’n Ahab, der Moby Dick aus seinem Fluss jagen möchte. Die Polizei ist daran jedoch eher weniger interessiert und seine Frau Betania hält ihn gar für einen Spinner, was Candelario natürlich nur noch weiter auf die Palme bringt.
Pepe besteht aus einem bunten Sammelsurium aus Themen und filmischen Stilrichtungen (auch Cartoons werden ab und zu eingespielt), die ihre Höhen und Tiefen haben. Manchmal ist das etwas anstrengend. Denn eine durchgehende Handlung soll der Film gar nicht haben und ohne einiges an Insider*innen-Vorwissen besteht die Gefahr, an einigen Stellen den Faden zu verlieren. Zum Glück wird aber alles durch wunderschöne Naturaufnahmen der Flusslandschaften in Südwestafrika und Kolumbien zusammengehalten, was auch für so manche erzählerische Länge oder Merkwürdigkeit entschädigt.
LN-Bewertung: 3 /5 Lamas
Living la vida de Barrio

© Monociclo Cine
Die Busstrecke ist neu für Sandra, ihre neue Arbeitsstelle liegt außerhalb ihres Wohnviertels in der kolumbianischen Metropole Medellín. Den Ausstieg muss sie deshalb beim Busfahrer in Erfahrung bringen. Mit ungeahntem Erfolg: Die Nachfrage bringt ihr zuerst ein Gratisbonbon und später einen Sitzplatz neben dem Motorista ein. Ein guter Start in ihren neuen Job als Security-Mitarbeiterin in einem Shopping-Center.
Sandra (Alba Liliana Agudelo Posada) ist die Protagonistin in La piel en primavera (Die Haut im Frühling), dem ersten Spielfilm der kolumbianischen Regisseurin Yennifer Uribe Alzate. Wie der Titel verspricht, herrscht Frühling in Medellín, was für die Charaktere des Films bedeutet: Überall ertönt Musik, Arbeit wird dem Vergnügen untergeordnet und es wird geflirtet, was das Zeug hält. Zu Beginn will Sandra dabei zwar nicht mitmachen. Aber irgendwann wird es einfach zu viel: Der halbwüchsige Sohn knutscht mit seiner neuen Freundin auf der Terrasse, die Kolleginnen tratschen über ihre Ausschweifungen beim Betriebsausflug und die Putzfrau preist in den höchsten Tönen die neuen Dildos aus ihrem Nebenerwerb, einem Online-Sex-Shop an. Also Lippenstift aufgetragen, Outfit aufgefrischt und rein ins Dating-Leben!
La piel en primavera ist ein Film, der gar nicht erst versucht, besonders Außergewöhnliches zu präsentieren und vielleicht genau deshalb so gut funktioniert. Das Arbeiter*innenviertel Barrio Belén Las Violetas mit seinen unverputzten Ziegelsteinwänden gibt dazu den passenden Hintergrund ab: Wenig Glamour, aber dafür umso mehr Atmosphäre für eine Geschichte, die so repräsentativ ist für das Leben in einer lateinamerikanischen Großstadt. Die alleinerziehende Sandra lebt selbstbestimmt, ihre Autonomie wird durch das häufige Rauchen auf dem eigenen Balkon visualisiert. Sie holt sich Selbstbewusstsein im Job, trifft sich mit ihren Freundinnen zum Tanzen oder kümmert sich mit wechselndem Erfolg um die Herzensangelegenheiten ihres Teenager-Sohns und um ihr eigenes Liebesleben. Mit Handkamera und häufigen Close-Ups wird den Darsteller*innen auf den Leib gerückt, die Musik spielt unaufhörlich im Hintergrund und die feuchte Hitze der Stadt ist im Kinosaal fast physisch spürbar. Dazu kommt ein ausgefeiltes Surround-Soundmanagement: Im Bus sind die Rufe der Fahrgäste vorne und die Ansagen des Lautsprechers hinten zu hören und auch auf der Straße scheinen Gesprächs- und Geräuschfetzen von überall her zu kommen. Das fühlt sich so gut und mitten aus dem Leben gegriffen an, dass man sogar dem Plot manche klischeehafte Wendung verzeiht. Ohnehin geht es La Piel en Primavera aber offensichtlich mehr um ein Lebensgefühl als um eine ausgefeilte Story: Wer auf verzwickte Drehbuch-Twists hofft, sollte um den Film eher einen Bogen machen. Regisseurin Uribe Alzate ist trotzdem ein locker-vergnüglicher Erstlingsfilm mit Feel-Good-Vibes gelungen, den man einem breiten Publikum als anschauliches Beispiel einer (weiblichen) working-class Lebenswirklichkeit des südamerikanischen Subkontinents empfehlen kann.
LN-Bewertung: 4 / 5 Lamas
Das Fremde bleibt fremd

© Victor Juca
Argentinien, Taiwan, Deutschland, (Nordost-)Brasilien: Die anDormir de olhos abertos (dt.: „Mit offenen Augen schlafen”) beteiligten Produktionsländer lesen sich wie ein buntes Sammelsurium unterschiedlichster (Film-)Kulturen, bei denen nur schwer vorstellbar ist, wie sie in einem gut 90-minütigen Film zusammenzubringen sind. Dieser undankbar klingenden (aber selbstgewählten) Aufgabe hat sich die deutsche Regisseurin Nele Wohlatz (El futuro perfecto) verschrieben und, Spoiler: Wie zu befürchten erweist sich das Projekt als eine Nummer zu groß.
Dormir de olhos abertosspielt in der Küstenmetropole Recife im brasilianischen Nordosten, genauer gesagt am Strand Boa Viagem, der etwas außerhalb des Zentrums liegt. Der Film folgt zunächst der Touristin Kai (Liao Kai Ro), die einen Strandurlaub mit ihrem argentinischen Partner geplant hat, der sie aber am Flughafen versetzt. Warum er dies tut und warum ihr Urlaub ausgerechnet in Boa Viagem stattfindet (auch in Argentinien und China gibt es Strände und in Brasilien sogar ganz in der Nähe weitaus schönere) – es bleibt ein Rätsel, wie so vieles in diesem Film. Kai stolpert dann jedenfalls, zwar höchst sprachgewandt aber touristisch sichtlich unerfahren, schon bald über chinesische Händler*innen, die Saisonware an gemieteten Verkaufsständen anbieten. Dort kommt sie an einen Stapel Postkarten, auf den die chinesischen Exilantin Xiao Xin (Chen Xiao Xin), die Brasilien mittlerweile schon verlassen hat, den Anfang eines Romans geschrieben hat.
Diese ziemlich konstruierte Ausgangslage (Warum in aller Welt nimmt Xiao Xin nicht einfach ein Buch?) soll das Verbindungsstück zwischen den beiden Erzählebenen sein. Tatsächlich ist sie aber nur der Gipfel des Eisbergs eines Plots, der vor Unglaubwürdigkeit und fallengelassenen Erzählsträngen nur so strotzt. Besonders die arme Touristin Kai trifft es immer wieder hart. So muss sie schon am ersten Tag ohne ersichtlichen Grund auf eine Verkehrsinsel urinieren oder läuft lieber bis zur Dunkelheit durch die Peripherie einer der gefährlichsten Städte der Welt, als sich ein Taxi zu rufen. Dadurch muss sie in einem Love Motel (in Brasilien sehr beliebte Stundenhotels mit entsprechender Ausstattung) die Nacht verbringen, wo sie sich – Achtung Culture Clash-Holzhammer! – sichtlich unwohl fühlt. Am nächsten Tag geht es dann plötzlich doch mit dem Moto-Taxi zurück in ihre Unterkunft. Dies (und vieles andere), so hat man den Eindruck, passiert in Dormir de olhos abertos nur, weil einige Drehbuchszenen vom Reißbrett auf Teufel komm raus untergebracht werden oder auch die Filmfördergelder aus den verschiedenen Ländern eingetrieben werden mussten.
Manchmal wird der Film sogar zu einem echten Ärgernis. Was ein interessanter Einblick in ausbeuterische Arbeits- und Lebensbedingungen von chinesischen Wanderarbeiter*innen hätte werden können, gerät nämlich durch den Fokus auf bemüht-lustige kulturelle Verirrungen oft in die Nähe einer Farce mit rassistischen Einschlägen. So werden die Brasilianer*innen fast durchgängig als feierwütig, übergriffig-beleidigend oder korrupt dargestellt, während die Chines*innen weitgehend zurückhaltend und fast schon unterwürfig auftreten. Der Blick von Regisseurin Wohlatz auf die hölzern geschnitzten Charaktere (ein deutscher ist, ein Schelm der Böses denkt, nicht dabei) ist oft kein mitfühlend-interessierter, sondern wirkt klischeehaft und sieht belustigt oder gar besserwisserisch auf ihre vermeintlich durch ihre Herkunft definierten Eigenarten herab. Im Jahr 2024 ist dieses naive Kulturverständnis nicht mehr zeitgemäß, was insgesamt den Eindruck verfestigt, dass Dormir de olhos abertos nicht über genug Substanz verfügt, um einen Langfilm über die volle Distanz zu tragen.
LN-Bewertung: 1/5 Lamas
Das Ende von Scham und Schweigen

© Substance Films
„Solange ich lebe, werde ich niemals alt sein!“ sagt eine der Frauen, und es scheint egal, von welcher der Protagonistinnen der Satz stammt. Denn die 68-jährige Ana, die 69-jährige Patricia und die 71-jährige Mayela erzählen in der costa-ricanischen Doku-Fiktion Memorias de un cuerpo que arde (Erinnerungen an einen Körper, der brennt) zwar jede für sich die Geschichten ihres Lebens und vor allem ihrer Liebe und Sexualität. Regisseurin Antonella Sudasassi Furniss verknüpft diese aber so geschickt, dass es keine Rolle mehr spielt, wer zu welchem Zeitpunkt etwas erlebt hat. Im Vordergrund steht die Erzählung, das Zursprachebringen von jahrzehntelang tabuisierten und verschwiegenen Bedürfnissen.
Memorias de un cuerpo que arde bedient sich dabei des Tricks der visuellen Fiktionalisierung. Denn die drei Frauen aus Costa Rica sind im Film nur mit ihrer Stimme präsent, um ihre Anonymität zu wahren. Im Bild zu sehen sind Schauspielerinnen wie Sol Carballo oder Paulina Bernini. Diese spielen die aus dem Off erzählten Ereignisse in teils echten, teils symbolischen Handlungen nach. Dabei findet das Geschehen ausschließlich in einer extra angemieteten Wohnung statt, schön eingeführt in der Anfangsszene, die den Einzug des Filmteams zeigt. Kreativ oder sogar poetisch sind auch die weiteren Einfälle zur Inszenierung: Da laufen Hühner durch die Wohnung, Vasen gehen zu Bruch und einmal scheint sogar ein ganzer Jahrmarkt innerhalb der vier Wände stattzufinden.
Doch ebenso verdienen die Lebensgeschichten der Frauen Aufmerksamkeit. Es sind Geschichten, die Frauen nicht nur in Lateinamerika unzählige Male so oder so ähnlich erlebt haben und erleben. Geschichten von romantischen Gefühlen und sexuellem Begehren, aber auch von Unterdrückung, Scham und Missbrauch. Von sexueller Erziehung an der Grenze zur Komik, Frustration und Gewalt im Eheleben und der Befreiung davon erst im Alter. Sex, so sagt eine der Frauen, sei in ihrem Leben gewesen „wie ein Schwarzes Loch: Man sah es nicht und es schien, als würde es nicht existieren, doch am Ende hat es dich verschlungen“. Physische und psychologische Gewalt gegen Mädchen und Frauen, das bestätigt jede der drei Erzählerinnen, waren in ihrem Umfeld allgegenwärtig. Von klein auf sollten sie beispielsweise lernen, ihren Kleidungsstil als „Rüstung“ zu begreifen, um nicht die „Instinkte der Männer zu wecken“ – damit gemeint waren ihre eigenen Verwandten. Über christliche Werte („Ertrage dein Schicksal!“) wurden den Frauen dabei Schuldgefühle eingeimpft, während übergriffige und gewalttätige Männer unbehelligt davonkommen konnten.
Das Verdienst von Memorias de un cuerpo que arde ist es, die Ungerechtigkeit und Unterdrückung, die Frauen erfuhren und noch immer erfahren, aus einer costa-ricanischen bzw. lateinamerikanischen Perspektive zu einem plastischen und kollektiven Narrativ zu verweben. Regisseurin Antonella Sudasassi Furniss hat damit nach ihrem gefeierten Erstlingswerk El despertar de las hormigas (Das Erwachen der Ameisen) erneut einen sehr starken Film abgeliefert. Mit ihrer Dokumentation gibt sie einer ganzen Generation von Frauen eine gemeinsame Stimme, die das Schweigen bricht und gleichzeitig Hoffnung gibt, dass durch die Trennung von gewalttätigen Partnern ein anderes, glücklicheres Leben möglich ist. „Ich verstehe nicht, dass so viele sagen, im Alter ginge es nur noch bergab“, sagt eine der drei Erzählerinnen gegen Ende des Films. „Für mich ist das die beste Zeit meines ganzen Lebens. Endlich habe ich totale Freiheit!“
LN-Bewertung: 5/5 Lamas
Die Wurzeln verteidigen

© Johan Carrasco
„Peru fährt zur WM nach Russland, du wirst sehen! Weißt du, wo Russland ist?“ fragt der Junge Feliciano sein Alpaka Ronaldo zu Beginn von Raíz vor einer majestätischen Bergkulisse in den peruanischen Anden. Er hütet die Alpakas seiner Familie und hört dabei im Radio die Fußballspiele der peruanischen Nationalmannschaft. Raíz bedeutet Wurzel ̶ die für die indigene Bevölkerung im Altiplano heiligen Berge und die Alpakas, deren Wolle ihre wichtigste Einnahmequelle ist, stehen im zweiten Spielfilm des Regisseurs Franco García Becerra für diese Wurzeln.
Felicianos Welt wird von Bergbau bedroht: In der Nähe seines Dorfes befindet sich eine Mine, die Weiden und Wasser verschmutzt und die Tiere krank macht. Die Bewohner*innen beschweren sich, werden jedoch nicht gehört. Stattdessen schickt die Mine einen Arbeiter, der sich hilfsbereit gibt und die Leute davon überzeugen will, dass die Mine Fortschritt und Wohlstand bringt. Einige Dorfbewohner*innen beschließen zwar, ihre Tiere zu verkaufen und wegzuziehen, viele wollen jedoch ihr gewohntes Leben fortführen und ihr Land behalten. Schließlich greift das Bergbauunternehmen zu härteren Bandagen.
Die selbst aus dem Andenhochland stammenden Schauspieler*innen hatten meist ebenfalls Erfahrung mit ähnlichen Situationen, wie der Regisseur berichtet. Felicianos WM-Begeisterung und die gleichzeitig stattfindende neoliberale Ausbeutung von Mensch und Natur um ihn herum sind Themen, bei denen viele Menschen in ganz Lateinamerika mitfühlen können. Der im nahen Cusco aufgewachsene García nimmt sich im Film Zeit dafür, die Träume der Menschen, ihren Alltag und ihre Verbundenheit mit der Umgebung darzustellen: Feliciano spricht mit Ronaldo und seinem Hund Rambo, tollt mit ihnen auf der Wiese herum. Er sammelt besondere Steine oder spielt Fußball mit anderen Jungs. Die Dorfbewohner*innen wollen Bildung für ihre Kinder, sie scheren zusammen die Alpakas oder gehen in die nächste Stadt, um ein Fußballspiel zu sehen.
Der Film vermittelt alltägliche Authentizität ohne Klischees. Dazu trägt auch bei, dass alle im Film ausschließlich Quechua sprechen, die meistgesprochene einheimische Sprache Lateinamerikas. Auch lokale Glaubensvorstellungen sind präsent, wenn immer wieder ein geheimnisvolles Wesen auftaucht, vor dem die Menschen sich fürchten, sich jedoch auch Hilfe erhoffen, während sich der Konflikt mit der Mine zuspitzt.
„Sie nehmen sich immer mehr Reichtümer und lassen uns nichts übrig“, resümiert Felicianos Vater einmal die Lage. Die Schlussfolgerung: „Wenn wir die Straße blockieren, müssen sie uns zuhören. Wir müssen uns vereinen und kämpfen.“ Die mit großartigen Bildern feinfühlig und nahbar erzählte Geschichte von Feliciano und seinem Dorf ist ein Plädoyer für Träume, für kulturelle Vielfalt, den Respekt vor Menschen und Natur und dafür, dass es sich lohnt, solidarisch für diese Dinge zu kämpfen.
Hüter der verlorenen Lieder

© Natalia Burbano / Contravía Films
“Gelobte Seelen des Fegefeuers, zeigt mir den Weg”, betet José de Los Santos inmitten afrokolumbianischer Rituale. In seiner Gemeinde im Regenwald der kolumbianischen Pazifikregion Chocó vereinen und solidarisieren sich die Bewohner durch Gesänge und Gebete, um den Trauerprozess zu bewältigen. Der Protagonist des Films Yo vi tres luces Negras, (“I saw three black lights”), gespielt von Jesús María Mina, lebt unter den Toten, hat die Gabe, sie zu sehen und mit ihnen zu sprechen. Diese Kommunikation mit seinen Vorfahren ermöglicht es ihm, im Hier und Jetzt voranzukommen und seinen eigenen Weg zu gehen.
Yo vi tres luces negras ist die zweite Langfilm-Produktion des kolumbianischen Regisseurs Santiago Lozano und feiert auf der 74. Berlinale in der Panorama-Sektion des Festivals seine Weltpremiere. Wie schon in seinem ersten Film greift Lozano das Thema Tod und Bestattungsrituale des afrokolumbianischen Pazifikraums auf, diesmal anhand der schicksalhaften Reise von José de Los Santos. Der 70-jährigen wird von seinem verstorbenen Sohn Pium besucht, der nun auch ihm seinen Tod ankündigt. Pium teilt seinem Vater mit, dass er seinen letzten Gang in die Tiefen des Dschungels antreten muss. Auf dem Weg dorthin trifft José auf paramilitärische Gruppen, die ihn bei seinem Vorhaben behindern – dieselben, die seinen Sohn Jahre zuvor ermordet haben.

© Christian Velasquez / Contravía Films
Mit großer visueller und symbolischer Reichhaltigkeit zeigt der Film den Synkretismus, der in den Gemeinden des Departamento Chocó, praktiziert wird, wobei der Tod innerhalb dieser Weltanschauung besonders betont wird. Im Verlauf der Geschichte wird klar auf die Bedeutung der mündlichen Überlieferung für das Überleben archaischer spiritueller Praktiken der Pazifikregion hingewiesen. Diese gehen allmählich durch Gewalt verloren, während die dortigen Bewohner zum Schweigen gebracht werden. Und auch die Auswirkungen des Bergbaus auf die Lebensweise der Menschen und die natürlichen Ressourcen werden deutlich. José de Los Santos wird dabei als “Hüter des Landes” dargestellt, der seinen Kampf gegen Zerstörung und Ausbeutung jedoch mit ungleichen Waffen führen muss.
Besonders bemerkenswert an Yo vi tres luces negras ist die Kinematografie, die den Dschungel in seiner ganzen Tiefe eindringlich einfängt, so dass dieser wie ein eigener Charakter wirkt. Der Film beginnt und endet mit der imposanten Präsenz des Rio San Juan, einem der mächtigsten und wichtigsten Flüsse Kolumbiens. Das Wasser als symbolisches Element ist sowohl visuell als auch klanglich in der Geschichte präsent. Darüber hinaus trägt die beeindruckende Filmmusik von Nidia Góngora, einer Komponistin von und Forscherin zu traditioneller kolumbianischer Musik, Yo vi tres luces negras stimmungsvoll durch die Eingeweide des Dschungels.
Lozanos Arbeit als Regisseur ist zweifellos vielversprechend, denn er zeigt Engagement für seine eigene ästhetische Erkundung. Sein Blick ist nach innen gerichtet, aber er spricht universelle Themen an. Yo vi tres luces negras ist ein empfehlenswerter Film, der innerhalb der Panorama-Sektion der Berlinale sicher zu den stärkeren Beiträgen gehören wird.
LN-Bewertung: 4/5 Lamas
Nicht das Gelbe vom Ei

© Juan Pablo Ramírez / Filmadora
Der mexikanische Regisseur Alonso Ruizpalacios ist mittlerweile erfolgreicher Stammgast auf der Berlinale: 2018 gewann sein Film Museo einen Silbernen Bären für das beste Drehbuch, die Doku-Fiktion A Cop Movie 2021 die gleiche Auszeichnung für den besten Schnitt. Nun verlässt Ruizpalacios mit dem auf einem Theaterstück basierenden La Cocina (dt.: Die Küche) erstmals Mexiko und betritt die Räume eines New Yorker Restaurants am Times Square. „The Grill“, so der Name des Etablissements, bietet nicht die ganz exklusiven Gaumenfreuden, sondern eher Massenkost für die touristische Durchgangskundschaft. Schnell und möglichst kosteneffizient soll serviert werden und eine der Zutaten dafür ist der illegale Aufenthaltsstatus des Großteils des Küchenpersonals. Den nutzt der schmierige Restaurantbesitzer Rashid auf ziemlich unappetitliche Weise zu seinem Vorteil aus. Denn Mitarbeiter*innen wie der Hallodri Pedro (Raúl Briones) stehen so nicht nur ständig mit einem Bein vor dem Rauswurf aus dem Restaurant, sondern gleich aus dem ganzen Land. Das hält die Motivation bei der Arbeit quasi von alleine hoch. Pedro hat zudem ein Verhältnis mit der abgebrühten Kellnerin Julia (Rooney Mara), deren Schwangerschaft schmeckt jedoch nicht beiden in gleicher Weise.
La Cocina (aus nicht näher definierten Gründen fast komplett in Schwarz-Weiß gefilmt) gelingt esgut, die quirlige, rastlose Atmosphäre in der im Akkord arbeitenden Restaurantküche einzufangen. Schon zu Beginn des Films verfestigt sich aber der Eindruck, als würde hier zu viel in einen Topf geworfen. Die so zahlreichen wie unterschiedlichen Charaktere sind zwar vordergründig sehr unterhaltsam, was vor allem an den schauspielerischen Leistungen (eine Entdeckung vor allem Anna Diaz als Küchen-Neuling Estela) liegt. Doch das allein macht den Kohl leider nicht fett. Denn das Drehbuch bekommt es nicht gebacken, auch nur einem von ihnen eine vernünftige Hintergrundgeschichte zuzubereiten. Dem Publikum wird so mit interessanten Subplots der Mund wässrig gemacht, nur um diese dann im Nichts verlaufen zu lassen. Ein hartes Brot sind auch die häufigen, unverhohlen sexistisch-anzüglichen Bemerkungen und Gesten der männlichen Mitarbeiter in Richtung der (ausschließlich weiblichen) Kellnerinnen. Da diese meist unwidersprochen bleiben, kommt La Cocina hier in Teufels Küche. Zudem finden sich auch bei der Montage und Erzählweise des Films einige Haare in der Suppe: Manche Szenen sind geradezu schmerzhaft lang ausgedehnt, andere wirken nicht richtig abgeschmeckt oder zum falschen Zeitpunkt in die Geschichte eingesetzt.
Das durchgeknallte Finale ist zwar noch einmal ein gefundenes Fressen für Freund*innen der gepflegten Eskalation. Aber im Prinzip ist die Suppe hier schon versalzen. Denn letztendlich wird in Bezug auf das entscheidende Thema des Films – Wie umgehen mit illegalisierter Migration und Beschäftigung? – nur um den heißen Brei herumgeredet. Den Appetit verdirbt auch so manches abgedroschene Klischee über Lateinamerikaner*innen. Insgesamt ist La Cocina damit sicher kein Gourmetbissen geworden. Was sich der Film in über 2 Stunden mit zu vielen Unausgegorenheiten einbrockt, können auch großartige Einzelleistungen von Kamera und Schauspieler*innen am Ende nicht mehr auslöffeln.
LN-Bewertung: 2/5 Lamas
- 1
- 2
- 3
- …
- 9
- Nächste Seite »

