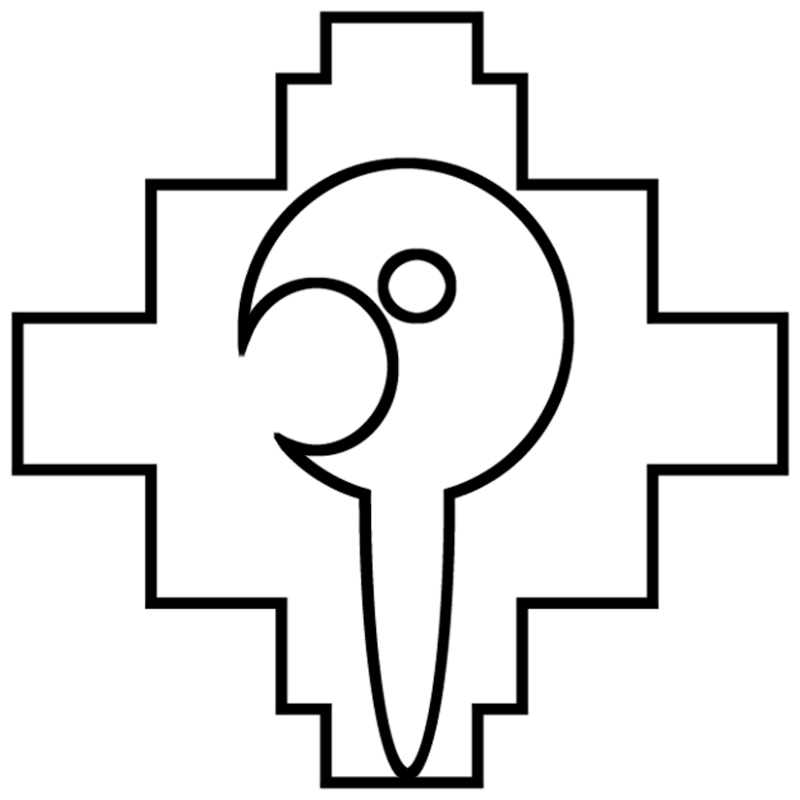Der Pakt ist ein Deal
Fragwürdige Befriedungsstrategien für die Mapuche
Am 5. August holte sich der Präsident Frei ein wenig Farbe ins graue und smoggebeutelte Santiago: Im Innenhof des Moneda-Palastes, einem beliebten Ort für staatstragende Feierlichkeiten, wurde ein Llelipún, eine Gemeinschaftszeremonie der Mapuche veranstaltet. Umringt von alten Frauen im traditionellen Silberschmuck und unter dem Klang von Kultrún-Trommeln fand der Würdenträger hehre Worte: „Wir können noch viel voneinander lernen – wenn wir unsere Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu schätzen wissen und die Reichhaltigkeit unserer Diversität feiern.“
Sprach`s und unterzeichnete zusammen mit Mapuche-VertreterInnen einen „Pakt für den bürgerlichen Respekt“, ein Schriftstück, das die „historische Schuld an der Urbevölkerung“ anerkennt und zu Frieden, Dialog, Respekt und Nichtdiskriminierung aufruft. Gleichzeitig kündigte er einen kommenden Geldsegen für die vernachlässigten indigenen Gemeinden im Süden des Landes an. Rund 140 Milliarden chilenische Pesos, also 500 Millionen DM, sollen bis Ende des Jahres 2002 in Projekte investiert werden, die mehr oder weniger direkt den Mapuche zugute kommen: Infrastrukturmaßnahmen, landwirtschaftliche Förderprogramme, Leistungen für indigene Gemeindezentren und vieles mehr.
Frei-Regierung unter Handlungsdruck
In das harmonische Zusammenspiel zwischen Regierung und Mapuches, das Frei mit Sinn fürs Symbolische hatte arrangieren lassen, mischten sich allerdings auch ungeliebte Mißtöne: Weder die großen autonomen Indígena-Organisationen noch die chilenischen Unternehmerverbände waren am „Pacto“ beteiligt. Erstere, weil sie schlichtweg nicht eingeladen worden waren, letztere, weil sie sich nicht an einem Deal beteiligen wollten, bei dem sie ihre Interessen nicht gewahrt sehen. „Es gibt nur einen Pakt, der das gesellschaftliche Leben in Chile regelt, und das ist die Verfassung“, distanzierte sich Felipe Lamarca, der Präsident des größten Unternehmerverbandes Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) vom Ansinnen der Regierungsparteien, und sein Kollege Juan Eduardo Correa, der stellvertretende Vorsitzende des Verbandes der Holz- und Zellulosewirtschaft (Corma) legte noch einen drauf: „In dem Konflikt, der hier beigelegt werden soll, betrachten sich die Regierung und die Mapuche als Protagonisten. Unsere Unternehmen sind dabei nur die Opfer der herrschenden Gewalt.“
Daß der chilenische Staat seine Indígenas auch einmal hofiert und ihnen ein pralles Subventions-Füllhorn zumindest verspricht, ist durchaus strategisch motiviert. Eduardo Frei und seine christlich-sozialdemokratische Allianz stehen unter enormem Handlungsdruck, seit das Thema „Indígena-Konflikt“ in den Wintermonaten die Schlagzeilen und Nachrichtensendungen eroberte und zeitweilig mit dem „Fall Pinochet“ konkurrierte. Nach Jahren der enttäuschten Hoffnungen auf einen echten Politikwandel, der mit dem Übergang zur Demokratie angekündigt worden war, hatten etliche regionale Zusammenschlüsse von Mapuche-Gemeinden damit begonnen, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen: Gruppen in einer Stärke zwischen 20 und 200 AktivistInnen „besetzten“ Grundstücke, die teils dem Staat, teils privaten Eignern, vor allem aber den großen Forstunternehmen gehören. Die verfügen im Süden Chiles inzwischen über riesige Flächen, holzen dort die noch vorhandenen Reste des ursprünglichen Waldes ab und legen schnellwachsende Eukalyptus- und Fichtenmonokulturen an. Die Mapuche-Gemeinden – allein in der Region Araucanía sind es 1500 mit über 250.000 Mitgliedern – sehen sich inzwischen regelrecht von den Holzplantagen eingekreist. Eine Mischnutzung dieser Forste ist praktisch unmöglich: sie sind lückenlos umzäunt und bieten ohnehin keine Subsistenzgrundlage mehr wie die noch verbliebenen Araukarienwälder, deren Früchte, die piñones, einst eine wichtige Ernährungsgrundlage für die Indígenas darstellten.
Eigentlich hatte bereits die erste demokratisch gewählte Regierung nach Pinochet unter dem Christdemokraten Patricio Aylwin eine Behörde geschaffen, die unter anderem für die „Rückgabe“ von Gebieten zuständig ist, auf die die Mapuche unter Verweis auf jahrtausendealtes Gewohnheitsrecht Anspruch erheben. Die CONADI (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena), die durch das „ley indígena“, das 1994 in Kraft getretene Indígena-Gesetz, geschaffen wurde, soll als Wiedergutmachung der unter Pinochet durchgeführten Privatisierung des kommunitären Mapuche-Landes Rückkäufe tätigen und den Gemeinden Grund und Boden für ihre wirtschaftliche Absicherung und den Erhalt ihrer Kultur übergeben. Dies ist auch durchaus geschehen – die Mapuche-Organisationen sind aber der Ansicht, daß der Umfang der Landrückgabe nicht im entferntesten ihren Bedürfnissen entspricht.
Spätestens seitdem der damalige Leiter der CONADI, der Mapuche Mauricio Huenchulaf Anfang 1997 geschaßt und durch den nicht-indigenen Rodrigo González ersetzt wurde, betrachtet eine wachsende Zahl von Mapuche-Organisationen die Behörde ohnehin eher als Gegnerin denn als Verbündete. Huenchulaf hatte offen gegen das Staudammprojekt Ralco des größten chilenischen Stromerzeugers ENDESA im Biobío-Tal protestiert, für das über 100 Pehuenche-Familien zwangsumgesiedelt werden sollen.
Von April bis Juli kam es in den Regionen Biobío, Araucanía und Los Lagos wiederholt zu Besetzungen von Grundstücken, die nicht immer gewaltlos vonstatten gingen: Maschinen und Verwaltungsgebäude wurden zerstört, Straßen mit gefällten Bäumen blokkiert, Brände in Schonungen gelegt. Etliche Forstarbeiter mußten stellvertretend für ihre Arbeitgeber, die riesigen Holz- und Zelluloseunternehmen wie Forestal Mininco oder Bosques Arauco, Prügel einstecken. Nach anfänglicher Zurückhaltung setzte dann die ebenso gewaltsame Repression ein: Bei den Räumungen der besetzten Grundstücke wurden insgesamt mehrere hundert Mapuche festgenommen, gegen einige sind Prozesse wegen Landfriedensbruch anhängig.
Es gab auch friedlichere Protestformen: Fast vier Wochen war ein Marsch von Mapuche-AktivistInnen von der über 700 Kilometer entfernten Regionalhauptstadt Temuco nach Santiago unterwegs, um dort auf die prekäre Situation ihres Volkes aufmerksam zu machen. Mehrere tausend Menschen nahmen zum Abschluß an einem nguillatún, einer magischen Mapuche-Zeremonie im Herzen der Metropole, teil.
Spaltung der Indígena-Bewegung
Es war jedoch nicht nur dieser Druck, der die Regierung zu Zugeständnissen bewegte. Ein Ziel des angekündigten Maßnahmenpakets dürfte auch sein, einen weiteren Keil in die ohnehin schon gespaltene autonome Indígena-Bewegung jenseits der offiziösen CONADI zu treiben. Die Trennlinie verläuft zwischen den BefürworterInnen einer Verhandlungsstrategie und der Minderheit, die jede Kooperation mit dem Staat ablehnt. So unterstützten zwar die Organisationen Consejo de Todas las Tierras (Rat aller Erden) und Entidad Territorial Lafquenche (Territoriale Einheit Lafquenche), die zusammen mehr als 120 Mapuche-Gemeinden repräsentieren, die Besetzungen, sie erklärten sich jedoch nach einem Dialogangebot der Regierung gesprächsbereit und forderten ihre Mitglieder auf, die umstrittenen Aktionen vorerst beizulegen.
Im Gegensatz dazu sprach sich die dritte größere Vereinigung, die Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco (Koordination der Mapuche Auraco-Malleco), für „alle denkbaren Formen des Kampfes“ aus und wollte nicht ausschließen, daß einige ihrer Mitglieder in Zukunft in den Untergrund gingen. „Unsere Bewegung sieht sich in direkter Konfrontation mit dem Staat und der transnationalen Wirtschaft“, heißt es in einer Verlautbarung der Coordinadora, „unser Ziel ist die Wiedererlangung von Grund und Boden,die Schaffung von autonomen Gebieten. Wir halten nichts von Gesprächen, die die Regierung ohnehin bis zu den nächsten Wahlen hinauszögern wird.“
Autonomie für die Mapuche-Gebiete fordern auch die anderen beiden Organisationen, sie sind aber weitaus vorsichtiger mit der Definition des Begriffes; eine rechtliche Eigenständigkeit jenseits der kulturellen Autonomie fordern sie realistischerweise nicht.
Innenminister Raúl Troncoso brachte die Sicht der Regierung auf den Punkt: „Die gewaltsamen Besetzungen sind das Produkt einer Konkurrenzsituation der unterschiedlichen Organisationen, die jeweils einen Führungsanspruch in den betroffenen Provinzen erheben.“ Darin sehen er und seine Kollegen letztlich die Chance, die lachenden Dritten zu sein und das angeschlagene Prestige der CONADI bei der indigenen Bevölkerung wieder zu flicken.
Im August flackerten freilich erneut Unruhen in einigen Gebieten auf. So reibungslos, wie es sich die Frei-Administration wünscht, wird der Konflikt nicht beizulegen sein. Insbesondere, weil nach den Jahren der politischen und kulturellen Repression unter Pinochet und den schleppenden Fördermaßnahmen der beiden demokratischen Regierungen seit 1990 die Mapuche sich zunehmend ihrer widerstandsfreudigen Geschichte entsinnen und sich teilweise offensiv gegen den Integrationsgedanken wehren. Der Vergleich mit Chiapas bietet sich an; Aldolfo Millabur, der Vorsitzende der Identidad Territorial Lafquenche und einziger Mapuche-Bürgermeister Chiles zieht eine vielleicht überraschendere Parallele. „Die chilenische Geschichtsschreibung verleugnet das Schicksal der Mapuche bei der Entstehung der chilenischen Gesellschaft. Sie spricht von der im letzten Jahrhundert vollzogenen „Befriedung“ der indigenen Gebiete, als ob es damals ein freundschaftliches Zusammentreffen gegeben hätte. In Wirklichkeit war es eine grausame Schlächterei an unserem Volk, genau wie die ‘ethnischen Säuberungen’, die jetzt die Serben an den Albanern vollzogen haben. Die pacificación war unser Kosovo.“