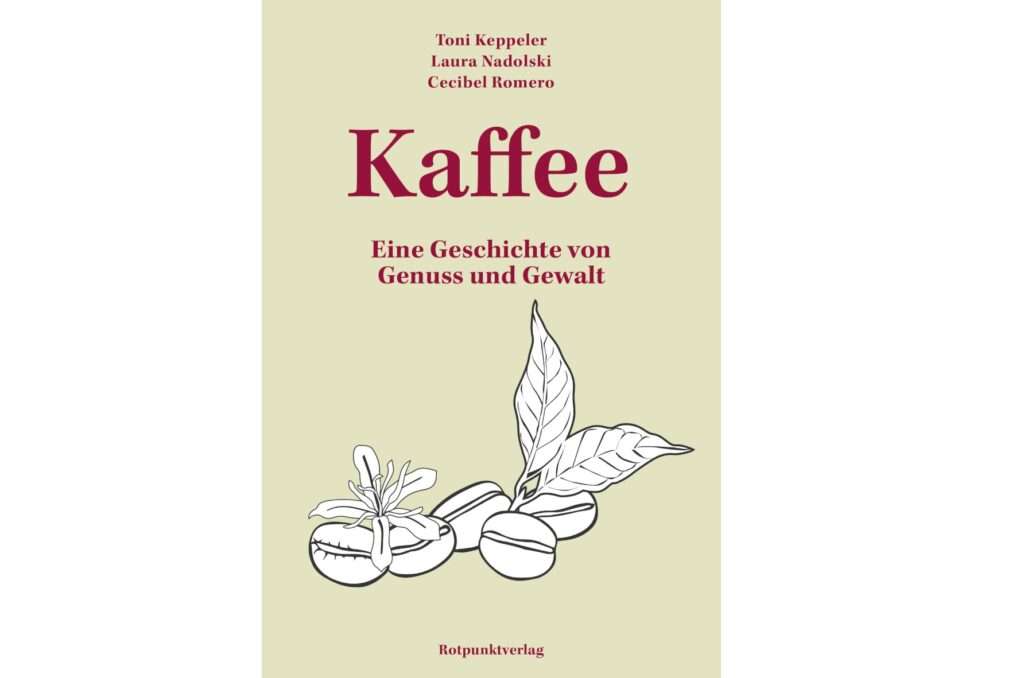
„Kaffee ist eine psychoaktive Droge. Muntert auf, macht wach und agil und verbessert die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit – die ideale Droge für eine moderne Industriegesellschaft.“ Der Journalist Toni Keppeler, Klima- und Umweltwissenschaftlerin Laura Nadolski und Kaffeesommelière und Journalistin Cecibel Romero tragen in dem Buch Kaffee – eine Geschichte von Genuss und Gewalt ihr umfassendes Wissen zusammen und erzählen die schockierende Geschichte des Kaffees. Sie versammeln Fakten, Historie, Sagen und Anekdoten aus Anbau, Verarbeitung und Handel bis hin zu Zubereitungsmöglichkeiten, Sorten und Arten des Kaffees.
Die brutalen, kolonialen Zustände, die der Kaffeeanbau durch die Geschichte bis heute mit sich zieht, wie die Produktion der Bohne zum Klimawandel beigetragen hat und warum sie nun von ihm bedroht ist, werden detailliert beschrieben. „Kaffee war, nachdem er seine Ursprüngliche Region in Afrika verlassen hatte, eine Kolonialware. Für ihn wurden Menschen versklavt und massakriert, für ihn wurden Verbrechen an der Umwelt begangen. Das Getränk steht noch immer in dieser Tradition. Kaffee wird auf Armut aufgebaut.“ Heute ist Kaffee eine klassische neokoloniale Ware – die armen Länder produzieren unter untragbaren sozialen und ökologischen Bedingungen einen Rohstoff, der in reichen Ländern veredelt und genossen wird.
Die wissenschaftlichen Aspekte werden gut verständlich erklärt und durch Abbildungen unterstrichen, geschichtliche Vorkommnisse stets in Bezug zum politischen Weltgeschehen gesetzt. Anekdoten, wie zum Beispiel über den teuersten Kaffee der Welt, werden mit ironischem Unterton erzählt und lösen ab und zu ein zynisches Schmunzeln bei den Leser*innen aus. Die Beschreibungen der Umweltfrevel und sozialen Missstände sind nicht ausufernd aufgelistet, sondern führen in kompakter Weise vor Augen, was der Kapitalismus anrichtet. Durch die teilweise szenische Beschreibung, zum Beispiel der Kaffeeverkostung, bekommt das Buch den Charakter einer spannenden Reportage.
Die verschiedenen Hintergründe der Autor*innen ergeben dabei differenzierte Perspektiven, die sich gegenseitig ergänzen. Sie lassen die Leser*innen aber auch nicht hoffnungslos stehen, sondern geben konkrete Tipps, umwelt- und sozialverträglichen Kaffee zu produzieren und zu konsumieren. Jede*r die*der gerne Kaffee trinkt, sollte dieses Buch gelesen haben und bewusst mit dem umgehen, was alles an unserem täglichen Kaffeekonsum hängt.








