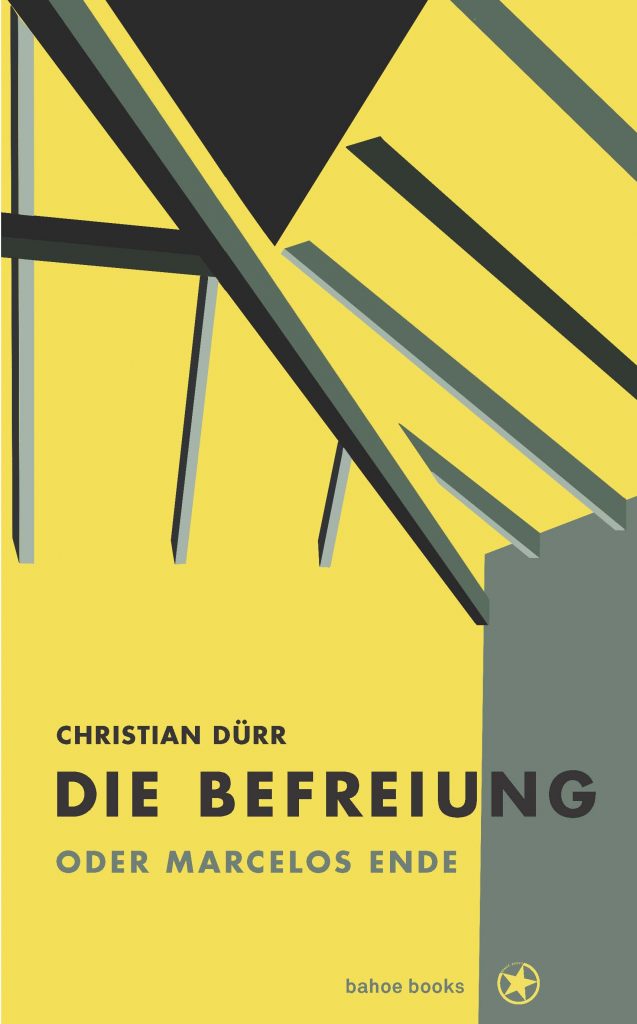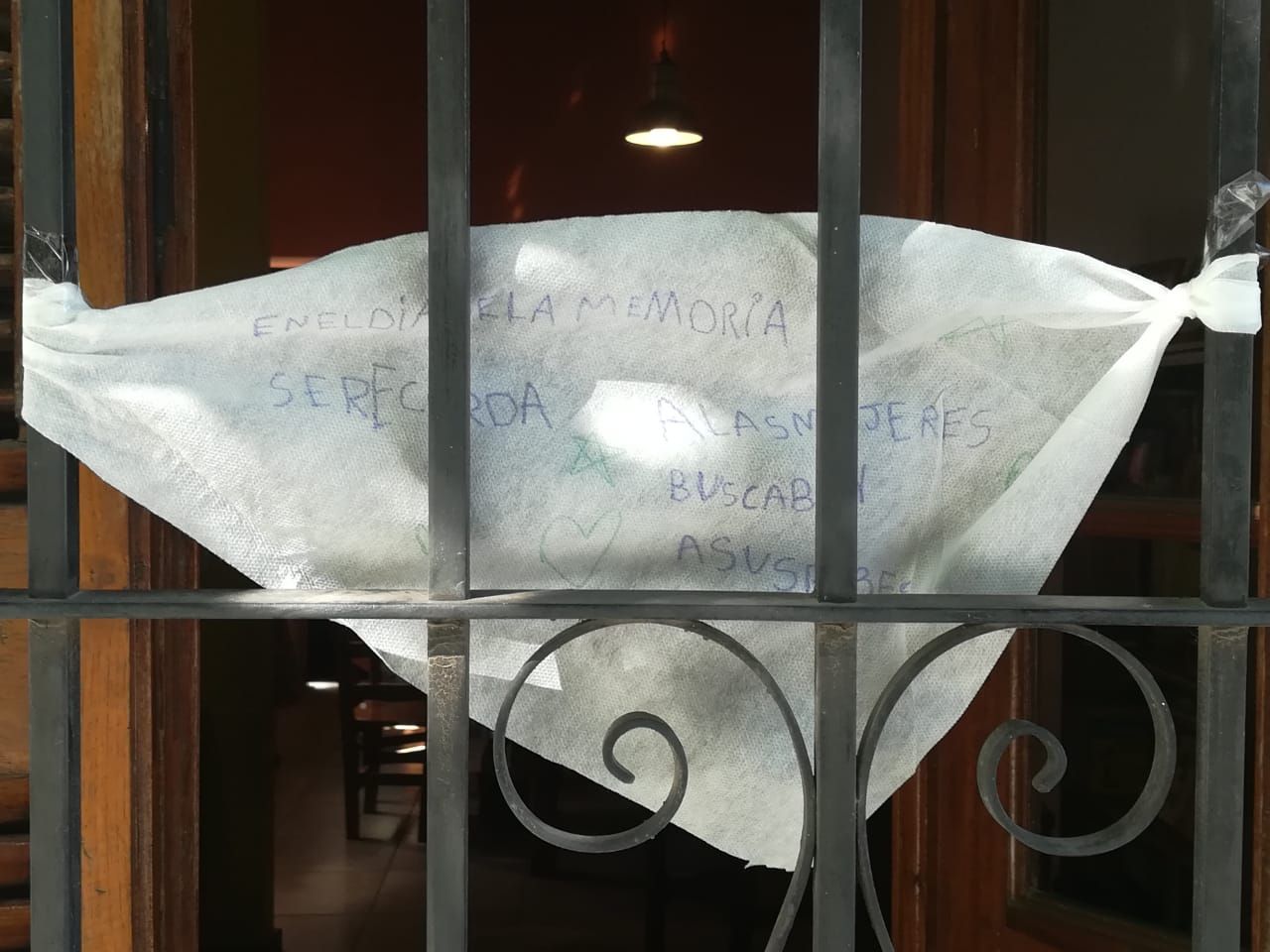Notenpresse läuft auf Hochtouren Argentiniens Zentralbank (Foto: bennylope, Gemeinfrei / Wikimedia Commons)
„Wir liegen auf der Intensivstation!“ Argentiniens Mitte-links-Präsident Alberto Fernández sagte dies bereits Anfang Februar bei seiner Deutschlandvisite, als die Covid-19-Pandemie in Argentinien noch kein Thema war. Die argentinische Wirtschaft steckte schon damals tief in einer Rezession. Fernández war auf Europatour, um für internationale Unterstützung für die Umschuldung der Verbindlichkeiten Argentiniens zu werben. Die neoliberale Vorgängerregierung von Mauricio Macri hatte Fernández im Dezember 2019 ein schweres Erbe hinterlassen: In vier Jahren hatte sie die Auslandsschulden um mehr als 100 Milliarden Dollar auf 323 Milliarden Dollar hochgetrieben. Selbst der Internationale Währungsfonds (IWF) hat diese Schuldenlast im Frühjahr 2020 für nicht tragfähig erklärt. Ebendieser IWF hatte Macri auf Betreiben von US-Präsident Donald Trump noch 2018 einen Rekordkredit von 57 Milliarden Dollar gewährt. So sollte Macri Vertrauen bei der argentinischen Bevölkerung für die Präsidentschaftswahlen 2019 verschafft werden. Macri wurde trotzdem abgewählt, die Schulden aber blieben.
Die Neuverhandlung der Staatsschulden sollte eigentlich bis Ende März dieses Jahres abgeschlossen werden. Die Covid-19-Pandemie hat das verhindert. Ende Mai hatte Argentinien Zinsforderungen in Höhe von 503 Millionen US-Dollar nicht beglichen und war dadurch in einen begrenzten Zahlungsausfall gerutscht.
Seit dem 20. März ist Argentinien in Quarantäne. Am 28. August verlängerte Alberto Fernández die Maßnahmen gegen die Pandemie erneut bis zum 20. September. “Die Pandemie hat uns eingeschlossen, und wir mussten gleichzeitig mit etwa 30 Fonds über Zoom verhandeln”, schilderte Wirtschaftsminister Martín Guzmán das komplexe Szenario. Bis Ende März war es vollkommen unmöglich, unter diesen Umständen zu einer Einigung zu kommen. Die Frist wurde ein ums andere Mal verlängert, zuletzt bis zum 28. August. Deswegen kam die Nachricht in der Nacht vom 3. auf den 4. August völlig überraschend: Es gebe eine Einigung im Grundsatz, der die unterschiedlichen Gläubigergruppen bis zum 28. August ihr Plazet geben müssten. Das verkündete Wirtschaftsminister Guzmán vor der Presse. Die Regierung und ausländische Privatgläubiger hätten sich darauf geeinigt, eine Schuld von mehr als 65 Milliarden Dollar umzuschulden, um aus der Zahlungsunfähigkeit herauszukommen. “Jetzt haben wir einen klaren Zeithorizont”, verkündete Präsident Fernández. Auf 30 Milliarden Dollar weniger Schuldendienst in den kommenden zehn Jahren bezifferte er das Entgegenkommen der Gläubigerfonds.
Selbst sein Vorgänger Mauricio Macri, der in Frankreich Urlaub machte, äußerte sich positiv. “Wir haben es zu Ende gebracht”, sagte er gegenüber dem Portal Infobae und verwies auf den langen Prozess. Luis Caputo, der unter Macri Finanzminister und Präsident der Zentralbank war, sprach von einer “großen Übereinstimmung” und sandte “Glückwünsche” an den Präsidenten, Minister Guzmán und “alle Beteiligten”. Soviel Einigkeit zwischen Regierung und Opposition ist in Argentinien selten, wenn man vom weitgehenden Konsens in der Bekämpfung von Covid-19 absieht.
93,5 Prozent der Gläubiger*innen haben das Angebot der argentinischen Regierung bis Ende August angenommen. Bei Lichte betrachtet hat Argentiniens Regierung wohl herausverhandelt, was in der jetzigen Lage möglich war. Eine harte Haltung wie sie die Regierung von Néstor Kirchner ab 2003 bei den Verhandlungen an den Tag legte – Alberto Fernández nahm damals als Kabinettsleiter teil – konnte sich die Regierung dieses Mal wegen der Pandemie nicht leisten. Kirchner war seinerzeit als »Insolvenzverwalter« tätig, nachdem Argentinien 2001 zum achten Mal in der Landesgeschichte zahlungsunfähig geworden war. Als er zwei Jahre später sein Amt als Präsident antrat, bot er 2005 und 2010 nach dem sonst nur vom IWF bekannten Mottos »Friss oder stirb« den privaten Anleger*innen an, entweder auf 75 Prozent ihrer Forderungen zu verzichten oder ganz leer auszugehen. 93 Prozent nahmen zähneknirschend an. Der Rest klagte in New York, wo die argentinischen Dollar-Staatsanleihen ausgegeben worden waren, um Investor*innen mit Rechtssicherheit zu locken. Die Kläger*innen wurden von der Regierung Macri 2016 schließlich großzügig belohnt: An vier Fonds wurde insgesamt 4,65 Milliarden Dollar gezahlt, 75 Prozent der ursprünglich geforderten Summe und damit 50 Prozentpunkte mehr als an alle anderen.
2020 ging Argentiniens Regierung unter Guzmáns Verhandlungsleitung vorsichtiger vor. „Unser Angebot umfasst eine dreijährige tilgungsfreie Zeit, eine 5,5-prozentige Reduzierung des Anleihekapitals und eine 62-prozentige Reduzierung der Zinszahlungen. Es belässt den Gläubigern einen durchschnittlichen Anleihekupon von 2,3 Prozent gegenüber ihrem derzeitigen Durchschnittskupon von 7 Prozent, der angesichts des derzeitigen Zinsumfelds nicht niedrig ist. Kurz gesagt, wir verlangen von unseren Gläubigern nicht, dass sie verlieren, sondern dass sie weniger verdienen“, schrieb der politische Quereinsteiger in einem Gastbeitrag der Financial Times. Der 37-jährige Guzmán hatte vor seinem Wechsel in die Politik bis 2019 als Mitarbeiter des Wirtschaftsnobelpreisträgers Joseph E. Stiglitz an der Columbia University in den USA nach Lösungen für die Schuldenkrisen von Staaten geforscht. „Die Zeit der Illusionen ist vorbei. In der neuen Covid-19-Welt können wir nicht weiterhin 20 Prozent der Staatseinnahmen oder mehr für die Schuldentilgung ausgeben – wie es einige Gläubiger effektiv gefordert haben. Es ist einfach unmöglich“, hatte Guzmán in seinem Artikel die Forderung nach Umschuldung begründet.
Doch aus den ursprünglich von Buenos Aires geforderten 62 Prozent Forderungsverzicht sind dem Vernehmen nach nur 45 Prozent geworden. Und selbst das hört sich nach mehr an, als es ist – auf dem Sekundärmarkt werden argentinische Staatsanleihen unter 40 Cent pro Dollar gehandelt, sprich gut 60 Prozent unter dem Nominalwert.
Eine nachhaltige Lösung des Schuldenproblems ist das Ergebnis nicht
Wie ernst die Finanznöte der argentinischen Regierung sind, zeigte sich wenige Wochen nach der Einigung mit den privaten Gläubiger*innen. „Wir bitten um finanzielle Hilfe“, hieß es am 26. August in einem Schreiben von Wirtschaftsminister Guzmán und Notenbankchef Miguel Pesce an_IWF-Direktorin Kristalina Georgiewa. „Ohne einen wirtschaftlichen Wiederaufbau kann es keine Stabilisierung geben“, sagte Guzmán. Ziel des neuen Kredites und einer Zahlungsrestrukturierung sei, die Rückzahlung von 44 Milliarden US-Dollar zu ermöglichen, die Argentinien vor zwei Jahren vom IWF erhielt.
Dass ausgerechnet der IWF um Hilfe gebeten wird, sorgt für Erstaunen, hatte Fernández doch bei Amtsantritt im Dezember 2019 angekündigt, keinen zusätzlichen Cent aus dem 57-Milliarden-Dollar-Kredits seines Vorgängers Macris in Anspruch zu nehmen. Das war allerdings, bevor die Folgen der Pandemie die Wirtschaft zusätzlich massiv schädigten. “Die Arbeitslosigkeit und die Armut sind massiv angestiegen”, erklärt der Politanalyst Rosendo Fraga. Die Wirtschaft ist in freiem Fall, mehr als 42.000 kleine und mittlere Unternehmen mussten seit März schließen. Mindestens 300.000 Arbeiter*innen verloren seit dem Quarantänebeginn ihren formellen Job. Und das in einem Land, das sich schon seit 2018 im wirtschaftlichen Sturzflug befindet und mit der Umschuldung die neunte Staatspleite im letzten Moment noch verhindern konnte._Um mindestens zwölf Prozent wird die Wirtschaftsleistung nach bisherigen Prognosen 2020 einbrechen.
In der gegenwärtigen Rezession brechen die Steuer- und Exporteinnahmen ein, während die Staatsausgaben aufgrund der Coronakrise massiv steigen. Da der Zugang zum internationalen Kapitalmarkt wegen des Zahlungsstopps auf den Schuldendienst seit Mai blockiert ist, finanziert sich die Regierung über die einheimische Notenpresse rund um die Uhr: 1,3 Billionen Pesos (etwa 18 Milliarden Dollar zum offiziellen Wechselkurs) wurden 2020 schon gedruckt. Die Inflationsrate betrug zuletzt mehr als 50 Prozent. “Dies ist eine Notsituation, es gab keine Alternative”, sagt Guzmán. Bis jetzt wurde ein großer Teil dieser Geldmenge vom Markt durch den Kauf von Staatsanleihen in Pesos absorbiert. Reiche, anlagesuchende Argentinier*innen gibt es offenbar noch.
Vor dem Beginn der Verhandlungen zur Umschuldung sagte Guzmán: „Auf dem Spiel steht das wirtschaftliche Schicksal von 45 Millionen argentinischen Bürgern. Mehr als 35 Prozent unserer Bevölkerung und 52 Prozent der Kinder leben bereits in Armut. Keine demokratische Regierung kann noch mehr Härten auferlegen oder die Forderungen der Anleihegläubiger über eine Wirtschaftspolitik stellen, die darauf abzielt, die katastrophalen Auswirkungen der Pandemie zu lindern.“
Im Kern sind Guzmáns Aussagen immer noch richtig. Nur die Zahlen verschlechtern sich weiter drastisch. Bis zum Jahresende werden voraussichtlich sechs von zehn Argentinier*innen in Armut leben.