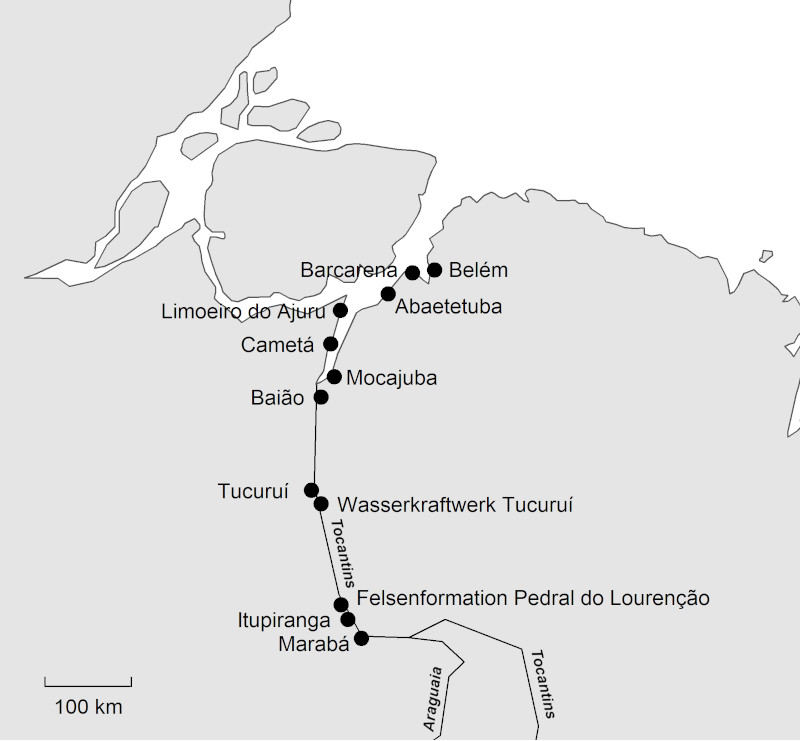Fakten lügen nicht Die politische, sexuelle und psychische Gewalt gegen Frauen hat in Brasilien zugenommen (Foto: Mohamed Hassan)
In den vergangenen Jahren hat Brasiliens Zivilgesellschaft die internationale Gemeinschaft unermüdlich vor der rasanten Zerstörung der brasilianischen Demokratie gewarnt. Da Brasilien eines der am stärksten von COVID-19 betroffenen Länder ist, hat sich die Zivilgesellschaft auf nationaler Ebene unermüdlich dafür eingesetzt, die politischen Entscheidungsträger*innen darauf aufmerksam zu machen, dass die drastischen Folgen der Pandemie – zum Beispiel die Auswirkungen auf das Gesundheitssystem – abgemildert werden könnten. Dafür hätte allerdings die eigene Bundesverfassung und das internationale Engagement, das Brasilien 2015 vorangetrieben hat und das in die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung mündete, respektiert werden müssen.
Leider wurden wir nicht gehört. Und obwohl wir als Zivilgesellschaft wissen, dass die Geschichte unsere Beharrlichkeit anerkennen wird, ist die Realität, dass Brasilien ein dekadentes Land geworden ist, dessen Führung sich weder um die Gegenwart, noch um die Zukunft der Menschen im Land kümmert. Traurigerweise nimmt die Gewalt immer weiter zu und die Ungleichheiten vertiefen sich in einem Ausmaß, das wir uns vor zehn Jahren nicht hätten vorstellen können. Die Folgen der Fehlentscheidungen der politischen Entscheidungsträger lassen sich in der sechsten Ausgabe des Spotlight Reports der Zivilgesellschaft über die Umsetzung der Agenda 2030 in Brasilien gut belegen. Verfasst wurde der Bericht von 101 Expert*innen aus den Bereichen Soziales, Wirtschaft und Umwelt. Er stützt sich auf offizielle Daten von Regierungsinstitutionen und Universitäten. Methodisch wird die nationale Politik anhand von 168 Zielen und rund 230 Indikatoren überprüft, die den brasilianischen Staat beim Schutz der Umwelt, der Förderung des Friedens und der Inklusion leiten sollen.
Die Ziele und Indikatoren wurden nach dem Grad ihrer Umsetzung kategorisiert und zeigen, dass die Ergebnisse alles andere als positiv sind: Brasilien hat nur bei einem der 168 analysierten Ziele zufriedenstellende Fortschritte erzielt. Bei 110 Zielen (65,47 Prozent) zeigten sich Rückschritte, bei 24 Zielen (14,28 Prozent) waren die Fortschritte unzureichend. 11 Ziele (6,54 Prozent) verblieben auf dem Vorjahresniveau oder stagnierten insgesamt, 14 Ziele (8,33 Prozent) sind gefährdet und zu 8 Zielen (4,76 Prozemt) liegen keine Daten vor. Im Vergleich zum Bericht von 2021 stieg die Zahl der Ziele, deren Umsetzung rückläufig ist, von 92 auf 110 und die der Ziele mit unzureichenden Fortschritten von 13 auf 24.
Bolsonaros Regierung war eine Katastrophe mit Ankündigung
Es gibt sicher keinen Zweifel an den begrenzten intellektuellen Fähigkeiten von Jair Bolsonaro, der nicht in der Lage ist, auch nur ein oberflächliches Gespräch mit führenden Politiker*innen der Welt zu führen. Die analysierten Daten zeigen jedoch, dass er bei der Erfüllung all seiner Wahlversprechen von 2018, die sich vor allem gegen die Rechte der Bevölkerung richten, ziemlich erfolgreich war. Taktisch hat er Allianzen mit rechtsextremen Gruppen, christlichen Pfingstkirchen, der Waffenindustrie und illegalen Extraktivist*innen geschlossen und damit dem organisierten Verbrechen mehr Raum gegeben. Durch die Bestechung politischer Parteien gelang es ihm, Gesetze zu verabschieden, die die zuvor eroberten Rechte wieder einschränkten. Er zerstörte Institutionen und Foren der gesellschaftlichen Partizipation und machte Menschenrechtsverteidi-gerinnen, Nichtregierungsorganisationen und Indigene zu Staatsfeinden.
Während er Budgets, öffentliche Dienstleistungen und Kontrollinstrumente zerstörte, hat Bolsonaro erfolgreich auf einen manichäischen populistischen Diskurs („wir gegen sie“) gesetzt, der typisch für Faschist*innen ist. Damit hat er Sexismus, Rassismus und LGBTI-Phobie in einem Land, das bereits durch Sklaverei und Machismus traumatisiert ist, noch verstärkt. Fakten lügen nicht: Die Zahl der Feminizide an Transgender-Frauen hat im Jahr 2021 zugenommen, ebenso wie die politische, sexuelle und psychische Gewalt, die selbst Frauen im Parlament betrifft. Nach Angaben von UN-Women haben 82 Prozent der brasilianischen Politikerinnen psychische Gewalt erlitten, 45 Prozent wurden bedroht, 25 Prozent wurden im Parlament körperlich angegriffen und 20 Prozent wurden sexuell belästigt. Brasilien liegt heute bei der Beteiligung von Frauen in den Parlamenten auf Platz 143 von 188 Ländern (2015 war es noch Platz 115) und in der Bundesregierung sind nur 8,7 Prozent der Minister*innen Frauen.
Die Regierung spricht sich offen gegen sexuelle und reproduktive Rechte und Gendergerechtigkeit aus, so dass die Sexualerziehung aus dem Nationalen Gemeinsamen Basislehrplan (BNCC) gestrichen wurde. Nur 3 von 26 Bundesstaaten empfehlen den Schulen, Unterricht über Sexualität, Genderfragen, Prävention von Teenagerschwangerschaften und Gewalt anzubieten. Selbst die Bekämpfung von HIV und Aids, in der Brasilien ein internationales Vorbild war, wurde deutlich geschwächt, da die Mittel für Präventionskampagnen in alarmierender Weise gekürzt wurden. Betrug das Budget für HIV/AIDS-Prävention 2015 noch 20,1 Millionen brasilianische Reais, sank es 2020, im zweiten Jahr der Amtszeit von Jair Bolsonaro, auf 3,9 Millionen Reais. 2021 waren es nur noch rund 100.000 Reais.
Die Regierung Bolsonaro war eine angekündigte Katastrophe, aber die Ergebnisse sind deutlich schlimmer, als von der Zivilgesellschaft erwartet. Denn es bestand noch die Hoffnung, dass die demokratischen Institutionen bei der Erfüllung ihres Mandats der Exekutive die richtigen Grenzen setzen würden – was nicht geschah. Und so erscheint Brasilien 2022 erneut auf der Welthungerkarte: Die Anzahl der Hungernden stieg von 19,1 Millionen im Jahr 2020 auf 33,1 Millionen im Jahr 2021; insgesamt 125,2 Millionen Menschen leben in einem gewissen Grad von Ernährungsunsicherheit. Das ist mehr als jede*r Zweite im Land.
Brasilien erwartet die gewalttätigsten Wahlen seiner Geschichte
Bei einer Arbeitslosenquote von 11,2 Prozent fehlt es an wirksamen Maßnahmen, um Arbeitsplätze und Einkommen zu schaffen. Die Agrarreform wurde ausgesetzt und die Zahl der Konflikte auf dem Land ist bis 2021 um 1.100 Prozent gestiegen, während das räuberische Agrobusiness weiter vorrückt und das Leben der Indigenen und Quilombolas zerstört. Das brasilianische Entwicklungsmodell setzt grundsätzlich auf den Primärsektor und ist von geringer Dynamik und hoher Umweltzerstörung gekennzeichnet. Doch die Situation ist außer Kontrolle geraten: Die Entwaldung war im Jahr 2021 um 79 Prozent höher als im Jahr 2020 und erreichte 20 Prozent der Gesamtfläche des Amazonasgebiets, während sie im Trockenwald Cerrado um acht Prozent (8.531 km2) zunahm. Zwischen 2019 und 2021 gingen in den Schutzgebieten 130 Prozent mehr Waldfläche verloren als in den drei Jahren zuvor, und in den indigenen Gebieten war die Entwaldung um 138 Prozent höher.
Das Wirtschaftsteam der Regierung Bolsonaro ist nachweislich inkompetent und theoretisch nicht auf dem neusten Stand, so dass es – selbst wenn es wollte, was nicht der Fall ist – nicht wüsste, wie es mit der schwierigen ökonomischen Situation in Brasilien umgehen soll. Durch seine Arbeit stieg die Inflation, die Preise für Treibstoff, Energie und die Lebenshaltungskosten. Das führte zu einem sprunghaften Anstieg der Anzahl der auf der Straße lebenden Menschen. Die jüngste Volkszählung in der reichen Stadt São Paulo hat ergeben, dass die Zahl der Obdachlosen in den vergangenen zwei Jahren um 31 Prozent gestiegen ist und sich überwiegend aus Frauen, Kindern und ganzen Familien zusammensetzt. Bolsonaro verfolgt jedoch weiter strukturpolitische Maßnahmen, und hat erst vor wenigen Wochen, mit Blick auf die Wahlen, mehr Mittel für soziale Hilfsleistungen bewilligt.
Bei all diesen deprimierenden Kennzahlen zeigt der Spotlight Report aber auch, dass es Lösungen gibt. Die 116 Empfehlungen zeigen, dass es möglich ist, unsere Rechte wieder in den öffentlichen Haushalt aufzunehmen und den Boden zurückzugewinnen, den wir durch Gewalt, Hunger, Armut, Rassismus und geschlechtsspezifische Ungleichheiten verloren haben, die das heutige Brasilien kennzeichnen. Wir müssen unbedingt unsere Kultur der Privilegien beenden. Dazu ist es dringend erforderlich, die Arbeits- und Sozialversicherungsreformen der vergangenen Jahre zu revidieren, und die Gesetze wieder abzuschaffen, die öffentliche Investitionen in Gesundheit, Bildung und andere wichtige Bereiche verhindern. Zum Beispiel die Verfassungsänderung EC 95 der Regierung von Michel Temer, die von den Vereinten Nationen als die weltweit drastischste wirtschaftliche Maßnahme gegen soziale Rechte angesehen wird. Wir brauchen eine Steuerreform, über die effiziente und menschenrechtsorientierte Projekte gefördert werden. Schließlich müssen wir die Steuervermeidung und -hinterziehung sowie die öffentliche Finanzierung von Unternehmen, die nicht auf eine nachhaltige Entwicklung hinarbeiten, beenden. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen werden wir nicht aufgeben, bis diese Regierung und ihre Kumpane im Parlament für ihre Verbrechen vor Gericht gestellt werden. Dafür müssen die Kapazitäten der Zivilgesellschaft und der demokratischen Institutionen gestärkt werden, auch durch eine größere Unterstützung durch die internationale Gemeinschaft.