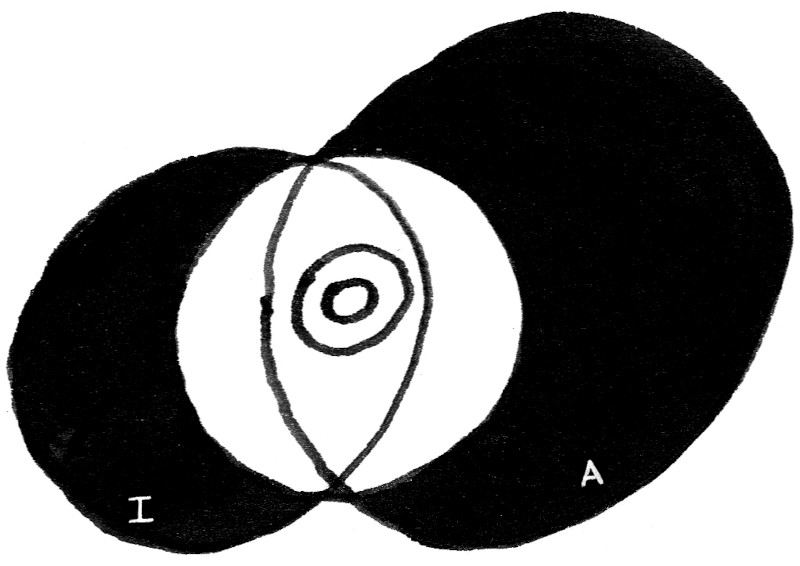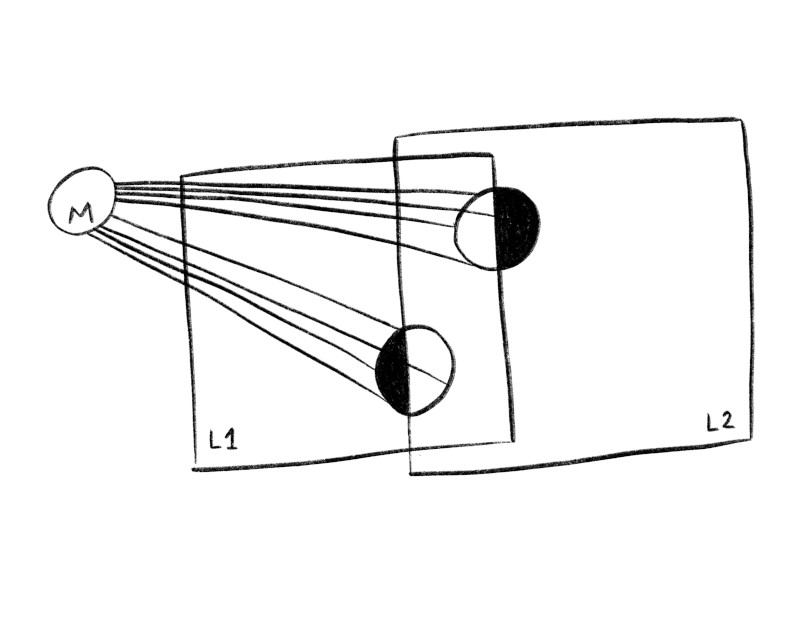Musiker im Exil Luis Enrique Mejía Godoy und Jandir Rodríguez beim Konzert in Berlin (Foto: Michelle Obando)
Wie kamen Sie auf die Idee, diese Konzertreise gemeinsam anzutreten?
Luis Enrique: Wir beide sind Künstler zwei verschiedener Generationen, aber uns eint der Kampf für die Zukunft Nicaraguas, für Meinungsfreiheit, für Frieden, für Demokratie und Menschenrechte. Weder Jandir noch ich gehören einer politischen Partei oder einer politischen Organisation an. Wir engagieren uns für die Einheit aller Nicaraguaner im Kampf gegen die Diktatur Ortega-Murillo. Jandir kann erzählen, warum wir uns zusammengetan haben, denn es war seine Initiative.
Jandir: Die Initiative entstand aus der vorangegangenen Europatournee, die ich unternommen hatte, und des Nicaragua-Vereins in Sevilla. Und meinem Traum von einem gemeinsamen Konzert mit Luís, da wir beide den Kampf für Menschenrechte mit unseren Liedern teilen. Wir beschlossen, unser Repertoire zu vereinen und den Nicaraguanern ein Lied der Hoffnung zu bringen und zur Solidarität in den Ländern aufzurufen, die wir derzeit besuchen.
Während der Sandinistischen Revolution in den 1980er Jahren waren Sie, Luís, und ihr Bruder Carlos international berühmt. „Ay Nicaragua, Nicaragüita“, geschrieben von Carlos, wurde zu einer Art Hymne der Revolution. Wie denken Sie heute über diese Zeit?
Luis Enrique: Die sandinistische Revolution kann man nicht vergessen. Sie ist ein wichtiges historisches Ereignis, nicht nur in Nicaragua und Lateinamerika. Der Kampf gegen die Somoza-Diktatur bewegte die Welt. Das ist eine Tatsache. Die 1980er Jahre waren Jahre des Kampfes für die Errichtung eines Traums, der durch einen Kampf im Innern unterbrochen wurde, woran die US-Regierung und die russische Regierung großen Anteil hatten. In gewisser Weise wurden wir Opfer des Kalten Krieges. Die 1990er kamen, die Sandinistische Nationale Befreiungsfront (FSLN) verlor die Wahlen. Für mich ist damit ein historisches Jahrhundert zu Ende gegangen, die Revolution hatte es bereits besiegelt.
Jetzt müssen wir neu darüber nachdenken, wie wir die Demokratie unter anderen Bedingungen aufbauen können. Heute machen sich die jungen Leute andere Gedanken, jetzt sind sie es − im Jahr 1979 (Jahr des Sieges der Revolution, Anm. d. Red.) waren wir es −, die das Sagen haben. Es sind immer die jungen Menschen, die diese Kräfte besitzen. Worin besteht der Unterschied? Damals war es ein bewaffneter Kampf, heute ist es eine Bürgerbewegung.
Vor Kurzem haben Sie das Lied „Nicamigrante soy“ geschrieben. Man könnte sagen, dass es eine Hommage an die Hunderttausenden Exil-Nicaraguaner*innen ist, die verstreut über viele Länder leben. Welches waren Ihre Beweggründe für das Komponieren dieses Liedes?
Luis Enrique: Ja, ich wollte ein Lied machen, das von meiner eigenen Erfahrung als Migrant, als Exilant und von den Tausenden von Nicaraguanern auf der ganzen Welt spricht. Allein in Costa Rica sind seit 2018 180.000 Flüchtlinge unter sehr schwierigen Bedingungen eingereist. Die meisten von ihnen sind junge Menschen zwischen 18 und 35 Jahren. Ihr Studium wurde unterbrochen, ihre Studienunterlagen weggeworfen, aus dem Computer gelöscht, und ihnen damit ihre Zukunft versperrt. Nicht allein, dass man sie in Nicaragua nicht haben will, sondern man will, dass sie Schwierigkeiten haben, wo immer sie sind. Es gibt viele junge Menschen, die bei Null anfangen: ohne Arbeit, ohne Studium, mit psychologisch sehr komplizierten Traumata, mit Kriegsverletzungen, aus dem Gefängnis entlassen, gefoltert. Deshalb wollte ich ein Lied der Hoffnung für die Migranten schreiben, wo immer sie sind, und ihnen sagen, dass wir eines Tages in ein freies Nicaragua zurückkehren können. Es ist außerdem ein fröhliches Lied, nicht triumphalistisch, sondern kämpferisch.
Mittlerweile leben alle Künstler*innen, die die nicaraguanische Kulturszene ausmachten, im erzwungenen Exil. Welcher war der auslösende Moment, der Sie die Entscheidung treffen ließ, Nicaragua zu verlassen?
Luis Enrique: Wie mein Bruder Carlos beschloss ich, im August 2018 zu gehen − nachdem wir bereits ein Dutzend Lieder für diesen Kampf geschrieben hatten, in Solidarität mit den Müttern, mit den politischen Gefangenen, mit den ersten Exilanten, den ersten Verfolgten, Drangsalierten und den ersten Toten natürlich. Das erste Lied, das ich geschrieben habe, heißt „Mi patria me duele en abril” (Mein Heimatland schmerzt mich im April). Etwa 15 Tage später − es gab bereits 40 Tote − wusste niemand, ob es 100, 200 oder 300 sein würden. Aber ich wusste, dass wir vor einer neuen, schrecklichen Situation stehen, in der der Tod wieder allgegenwärtig ist. Damit nahm Daniel Ortega die Maske ab, um auf diese Art zu sagen: „Ich gehe hier nicht weg, ich habe die Waffen.”
Sämtliche Institutionen stehen unter dem Kommando von Ortega und Murillo. Es gibt keine Meinungsfreiheit. Sie haben die Printmedien, das Fernsehen und den Rundfunk geschlossen und Journalisten, Sportreporter, Intellektuelle, Lehrer, Bauern und Studenten inhaftiert. Damit wurden unsere Hoffnung und die Perspektive eines Machtwechsels in Nicaragua zunichte gemacht.
Sie, Luis, leben im Exil in Costa Rica. Schon während der Somoza-Diktatur haben Sie dort gelebt, bis 1979 die Revolution siegte. Was bedeutet dieses neuerliche Exil für Ihr künstlerisches Schaffen?
Luis Enrique: Mein erstes Exil in Costa Rica war, als ich 20 Jahre alt war, heute bin ich fast 78. Es ist also viel schwieriger, fast bei Null anzufangen. Ich bin Künstler und autark in dem Sinne, dass ich meine Gitarre und meine Stimme habe. Das ist es, was ich brauche. Ich hielt es für sinnvoller, Nicaragua zu verlassen und in Costa Rica zu sein, um in irgendeiner Weise zur Solidarität und zur Einheit im Kampf gegen die Diktatur beizutragen.
Das Lied ist ein Instrument der Solidarität, des Friedens, des Aufrufs, der Anklage. Auch Liebeslieder sind das. Ich schreibe schon seit 55 Jahren Lieder und bin mit Jandir darüber einig, dass es sich bei ihm um einen neuen Ausdruck handelt. Der Unterschied liegt im Einsatz der Technologie, doch das Bewusstsein, das Herzblut sind dasselbe, der Patriotismus ist derselbe, die Liebe zu Nicaragua − und unsere Absicht, die Poesie zu verteidigen in einer Situation, die uns zwingt, die Diktatur anzuprangern.
Die politischen Gefangenen sind heute mehr denn je ein authentisches Beispiel für nicaraguanische Vaterlandsliebe. In vielen Ländern der Welt weiß man nicht, dass sie im Hungerstreik sind, vor allem die Frauen sind isoliert: es gibt keine Bücher, sie bekommen keine Medikamente, kein Trinkwasser. Ortega-Murillo haben internationales Recht, die Menschenrechte, die OAS (Organisation Amerikanischer Staaten), die Vereinten Nationen und alle demokratischen Regierungen zum Gespött gemacht. Wenn Gabriel Boric aus Chile Kritik äußert, antwortet Daniel Ortega sofort mit dem Diskurs, dieser sei ein Handlanger der Vereinigten Staaten und wir seien Feinde Nicaraguas. Er wirft uns vor, Handlanger der CIA und Beschäftigte des US-Außenministeriums zu sein. Es ist völlig abgenutztes, dummes Gerede, aber er hat auch gezeigt, dass er in der Lage ist, all diejenigen zu töten, die gegen ihn sind.
Jandir, Sie leben im Exil in Guatemala. Wie wirkt sich die Situation auf Ihr Leben aus?
Jandir: Ich habe nie daran gedacht, meinen Lebensunterhalt mit Musik zu verdienen. Ich war Medizinstudent. Ich war kein Musiker, aber ich bin in einer musikalischen Familie aufgewachsen und die Musik war immer meine große Leidenschaft. Ich komponierte erste Lieder, jedoch sehr amateurhaft. Als ich nach Guatemala ging, änderte sich mein Leben völlig, denn ich musste herausfinden, wie ich überleben sollte. Das Einzige, was ich in diesem Moment konnte, war Musik, und das ist bis heute das Einzige, was ich kann. Die Migration ist eine große Herausforderung. Neben dem wirtschaftlichen gibt es auch den kulturellen Aspekt. Die Anpassung an eine neue Lebensweise, das Verstehen einer anderen Kultur, die Erfahrung von Fremdenfeindlichkeit, die Erfahrung von Diskriminierung. Darüber hinaus habe ich einen Prozess durchlaufen müssen, um mich in der guatemaltekischen Musikszene entwickeln zu können.
Luis Enrique: Gerade die jungen Menschen verlassen das Land, weil sie dazu gezwungen sind. Oft müssen wir es über tote Winkel verlassen − über inoffizielle Grenzen nach Honduras oder Costa Rica fliehen oder mit etwas Glück nach Europa, in die Vereinigten Staaten oder nach Kanada. Ausreisen von einem Tag auf den anderen, mit nichts, nur mit dem, was du auf dem Körper trägst. Du verlässt deine Familie, dein Zuhause, deine Arbeit. Das macht die Situation nur noch schlimmer. Für Jandir ist es also eine Sache, für ein Konzert nach Guatemala zu gehen und nach Nicaragua zurückzukehren, aber es ist eine andere, sich in einem Land niederzulassen, ohne es geplant zu haben. Weder er noch ich wissen, wann wir zurückkehren werden.
Auf Berlin folgt ein Konzert in Paris, das den mehr als 220 politischen Gefangen in Nicaragua gewidmet ist. Im Besonderen Dora María Téllez, die den ihr von der Pariser Universität Sorbonne Nouvelle verliehenen Ehrendoktortitel nicht entgegennehmen kann. Wie hoch schätzen Sie die Wirkung dieses Solidaritätskonzerts ein?
Luis Enrique: Das ist eine sehr besondere Aktivität und es gibt auch einen runden Tisch, an dem dieser Zusammenhang diskutiert wird. Es handelt sich also vielleicht um die unmittelbarste politische Aktivität der gesamten Tournee. Das Konzert in Paris ist ein sehr wichtiger Punkt − Großgeschrieben! Für Dora Maria, für die inhaftierten und isolierten Frauen und ganz allgemein für alle politischen Gefangenen.
Unter welchen Voraussetzungen würden Sie nach Nicaragua zurückkehren?
Luis Enrique: Absolute Freiheit! Ohne Erlaubnis zu leben, ohne Erlaubnis zu denken, ohne Erlaubnis zu singen, zu kommen und zu gehen, sich zu organisieren, zu mobilisieren − absolute Freiheit und Gerechtigkeit!
Jandir: Das ist entscheidend.