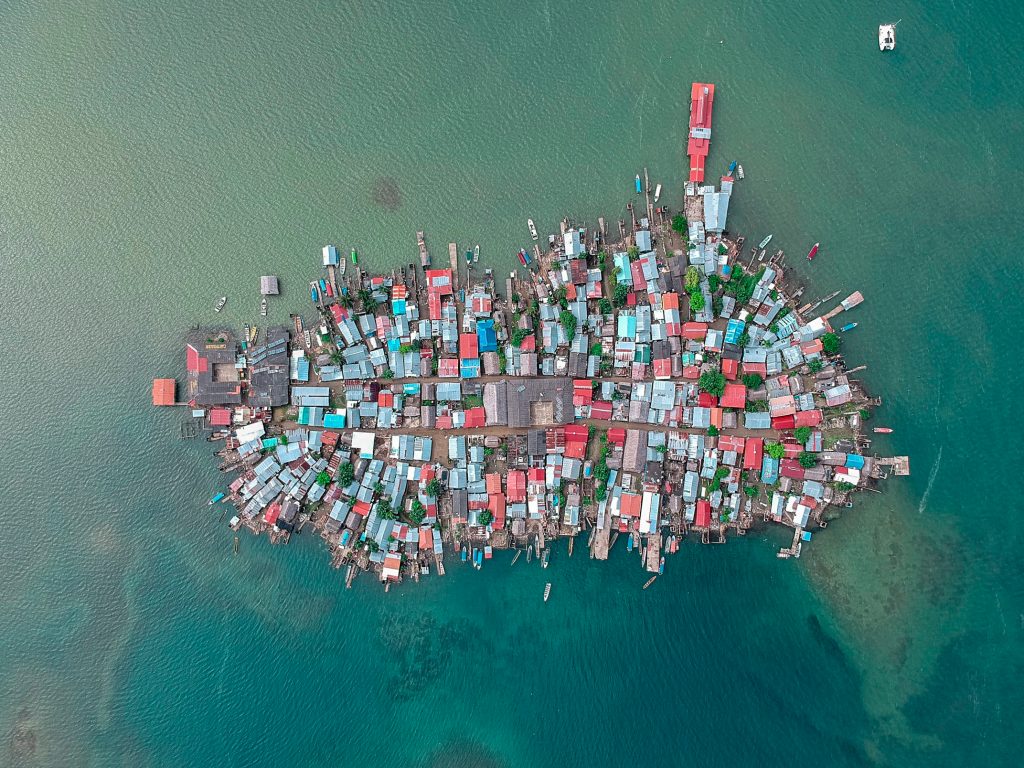Guillermo Martínez Pinillo bei der Arbeit (Foto: Instituto Natura)
Im Jahr 1991 war Chimbote eine der ersten Städte, die den Ausbruch der Choleraepidemie erlebte. Seither hat Ihre NGO Präventionsarbeit im Bereich der Gesundheitserziehung geleistet. Was ist heute, wo sich das Coronavirus verbreitet, anders?
1991 waren die Bedingungen andere als heute – sozial und politisch. Chimbote war eine viel besser organisierte Stadt, die Parteien und politischen Strömungen waren in den barrios präsent. Die Stadt befand sich im Wachstum, marginalisierte städtische Räume entstanden. Die Besiedlung verlief ungeplant, Bauern kauften Brachflächen oder Grundstücke und nutzten sie als Wohnraum. In diesem Prozess wurden Nachbarschaftsverbände organisiert, die um ihre städtischen Rechte kämpfen mussten, etwa um Nutzungsänderungen oder um die Einrichtung der Grundversorgung. Sie mussten die Besiedlung bestmöglich organisieren. Damals waren diese Verbände vorhanden und wurden von der Bevölkerung organisiert und gestärkt, heute existieren sie schlichtweg nicht mehr. Die Ansiedlungen, die pueblos jóvenes Chimbotes, haben es im Laufe der Zeit geschafft: Sie haben ihr Trinkwasser, die meisten verfügen über eine Kanalisation, sie sind prekär, aber sie existieren.
Heute haben wir die Räume und Bedingungen für die Organisation verloren. Es gibt weder eine dauerhafte Organisation in den Vierteln, noch gibt es Vertretungen, die durch den Willen der Bevölkerung der Gemeinden legitimiert sind. Das hat auch damit zu tun, dass der Staat diese Prozesse nicht gestärkt hat. Heute gibt es zwar ein Büro und eine Abteilung für Bürgerbeteiligung und die Gemeindeverwaltungen. Aber diese Räume für die Beteiligung der Gemeinde sind nicht genutzt worden.
Damals wurde die Ausbreitung der Cholera durch die massive Verschmutzung der peruanischen Küste begünstigt. Sehen Sie heute einen Zusammenhang zwischen den Umweltzerstörungen und der Ausbreitung von Covid-19?
Damals gab es in Chimbote günstige Voraussetzungen für eine Epidemie: die hohe Umweltverschmutzung, der Mangel an Grundversorgung, die Prekarität der Arbeit, das Fehlen von Gesundheits- und Bildungseinrichtungen und von staatlichen Dienstleistungen. Es ist eine Tatsache, dass das Immunsystem der Bevölkerung anfälliger ist, wenn der Körper gegen den Smog ankämpfen muss, gegen die Probleme im Zusammenhang mit Erkrankungen der Atemwege. Und ja, ich denke, dass aufgrund der Sorge um die Umwelt, also der Tatsache, dass wir nicht über eine gesunde Umwelt verfügten, der Körper nicht angemessen gegen die Cholera ankämpfen konnte. Das gilt auch für andere Krankheiten: Wenn ein Körper anfällig ist, ist es wahrscheinlicher, dass er sich infiziert und die Krankheit sich im Körper entwickelt.
Wenn wir von Körper sprechen, meinen wir den Körper einer Person, aber auch den Körper der Gesellschaft. Wenn der gesellschaftliche Körper in gleicher Weise anfällig ist, wird er auch leichter betroffen sein. In diesem Moment ist der Körper von Chimbotes Gesellschaft verwundbarer. Es stimmt, dass früher ein Großteil der Grundversorgung nicht existierte. Nun wurde dieser Mangel weitgehend aufgehoben. Doch damals gab es einen organsierteren, kompakteren, kohärenteren gesellschaftlichen Körper, der heute völlig zerstört daliegt. Wir müssen uns fragen, ob dieser ganze Prozess der Zerlegung der gesellschaftlichen Organisierung – ein Phänomen, das sich aus oder zusammen mit der Fujimori-Diktatur entwickelte – heute nicht auch eine Rolle spielt.
Seit die Regierung am 15. März den nationalen Notstand ausgerufen hat, ruht auch die Fischerei- und Stahlindustrie. Nun befürworten einige Institutionen die Wiederaufnahme der Fischereitätigkeit…
Ja, vor allem die Unternehmensgruppen tun sich schwer mit dem, was sie als „Verlust” bezeichnen. Es ist normal, einen Unternehmer sagen zu hören, dass er „Geld verliert”, wenn nicht gearbeitet wird. Das ist nicht gerade schlüssig, es ist doch eher so, dass sie keinen Profit verdienen.
In Peru wurden einige Tätigkeiten als essenziell eingestuft, nämlich diejenigen, die mit Transport, Nahrung, Gesundheit und deren Versorgung zu tun haben. Diese essenziellen Wirtschaftszweige, und auch einige andere, darunter die Textilindustrie wegen des Bedarfs an Sicherheitskleidung, laufen und produzieren weiter. Die handwerkliche Fischerei arbeitet weiter, denn es handelt sich um eine Versorgungstätigkeit. Bei anderen Wirtschaftszweigen ist dies nicht der Fall. Dennoch hat die Regierung im Bergbau einige Lockerungen erlassen und die Arbeit in den Bergbaugebieten zugelassen. Wir wissen mittlerweile, dass mindestens 70 bis 80 Bergarbeiter im Land infiziert sind.
Trotzdem besteht in der CONFIEP, dem größten Unternehmensverband des Landes, weiterhin ein Interesse daran, dass andere Wirtschaftstätigkeiten wieder anlaufen – eine davon ist die Fischerei (Stand 28. April 2020, Anm. der Redaktion).* Vor diesem Hintergrund hat sich die Nationale Fischereigesellschaft (SNP), die Teil der CONFIEP ist, dahingehend geäußert, dass es notwendig ist, auch die Aktivitäten der industriellen Fischerei wiederaufzunehmen.
Wie stehen Sie zu diesem Vorschlag?
Diese nicht essenziellen Tätigkeiten können erst wiederaufgenommen werden, wenn Protokolle für die Aufhebung der Quarantäne vorliegen. Auch dann dürfen sie ihre Tätigkeiten nur unter strengen und rigorosen Protokollen der Gesundheitskontrolle aufnehmen. Es muss gezielt getestet werden, die Unschädlichkeit der Lebensmittel muss gesichert werden. Es braucht außerdem zeitversetzte und variable Zeitpläne, um Menschenanhäufungen innerhalb und außerhalb der Fischereianlagen und während des Transportes zur Industrieanlage zu vermeiden. Das bedeutet, dass die Schiffe ebenso wie sämtliche Einrichtungen ordnungsgemäß desinfiziert werden müssen.
Vor Beginn der Pandemie war das Institut Teil eines Netzwerks gegen den Extraktivismus von Erdöl im Norden Perus. Wie wirkt sich der Ausnahmezustand auf Ihren überregionalen Aktivismus aus?
Das Jahr 2018 war der Beginn unseres verstärkten Aktivismus gegen die Erdöl-Aggression. Wir arbeiten an dem Thema bereits seit 2010/11, als das Interesse an der Ausbeutung der Ölvorkommen in den Küsten- und Meeresgebieten wieder zunahm. Seit 2018 sind wir kontinuierlich aktiv und widmen uns der Arbeit mit viel mehr Nachdruck und im Austausch mit den Küstengemeinden und den sie vertretenden Organisationen. Diejenigen aus der nördlichen Makro-Region, mit denen wir einige Treffen hatten, haben sich zu einem Zusammenschluss entwickelt, der über das Thema Öl hinausgeht. Es geht darum, Kritik und Lösungsvorschläge für das Problem des Extraktivismus in seiner Gesamtheit zu entwickeln. Das konnte nun nicht stattfinden.
Wieso kam der Prozess ins Stocken?
Der Organisationsprozess kam ab März aufgrund der Einschränkung der Bewegungsfreiheit zum Erliegen. Unsere Treffen müssen persönlich stattfinden, weil dort eine Vielzahl an Menschen in Anwesenheit diskutieren und debattieren müssen. Außerdem kommen die Vortragenden aus fünf verschiedenen Regionen des Landes: aus Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad und Ancash. Es ist also, trotz der Vertrautheit der Beteiligten mit den digitalen Medien, nicht möglich, eine solche Debatte zu führen, die einige Besonderheiten aufweist. Obwohl das letztendliche Ziel mehr oder weniger klar ist – nämlich, dass es ein Moratorium gibt, dass es keine weiteren Lizenzen gibt – so gibt es doch ungeklärte Aspekte wie etwa die Frage nach den politischen Strategien. Konzepte für die Form des Zusammenschlusses müssen beispielsweise über Steuerungsinstrumente, wie vorherige Konsultationen, verfügen.
Die Strategie besteht darin zu erreichen, dass die Gemeinden als solche anerkannt und damit von der Konvention Nr. 169 der Internationalen Arbeitsorganisation zum Schutz der Rechte der indigenen Völker erfasst werden. Damit der Staat sie als solche anerkennt, müssen mehrere Ministerien durchlaufen werden, nicht nur das Ministerium für Energie und Bergbau, sondern auch das Ministerium für Kultur, für Bildung und das der gesellschaftlichen Inklusion. Es muss also vieles diskutiert werden, es ist ein langer Prozess und wir wollen einen kleinen Beitrag leisten.
*Basierend auf dem Ministerialerlass vom 7. Mai wurde der industrielle Fischfang von Sardellen ab dem 13. Mai zugelassen. Die industrielle Fischerei zählt damit zu einer der Sektoren der ersten Phase der Reaktivierung der Wirtschaft. Von Arbeitnehmer*innenverbänden wird bezweifelt, ob die sektoralen Gesundheitsprotokolle, insbesondere die darin vorgesehenen Abstandsregeln, in der Praxis einhaltbar sind.














 SANDRA PALESTRO CONTRERAS
SANDRA PALESTRO CONTRERAS