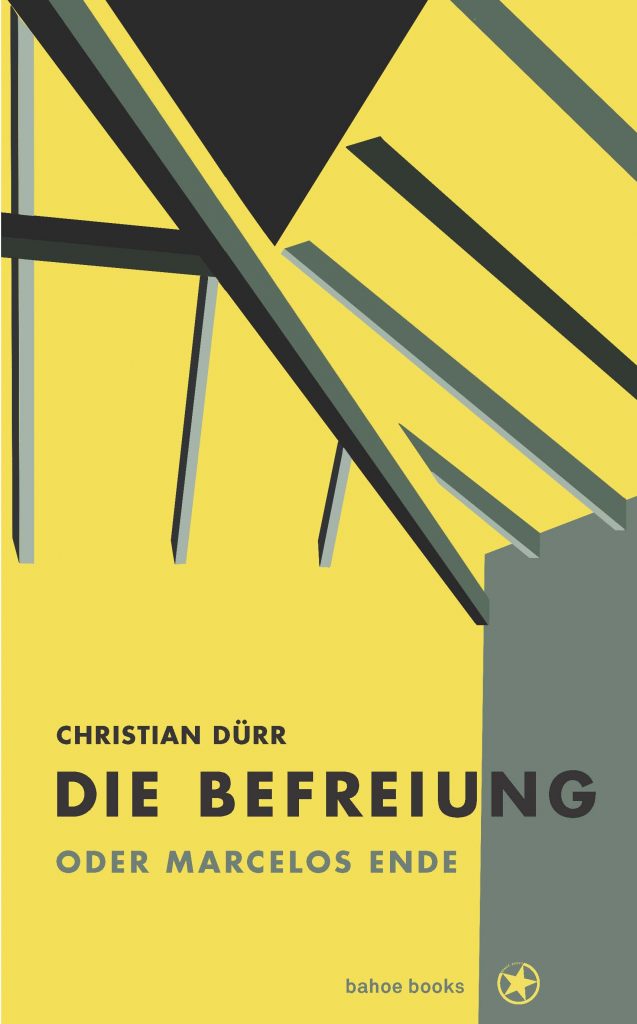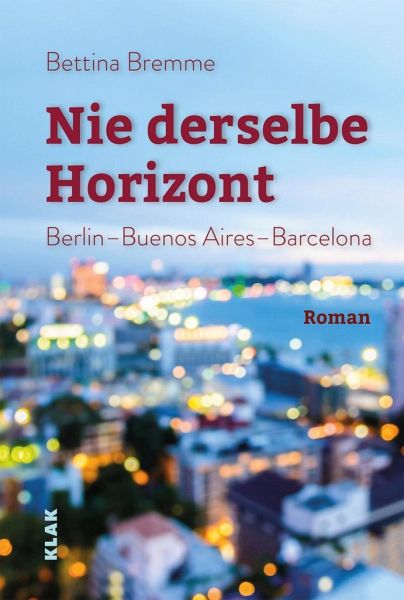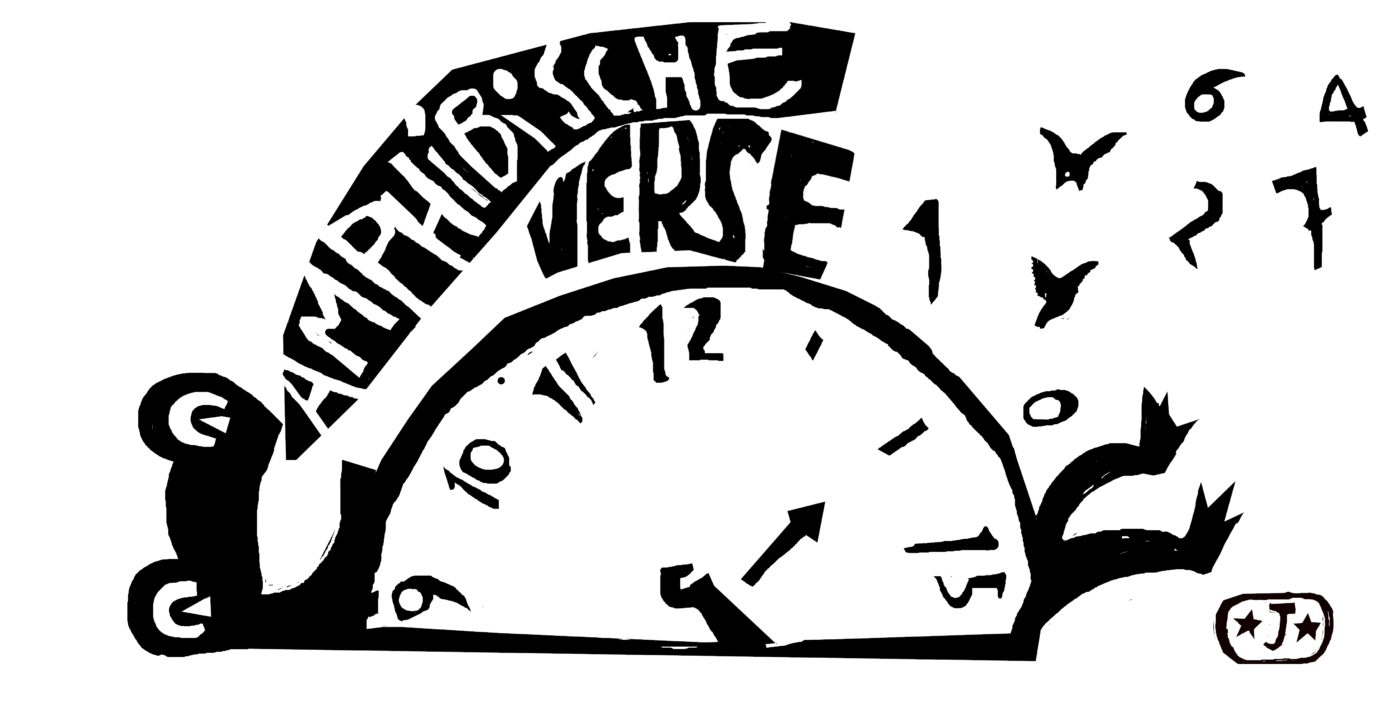Illustration: Joan Farías Luan, www.cuadernoimaginario.cl
Enfance (Extrait)
Tandis que l’aïeule égrène ses prophéties
les étoiles se posent sur les lèvres
de la petite fille
celle qui refuse les tutus l’organdi
le marché aux illusions des marionnettistes
À la tombée de la nuit
elle dérobe les masques confondus
les fait voler en éclats au bas des falaises
Comme chaque animal
elle fait confiance à ses antennes
à ses côtés nul corps céleste
nul ange gardien
Elle va dans l’espérance de ses semelles
et dans la lumière de l’instant
Kindheit (Auszug)
Während die Ahnin ihre Prophezeiung aufsagt
legen sich die Sterne auf die Lippen
des kleinen Mädchens
das Tutus und Batist verweigert
den Trugbildermarkt der Marionettenspieler
Bei Einbruch der Nacht
stiehlt sie die vertauschten Masken
zerschmettert sie am Fuß der Klippen
Wie jedes Tier
vertraut sie auf ihre Fühler
an ihrer Seite kein Himmelskörper
kein Schutzengel
Sie geht in der Hoffnung ihrer Schritte
und im Licht des Augenblicks