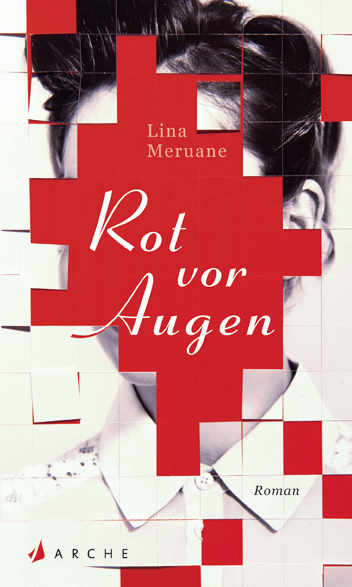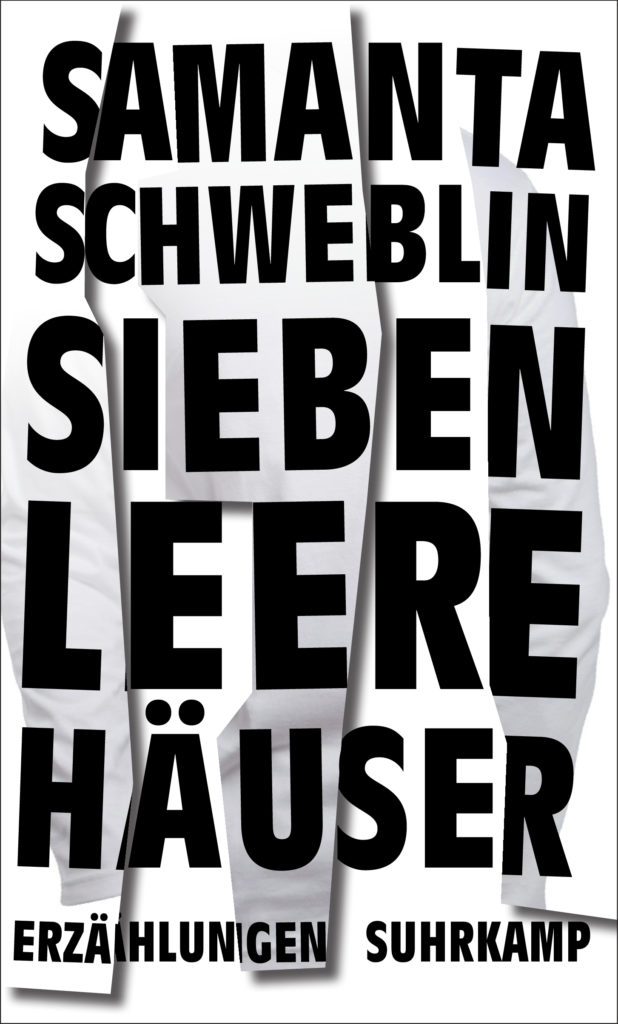Olinka, die Utopie einer Stadt, in der Künstler*innen, Intellektuelle und Wissenschaftler*innen zusammenleben. Entworfen hat sie in den fünfziger Jahren der mexikanische Künstler Doctor Atl. In seinem neuen Roman Die Verschwundenen – der im Original Olinka heißt – bezieht sich Antonio Ortuño auf genau diese Vision. Bei ihm ist Olinka ein fiktiver Vorort Guadalajaras, in dem eine nie fertig gebaute Luxuswohnanlage langsam verfällt.
Fünfzehn Jahre lang saß Aurelio Blanco im Gefängnis. Jetzt, nach der Entlassung, ist Olinka sein Ziel: Dort wohnt nicht nur seine Ex-Frau Alicia, die sich während der Haft von ihm scheiden ließ und von der er insgeheim hofft, sie zurückgewinnen zu können, sondern auch ihr Vater Carlos Flores, Bauherr von Olinka. Vor Jahrzehnten hatte Flores alle Strippen gezogen und das Grundstück, auf dem er sein eigenes Olinka errichten wollte, dank Bestechung und Geldwäsche bekommen. Diese Schuld hatte Blanco als Gefallen und auf falsche Versprechungen hin auf sich genommen. Im Luxusviertel Olinka, das niemals zu seiner Glanzzeit fand, trifft Blanco nicht nur auf ihn, sein einstiges Idol und Widersacher zugleich, und auf Alicia, auch die entfremdete Tochter ist während der Semesterferien zu Besuch. Blanco hat die Gelegenheit, endlich mit allen Lügen aufzuräumen.
Als Grundkonzept mit den Themen Politik, Korruption, Immobilienblase und deren Auswirkungen auf eine Familie sehr spannend angelegt, ist Die Verschwundenen in seiner Ausführung leider eine Enttäuschung. Aurelio Blanco ist eindimensional und (selbst nach dieser langen Haftzeit) dermaßen naiv und passiv, dass man ihn am liebsten schütteln würde. Die anderen Figuren wirken wie eine Staffage, allein Alicia Flores ist vielschichtiger. Vor allem ihr Vater Carlos aber bleibt unglaubwürdig. Zu diesem verträumten Trottel will so gar nicht passen, dass er einst in der Lage war, Morde an den resistenten Bauern in Auftrag zu geben, die vor Olinka auf diesem Land lebten und die er nicht vertreiben konnte. Er ließ sie also schlichtweg „verschwinden“, worauf der Titel des Romans anspielt. Nicht passen wollen auch viele Szenen, so die Dialoge, Reaktionen und überzogenen Emotionen der Protagonist*innen. Ortuño benutzt bei diesen Schilderungen viele Adjektive und detaillierte Beschreibungen, die aber alles andere als hilfreich sind, um die Szenen authentischer zu machen.
Nach den starken Romanen Madrid, Mexiko (siehe LN 516) und vor allem Die Verbrannten (LN 499), sein erstes auf Deutsch veröffentlichtes Buch, das auf eindringliche Weise die mexikanische Politik, Polizei und Gesellschaft kritisiert, ist Die Verschwundenen erstaunlich seicht. Was fast schon wieder zur Grundkonstruktion passt: Antonio Ortuño gelingt genauso wenig, das Potential seines Romans auszuschöpfen, wie es im Text Carlos Flores gelingt, seiner Luxuswohnanlage Leben einzuhauchen. Und auch Doctor Atl starb, ohne seine Utopie Olinka jemals verwirklichen zu können.
*Éin Interview mit dem Autor Antonio Ortuño gibt es hier in der Ausgabe LN 509.