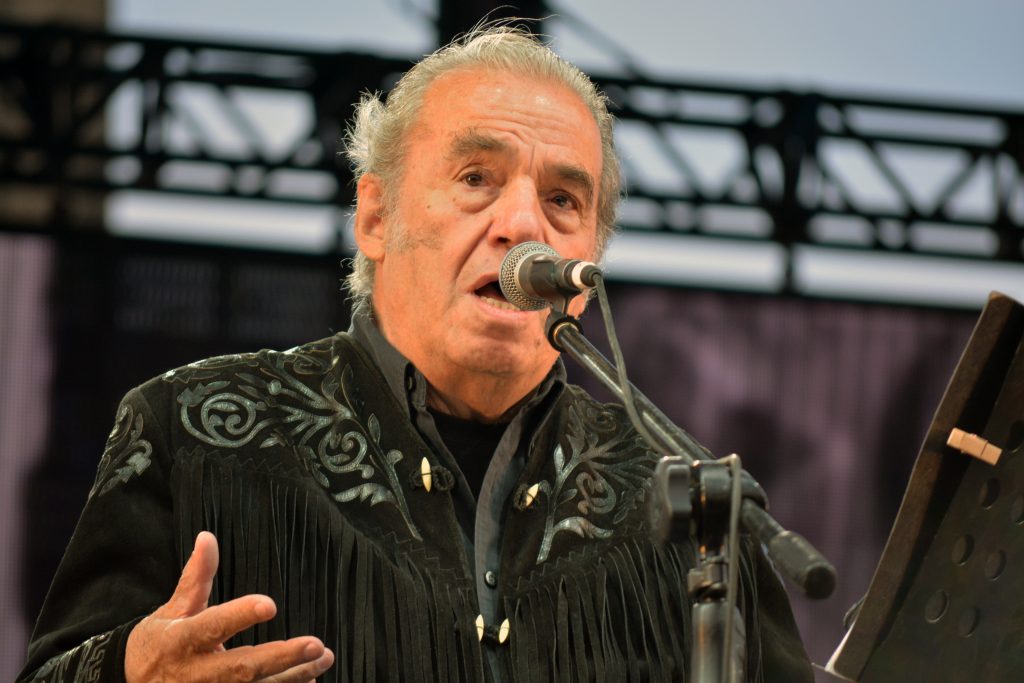Es war nicht deine Schuld Betroffene sehen sich häufig mit Stigmatisierung und Schuldzuweisungen konfrontiert
Illustration: Producciones y milagros, @produccionesymilagros
Ciudad Juárez liegt im Norden Mexikos, an der Grenze zu den Vereinigten Staaten. Seit den 1990er Jahren werden hier immer wieder grausame Gewalttaten an Frauen bis hin zum Feminizid begangen, wofür die Stadt mittlerweile international bekannt ist. Unzählige Familien fordern Gerechtigkeit für die schrecklichen Verbrechen, die ihren Töchtern angetan wurden, und sehen sich dabei mit einer Dynamik von Stigmatisierung und Schuldzuweisung konfrontiert: Ganz gleich, ob eine Frau einen versuchten Feminizid überlebt oder nicht, werden von Seiten des Staates und der Gesellschaft schnell Stimmen laut, die die Schuld für Verbrechen bei den Betroffenen selbst suchen.
Die grausame Gewalt gegen Frauen kann nicht losgelöst vom sogenannten „Krieg gegen die Drogen“ betrachtet werden. Dieser Krieg wurde von der Regierung 2008 in Ciudad Juárez eingeleitet und schnell auf alle Teile des Landes ausgeweitet. Nach offiziellen Angaben sind in Mexiko seither mindestens 61.000 Menschen verschwunden. Diese Zuspitzung der Gewalt wirkt sich auch auf die Situation von Frauen in der Stadt aus.
Ciudad Juárez ist ein sehr komplexer Ort, über den es zahlreiche Berichte, Studien und Analysen gibt. Hier herrscht eine Dynamik, in der Industrialisierung und die Ausbeutung billiger Arbeitskraft in den Montagefabriken, den sogenannten maquiladoras, in direkter Verbindung mit der Prekarisierung von Lebensweisen und der hier herrschenden Gewalt stehen. Eine Gewalt, die sich in ihren extremsten Formen in die Körper von Frauen und Mädchen einschreibt.
Sexualisierte Gewalt ist eine dieser Formen. Die Sozialwissenschaftlerin Julia Monárrez, die in der Grenzregion arbeitet, hat anhand umfangreicher Forschungsarbeiten über Frauenmorde mit Merkmalen sexualisierter Gewalteinwirkung den Begriff des systematischen sexualisierten Feminizids (feminicidio sexual sistémico) geprägt. Für ihre Forschung greift Monárrez auf eine Statistik der Hochschule El Colegio de la Frontera zurück, in der „zwischen 1993 und dem 31. August 2018 über 1.850 Fälle von getöteten Mädchen und Frauen erhoben wurden und von denen 322 nicht identifiziert werden konnten.“ Von diesen 1.850 Fällen klassifiziert sie 154 als systemische sexualisierte Feminizide. Die Opfer waren zwischen 11 und 19 Jahre alt, also zumeist Minderjährige. Sie waren Arbeiterinnen, Angestellte im Einzelhandel, Studentinnen oder Barkeeperinnen. „Sie alle hatten sexuelle Folter erlitten, ihre Körper wurden verstümmelt und an verlassenen Orten wie leeren Grundstücken oder Wüstengebieten rund um die Stadt aufgefunden“, schreibt Monárrez in einem Essay. So drückt sich der systematische sexualisierte Feminizid einerseits in der zutiefst brutalen und als frauenfeindlich gekennzeichneten Gewalt gegen diese Körper und andererseits in der von Staat und Justiz gebilligten Zurichtung der Körper aus, was sich in der weit verbreiteten Straffreiheit der Verbrechen spiegelt.
Diese extreme Gewalt gegen Frauen und Mädchen offenbart die tiefen Wurzeln des Phänomens, das die Anthropologin Rita Segato als das „Mandat der Männlichkeit“ bezeichnet: Bereits in ihrer Kindheit und Jugend werden Jungen häufig dazu aufgefordert, Stärke zu zeigen und damit Macht auszuüben. Ihnen wird eine Position zugeschrieben, die sich durch Dominanz auszeichnet. Diese dominante Position ist jedoch zugleich sehr fragil. Vereinfacht gesagt, können bestimmte Umstände, die diese Dominanz grundsätzlich in Frage stellen, dazu führen, dass die sich stark und unabhängig wähnende Person eine Form der Entmachtung erfährt. Ein Weg, sich diese Macht und Stärke wieder zu eigen zu machen, ist die Ausübung von Gewalt in ihren zahlreichen Formen – physisch, psychologisch, sexualisiert.
Während unzählige Familien um Gerechtigkeit kämpfen und oft vergeblich versuchen, die Fälle ihrer ermordeten oder verschwundenen Töchter aufzuklären, verharren staatliche Institutionen in einer Strategie aus Stigmatisierung und Anschuldigungen gegen die Opfer. Warum war sie zu dieser Zeit an jenem Ort? Warum trug sie diese oder jene Kleidung? Fragen, die suggerieren, dass die Opfer selbst die Verantwortung für die Verbrechen tragen. Wenn ermordeten Frauen und Mädchen die Schuld an Gewaltverbrechen zugewiesen wird, stellt sich die Frage, was passiert, wenn eine Betroffene sexualisierter Gewalt einen Angriff überlebt.
Im Mai vergangenen Jahres wurde eine Dozentin der Autonomen Universität von Ciudad Juárez (UACJ), deren Identität ich an dieser Stelle schützen möchte, Opfer einer Vergewaltigung durch mehrere ihrer Kollegen. Der Fall ist auch heute noch nicht vollständig aufgearbeitet. Drei der insgesamt vier Täter – Israel, Alejandro und Roberto – sind weiterhin auf der Flucht. Giovanni, der einzige Verurteilte, reicht nun Klage gegen das Urteil ein. Zwei der Täter kenne ich persönlich.
Man könnte meinen, dass sich die betroffene Dozentin in einer privilegierten Situation befinde, da sie immerhin an der Universität lehrt. Ihre Lebensrealität überschneidet sich jedoch zumindest teilweise mit den von Monárrez dokumentierten Fällen junger Frauen, die tagtäglich mit den Strukturen von Gewalt und Ungleichheit zu kämpfen haben. Bis sie Mitte zwanzig war, verbrachte sie die meiste Zeit ihres Lebens mit dem Studium, um dem damit versprochenen Aufstieg näher zu kommen. In Wahrheit ist sie jedoch weit davon entfernt, die vermeintlichen Privilegien als Akademikerin zu genießen.
Sie lebt im marginalisierten Westen der Stadt, wo bereits viele Frauen Opfer von Feminiziden wurden. In einer Stadt, in der öffentliche Räume oft zur Gefahr für Frauen werden, nimmt sie den Bus zur Arbeit. Dunkle Straßenzüge ohne Beleuchtung geht sie zu Fuß. Ihr Gehalt an der Universität ist kaum höher als der Lohn von manchen Arbeiterinnen in den maquiladoras.
An jenem Abend, als sie zum ersten Mal zu einer privaten Feier von Kollegen eingeladen wurde, erwartete sie intellektuellen Austausch, nettes Beisammensein und in gewisser Weise auch eine Form von Anerkennung als geschätzte Kollegin. Was jedoch geschah, kann nicht von der Verschränkung von klassen- und geschlechtsspezifischen Machtverhältnissen losgelöst betrachtet werden, die schließlich zu der mehrfachen Vergewaltigung führten.
Ich kenne die Dynamik, der die Dozentin in dieser Situation ausgesetzt war. Ich kenne zwei der Täter, die wie ich Teil des Kunst- und Filmkollektivs Vagón waren, ein von Männern aus der Mittelschicht dominierter Ort. Ganz besonders fiel das Machogehabe bei Feiern im kleinen Rahmen auf. Die beiden Männer dominierten Gespräche, übertrafen sich in erniedrigenden und herabwürdigenden Scherzen.
Rita Segato identifiziert im Fall von Vergewaltigungen kollektive Elemente, die sie besonders bei jungen Männern verortet. Sie legt nahe, dass hier „Paradigmen der Männlichkeit“ existieren, die Eltern, ältere Brüder, Männer, zu denen sie aufsehen, fortführen und legitimieren. So wird eine Welt der Maskulinität geschaffen, in der sexualisierte Gewalt keine Abweichung von der Norm darstellen muss, da ein Täter im Austausch mit seinesgleichen, die in dieser Logik „erfolgreich“ ihre Männlichkeit ausüben, lediglich die Paradigmen dieser Männlichkeit abruft.
Rape culture urteilt nicht nur über die Sexualität von Frauen. Diese Kultur lässt es zu, dass sich Männer gegenseitig als schwach, machtlos oder unfähig abstempeln. Die Anforderungen, jenen „Paradigmen der Männlichkeit“ gerecht zu werden, beginnen im Austausch mit Freunden, Kollegen, der Familie, wo ein unausgesprochener Pakt darüber besteht, den traditionell männlichen Zuschreibungen von Stärke und Dominanz Folge zu leisten. In diesem Streben nach Anerkennung der eigenen Männlichkeit werden die Körper von Frauen zur Projektionsfläche. Am Abend, als die Dozentin auf ihre Vergewaltiger traf, wurde ihr Körper zum Medium, mithilfe dessen sich die Täter ihrer Männlichkeit versicherten. Indem sie sich gegenseitig vorführten, zu was sie in diesem grauenvollen Moment in der Lage waren, demonstrierten sie jeweils ihre Macht vor sich selbst und den drei Mittätern. Die Dozentin erklärte später, dass die Täter bereits am nächsten Tag selbst Gerüchte über eine vermeintliche sexuelle Orgie im Umlauf brachten, von der sie Teil gewesen seien – sie waren stolz auf ihre Handlung und sie wussten, dass sie dafür aus den eigenen Kreisen Anerkennung erfahren würden.
Die mediale Darstellung sexualisierter Gewalt lässt uns in dem Glauben, dass diese im öffentlichen Raum passiert und von Fremden ausgeübt wird. Die junge Dozentin wurde an einem vermeintlich sicheren Ort Opfer einer Vergewaltigung. Die Täter kommen, wie in den allermeisten Fällen sexualisierter Gewalt, aus dem privaten Umfeld der betroffenen Frauen und Mädchen. Diese Situation erklärt auch die Zunahme häuslicher Gewalt während der Covid-19-Pandemie.
Die Dozentin beschloss, den Fall zur Anzeige zu bringen. Bis heute kämpft sie für Gerechtigkeit, was dazu führte, dass sie unter den Augen der Öffentlichkeit und neben dem anstrengenden juristischen Verfahren zusätzlich mit Konflikten innerhalb der Universität konfrontiert wurde. Sie sah sich nicht nur Einschüchterungen ausgesetzt: Ihre Beschäftigung wurde Anfang des Jahres grundlos auslaufen gelassen, obwohl sie als Promotionsstudentin an der Uni lehrte.
Zusätzlich wurde sie von einer Anwältin von Casa Amiga, der Organisation, die sie psychologisch und juristisch betreute, schikaniert. Diese gab im Grunde ihr die Schuld und sagte: „Niemand hat dich gezwungen, zu dieser Party zu gehen, noch hat man dich zum Trinken gezwungen.“ So kommt zum mangelnden Mitgefühl und Verständnis gegenüber Überlebenden sexualisierter Gewalt, die mit jeglichen Formen der Stigmatisierung und Abwertung konfrontiert werden, noch die Schuldzuweisung für die erlittene Gewalt.
Der Kampf der Dozentin um Gerechtigkeit wird auch einer gegen die Straflosigkeit sein. 71 Prozent der 3.348 Vergewaltigungen, die zwischen Januar 2010 und Juli 2019 in Ciudad Juárez angezeigt wurden, sind nach wie vor ungeklärt. Die jüngste landesweite Erhebung zur öffentlichen Sicherheit ergab, dass 99,7 Prozent der sexualisierten Übergriffe in Mexiko nicht gemeldet werden. Zu den entmutigenden Statistiken kommt die physische und emotionale Belastung im Rahmen des Gerichtsverfahrens hinzu, und nicht jede*r ist bereit oder in der Lage, damit umzugehen.