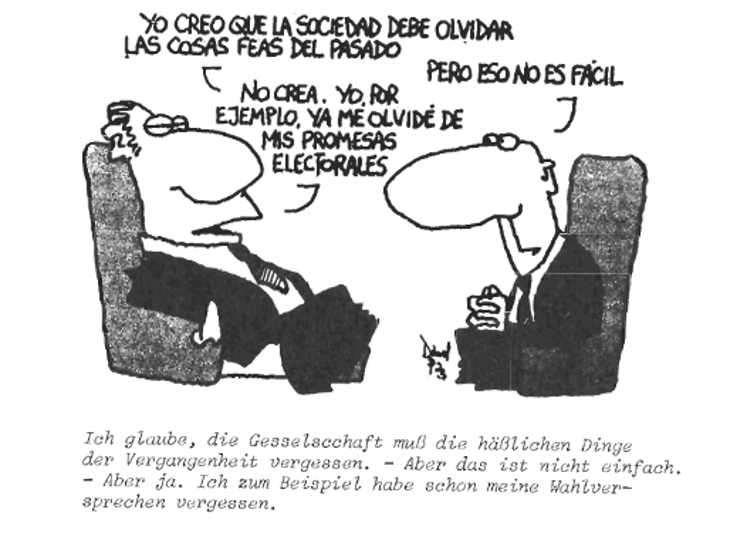Franz Josef Hinkelammert wurde 1931 im westfälischen Emsdetten geboren. Er studierte Wirtschaftswissenschaften an der Freien Universität Berlin und promovierte mit einer grundlegenden Arbeit zur sowjetischen Planwirtschaft. In den 1960er Jahren entsandte ihn die Konrad-Adenauer-Stiftung nach Chile, wo er an der Katholischen Universität lehrte und an der Gründung des Zentrums für die Erforschung der Nationalen Realität CEREN teilnahm.
Als meine Frau Clarita und ich 1968 an einem Forschungsprojekt in der chilenischen Provinz Talca beteiligt waren, wurde uns von verschiedenen Seiten vorgeschlagen, ihn kennenzulernen. Wir lehnten das ab, weil wir ja Chileninnen und Chilenen kennenlernen wollten und keine Deutschen, noch dazu von der Adenauer-Stiftung! Ein schwerer Fehler! Umso größer war unsere Überraschung, als dieser Franz Josef Hinkelammert Ende 1971 in Berlin vor unserer Tür stand und mir eine Einladung des Rektors der Katholischen Universität überbrachte, an einem vom chilenischen Wirtschaftsministerium finanzierten Forschungsprojekt des CEREN zur Begleitung seines Umverteilungsprojekts mitzuwirken. Wir sagten zu, und im März 1972 flogen wir mit unseren beiden kleinen Kindern nach Santiago.
Im März 1973 kehrten wir nach Berlin zurück, wo ich meine Arbeit am Lateinamerika-Institut wieder aufnahm. Im Mai gründeten wir ein deutschlandweites Chile-Komitee, im Juni eine Zeitschrift namens Chile-Nachrichten, und im September putschte das chilenische Militär gegen den linken Präsidenten Salvador Allende. Der Traum von einem demokratischen Sozialismus war beendet.
Die Verfolgung der Linken und Demokraten in Chile war grausam, aber Franz gelang es, sich in die (west)deutsche Botschaft zu flüchten. Und wir schafften es, für ihn eine Gastprofessur am Lateinamerika-Institut der Freien Universität Berlin einzurichten. Für Franz war es eine Selbstverständlichkeit, an den Chile-Nachrichten mitzuarbeiten, und als 1974 das Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika (FDCL) gegründet wurde, war es nur natürlich, dass Franz zu seinem Ersten Vorsitzenden gewählt wurde.
Als 1976 die Gastprofessur ausgelaufen und eine Berufung auf eine ordentliche Ökonomieprofessur aus politischen Gründen gescheitert war, zog es Franz doch wieder nach Lateinamerika, zumal sich ihm die Chance bot, zusammen mit dem chilenischen Theologen Pablo Richard und dem brasilianischen Theologen Hugo Assmann ein Ökumenisches Forschungsinstitut in Costa Rica aufzubauen, das bald zu einem der wichtigsten Zentren der lateinamerikanischen Befreiungstheologie wurde. Er hatte, was selten genug war, neben der Ökonomie auch in Münster Theologie studiert.
Franz widmete sich nicht nur der Redaktion der vom Institut herausgegebenen Zeitschrift Pasos, sondern publizierte im Laufe der Jahre auch mehrere Bücher, die ihn zum tonangebenden Befreiungstheologen und Kapitalismuskritiker werden ließen. An erster Stelle wäre hier zu nennen das Buch mit dem Titel „Die ideologischen Waffen des Todes. Zur Metaphysik des Kapitalismus“ aus dem Jahr 1981. Franz argumentiert hier, dass in der kapitalistischen Gesellschaft die Menschen ihr Subjektsein abgegeben haben und dem Wachstumszwang ausgeliefert werden, der vom Zwang zur Kapitalakkumulation angetrieben wird. Er verbindet die ökonomische Analyse der konkreten Entwicklungen der globalisierten kapitalistischen Weltwirtschaft mit einer theologischen Interpretation. Dem „Reich des Todes“ wird in einer Deutung des Paulus-Buches das „Reich des Lebens“ gegenübergestellt.
Franz zeigte, dass Neoliberalismus nur in Totalitarismus enden kann
Ein weiteres wichtiges Werk von Franz aus dieser Zeit ist die 1984 erschienene „Kritik der utopischen Vernunft“. In diesem Buch setzt er sich vor allem mit Friedrich August von Hayek, Milton Friedman, Arnold Harberger und Karl Popper, also den Vordenkern und Bewunderern des Neoliberalismus, auseinander. Friedman und Harberger hatten in den 1960er Jahren an der Universität von Chicago ein Stipendienprogramm für chilenische Ökonomiestudenten geschaffen. Absolventen dieses Programms, die sogenannten Chicago Boys, dienten sich nun nach dem chilenischen Putsch von 1973 der Militärregierung an, um die Ideen ihrer Lehrmeister in Chile umzusetzen. 1975 reiste Friedman nach Santiago und entwarf mit ihnen ein radikales „Schockprogramm“, das konsequent umgesetzt wurde. Was dann in Großbritannien unter Margaret Thatcher und in den USA unter Ronald Reagan stattfand, war im Grunde nur eine Kopie des chilenischen Beispiels. In dem Buch von Franz wird gezeigt, dass das neoliberale Privatisierungsprogramm gar nicht woanders hinführen kann als zu einem totalitären System.
2020 hat Franz noch einmal ein Buch geschrieben, das sich wie ein Fazit aller seiner Bücher liest. „Die Dialektik und der Humanismus der Praxis. Mit Marx gegen den neoliberalen kollektiven Selbstmord“ nennt sich das Werk. Es ist das Ergebnis eines fruchtbaren Kampfes für Gerechtigkeit in allen Lebensbereichen. „Die Kritik der Religion endet also bei dem kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist.“ Dieser Satz von Marx bleibt für Franz Hinkelammert oberster Maßstab.
Zum Schluss soll nicht verschwiegen werden, dass Franz ein Familienmensch war. Er war dreimal verheiratet und hatte mehrere Kinder. So war immer etwas los im Hause Hinkelammert.
Mit dem zunehmenden Alter wurden die langen Flugreisen zwischen San José und Berlin zu beschwerlich. So haben wir uns zuletzt lange nicht mehr gesehen. Schade.