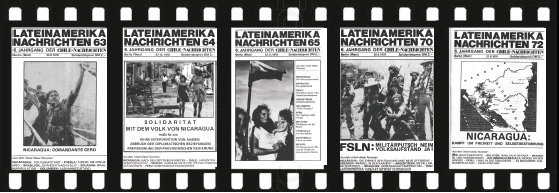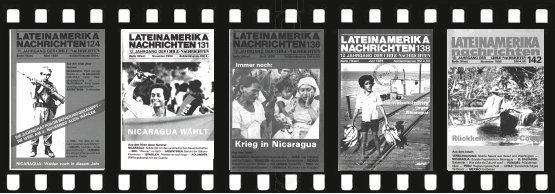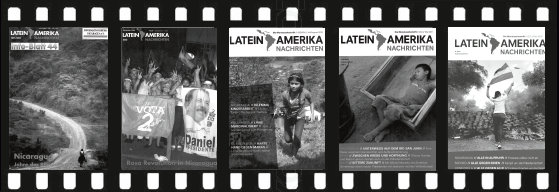Weiblicher Widerstand Feminist*innen kämpfen gegen die Regierung (Foto: Flickr.com Jorge Mejía Peralta CC BY 2.0)
Eine Gruppe von Frauen spielt Theater. Ein Mann tritt mit einem Gewehr ein. Die Frauen spielen weiter, der Mann geht nach einiger Zeit. Der Mann gehörte jedoch nicht zum Stück. Der Mann ist Teil des Terrors, den die Menschen in Nicaragua im Alltag spüren. Immer wieder treten Anhänger Ortegas wie er an solchen Orten auf, um mit Waffengewalt Angst einzuflößen. Feminist*innen erhalten Drohungen, werden beschimpft, in den sozialen Medien verleumdet und ein feministisches Zentrum wurde beschossen. Bei der Theaterprobe ließen sie sich nicht einschüchtern, doch die Bedrohung und Angst ist überall greifbar.
„Es ist eine humanitäre Krise“, sagt Edith* aus Matagalpa. Die Diktatur Ortega-Murillo durchdränge mit dem Terror die ganze Gesellschaft. „Die Regierung hat bei den Menschen immer weniger Rückhalt, aber sie hat Macht. Die Macht der Waffen!“, sagt Edith, die Feministin. Die letzten Barrikaden, welche die Protestierenden im ganzen Land errichtet hatten, und die Besetzungen der Universitäten beseitigte die Regierung Mitte Juli gewaltsam im Rahmen der „Operation Säuberung“. Zeitgleich verabschiedete das Parlament das „Gesetz gegen Geldwäsche, die Finanzierung von Terrorismus und die Verbreitung von Waffen“. Auf der Grundlage dieses „Anti-Terrorgesetzes“ werden nun zahlreiche Protestierende verurteilt und kritische Organisationen gefährdet. Präsident Ortega startete eine Medienkampagne, um auf internationaler Ebene zu verkünden, dass das Land wieder zur Normalität zurückgekehrt sei (siehe Artikel S.38). María*, eine Feministin aus der Hauptstadt Managua, beschreibt hingegen, dass die Verfolgung, Einschüchterung und Angst im August ein neues Niveau erreichte: „Dieser Zustand ist schlimmer! Wenn du an den Barrikaden oder bei Demonstrationen warst, wusstest du, was du riskierst. Jetzt bist du zu Hause und weißt nicht, ob und wann sie kommen und dich nach El Chipote verschleppen.“ Das Gefängnis El Chipote war das berüchtigste Folter-Zentrum der Somoza-Diktatur.
Feminist*innen sind seit Beginn der Proteste zentrale Akteur*innen des Widerstands
Feminist*innen sind seit Beginn der Proteste Mitte April zentrale Akteur*innen des Widerstands. Die Gruppen kämpfen schon seit Jahren gegen die Regierung und für ihre Rechte und sind deshalb landesweit organisiert und vernetzt. Sie beschreiben, dass Diskriminierungen aufgrund von Homophobie und Sexismus in den letzten Wochen zunahmen. Viele der Kollektive haben aus ihrer Arbeit zu sexualisierter Gewalt Erfahrung mit Gewaltsituationen, der Schikanierung der Opfer und falschen Anschuldigungen durch die Täter. Dadurch schaffen sie es auch, angesichts der aktuellen Situation gegenseitig auf sich zu achten und handlungsfähig zu bleiben. „Kollektivität ist der stärkste Schutz gegen die Vereinzelung und Spaltung durch den Terror“, sagt Edith. „Sie kämpfen für das Leben und wollen den Terror nicht gewinnen lassen”, kündigt sie kämpferisch an.
Viele Menschen können sich vor ihrer Angst, dem zunehmenden ökonomischen Druck (insbesondere für informelle Arbeiter*innen) oder vor politischer Verfolgung nicht schützen und fliehen vor der Gewalt. Insbesondere in Costa Rica, aber auch in Panama, Mexiko und den USA stieg die Anzahl der Anträge auf politisches Asyl enorm an. In Deutschland und Spanien suchen Nicaraguaner*innen ebenfalls Schutz vor politischer Verfolgung. Nach Angaben der Regierung Costa Ricas beantragten 23.000 Nicaraguaner*innen seit Ausbruch der Proteste Asyl. Die offiziellen Zahlen geben aber nur einen Teil der tatsächlich Geflüchteten an.
23.000 Menschen haben in Costa Rica Asyl beantragt
Auch innerhalb Nicaraguas gibt es viele Menschen, die sich in anderen Landesteilen verstecken. Die UN-Flüchtlingsorganisation UNHCR ruft zu internationaler Solidarität mit den Staaten auf, die seit April 2018 Geflüchtete aus Nicaragua aufnehmen. Inzwischen ist es für politisch Verfolgte jedoch fast unmöglich, nach Costa Rica oder Honduras zu fliehen, da schon der Weg zur Grenze gefährlich ist. Der Student und LGBT-Aktivist Bayardo Siles aus Matagalpa wurde beispielsweise am 9. August auf dem Weg zur Grenze zu Costa Rica verschleppt. Feministische Gruppen forderten Ortega auf, seine physische und psychische Integrität zu wahren und ihn sofort freizulassen. Die Polizei hielt Siles für zehn Tage in drei verschiedenen Gefängnissen, darunter El Chipote, gefangen. Nach seiner Entlassung gelang es Siles nun Ende August aus dem Land zu fliehen.
„Die Situation ist so schwerwiegend, dass wir uns verbünden müssen, um der grausamen Diktatur zu entgegnen“, sagt María. Das breite Bündnis der Zivilgesellschaft mit der Unternehmer*innenschaft und der Kirche zieht immer wieder Kritik auf sich. Ortegas Unterstützer*innen im In- und Ausland sehen darin den Beweis für die Steuerung oder Vereinnahmung des Protests durch die nationale Bourgeoisie, das internationale Kapital und den Imperialismus. Es wäre allerdings ignorant, nicht anzuerkennen, dass die zivilgesellschaftlichen Akteur*innen ihrerseits ebenfalls strategisch und überlegt mit den Bündnissen umgehen. Sie entscheiden bewusst, welche Allianzen sie zu welchem Zweck (nicht) eingehen.
Edith macht sich keine Illusion, wer aus den Protesten gestärkt hervor gehen wird. „Die Katholische Kirche wird ihre Agenda hervor holen. Das wird ein Rückschlag für die ganze feministische Bewegung“, sagt sie. Auch María weiß, dass die Kirche gestärkt aus dem Konflikt hervorgehen wird, da sie angesichts der Regierungsgewalt von der Bevölkerung als Schutzmacht wahrgenommen wird.
Die katholische Kirche wird gestärkt aus den Protesten hervorgehen
Aus jahrelangem linken, anti-kapitalistischen und feministischen Kampf wissen die feministischen Gruppen sehr genau, dass sie sich mit der Rechten nicht verbünden dürfen. Deren ökonomische Interesse gehen immer auf Kosten des weiblichen Körpers. Die Feminist*innen lassen sich nicht leicht täuschen und vereinnahmen. Aufgrund ihrer herrschaftskritischen Analysen kritisierten sie bereits vor dem 18. April Ortega-Murillo, Unternehmer*innen und die Kirche aufs Schärfste. María findet es allerdings makaber, wenn Linke Ortegas Regierung immer noch für links halten und meinen, die Diktatur Ortegas sei weniger schlimm als eine rein neoliberale Regierung.
Ende August verkündete das zivilgesellschaftliche Bündnis Alianza Cívica por la Justicia y Democracia, dass es den nationalen Dialog wieder aufnehmen wolle. Das Bündnis, in dem Organisationen von Studierenden, Bäuer*innen, Unternehmen und Kirche zusammenkommen, hatte sich im vergangenen Mai angesichts der Krise gegründet. Liberale und rechte Parteien versuchen Teil dieser Gespräche zu werden, wogegen es Widerstand gibt. Azahálea Solis, Feministin und Mitglied der Allianz, kommentierte gegenüber der Presse, die politischen Parteien sollten nicht davon ausgehen, ihre alte Politik fortführen zu können.
Bei allen Diskussionen darum, wie es weitergeht, wiederholen verschiedene Nicaraguaner*innen immer wieder, dass das Wichtigste sei, zunächst Ortega-Murillo und die verheerende Gewalt zu stoppen. Danach könne erst richtig begonnen werden sich neu zu organisieren. María und Edith wissen, dass die Herausforderungen für den Feminismus groß sind.
* Namen der Personen und Gruppen wurden aus Sicherheitsgründen geändert bzw. nicht genannt.