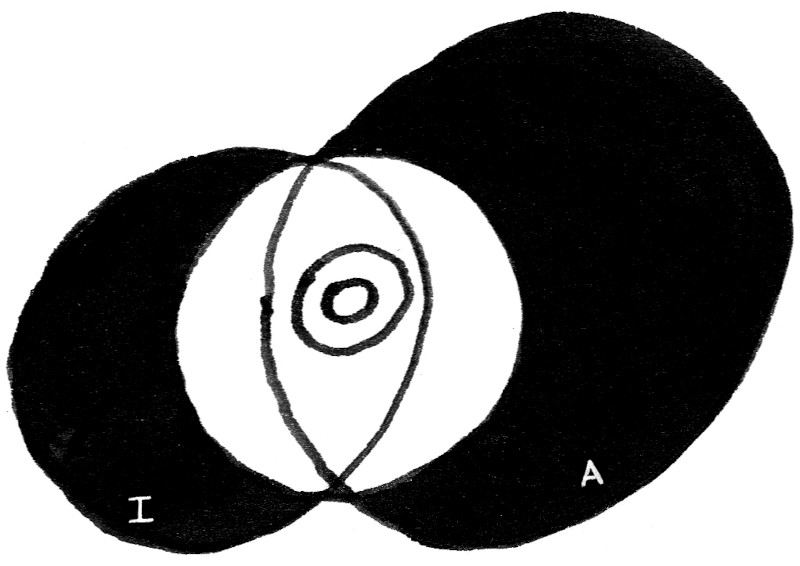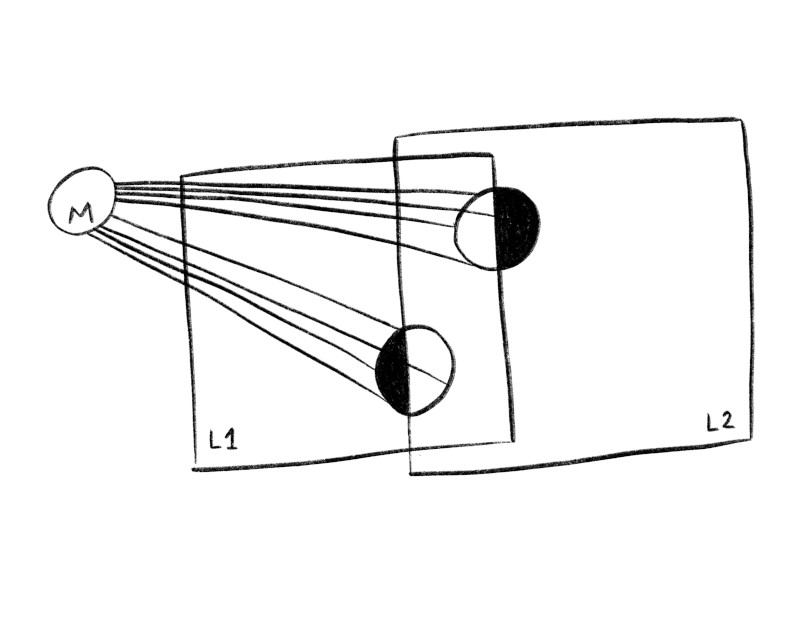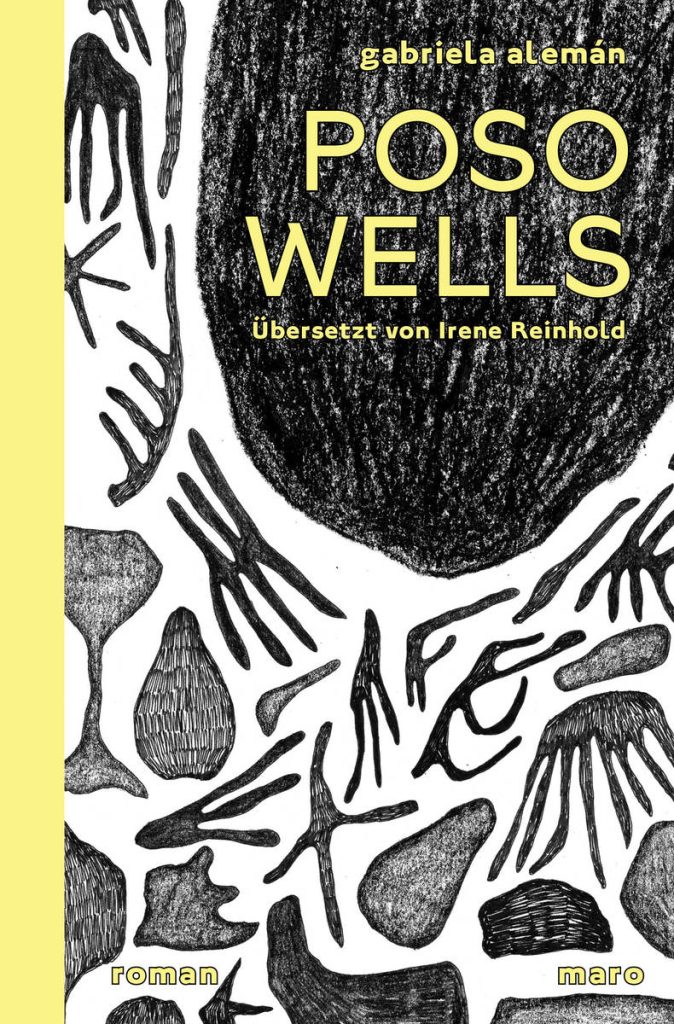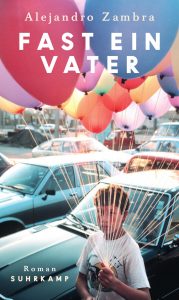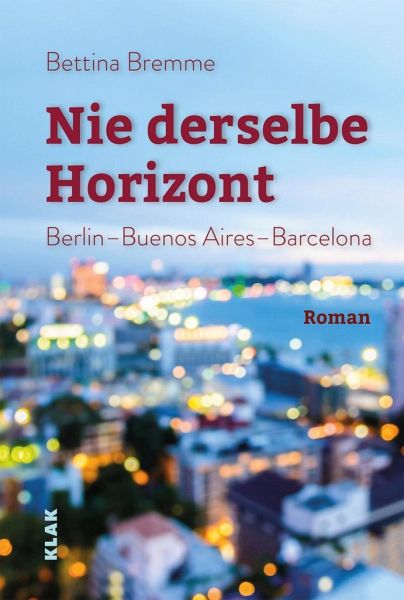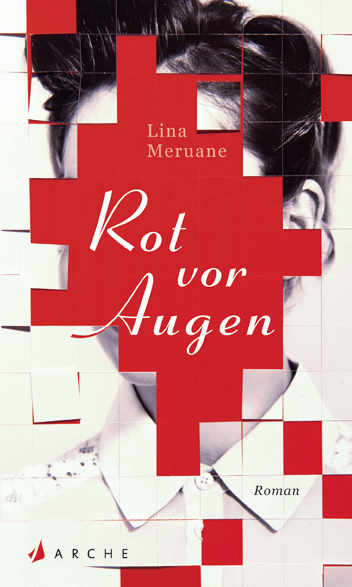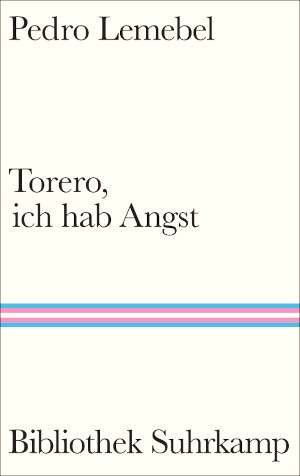
Der chilenische Autor Pedro Lemebel ist eine Ikone der lateinamerikanischen und der queeren Literatur. Passend zum Jahr des Gedenkens an den Beginn der Militärdiktatur Augusto Pinochets wurde nun Lemebels einziger Roman Tengo miedo, torero in der Übersetzung von Matthias Strobel neu verlegt. Lemebel gab vor allem durch Chroniken Einblicke in das Leben auf den Straßen der chilenischen Klassengesellschaft. In diesem Werk, das 2001 auf Spanisch veröffentlicht wurde, nimmt er uns mit in die Welt „der Tunte von der Front“ (Original: „la loca del frente“), die im Jahre 1986 in einem heruntergekommenen, aber immer sauberen und mit bestickten Tischdecken dekorierten Haus in Santiago lebt. Mit jenen hübschen Deckchen werden auch die Revolutionsmaterialien des jungen Carlos und seiner Mitkämpfer*innen der patriotischen Front Manuel Rodríguez bedeckt, die die Protagonistin aus Verliebtheit in ihrem Haus versteckt. Dort trällert sie kitschige Boleros und gibt sich ihren Liebesfantasien hin, während sie auf Carlos´ nächsten Besuch wartet. Der ist allerdings vor allem damit beschäftigt, mit seiner Gruppe ein Attentat auf den Diktator zu planen – eine wahre Begebenheit, um die herum sich die Geschichte der Romanfiguren entspinnt. Über die meist kurzen Begegnungen hinaus entwickelt sich die Beziehung zwischen Carlos und der Protagonistin vor allem in deren Traumwelt weiter. Obwohl sich mit der Zeit eine intimer und uneindeutiger werdende Freundschaft zwischen beiden aufbaut, bleibt Carlos in der begehrten Form doch unerreichbar. Einsamkeit und unerfüllte Hoffnungen der „Tunte von der Front“ schimmern immer wieder durch. Lemebel schafft es, die Lesenden mit ausgeschmückten sprachlichen Wendungen und extravaganten Formulierungen mit in die schmachtenden Fantasien der Hauptfigur zu nehmen und das melancholische Ziehen queerer Sehnsucht nach der Romanze der Boleros zu vermitteln.
Parallel zur Liebesgeschichte entwickeln sich die politischen Ereignisse sowie die politische Haltung der Protagonistin selbst weiter. Während diese zu Beginn des Romans noch nichts von den Aktivitäten der Studierenden wissen möchte, fühlt sie mit der Zeit immer mehr Verbindung zu deren Kampf und beginnt in kleinen alltäglichen Akten der Rebellion selbst Haltung anzunehmen. Aus ihrer Perspektive auf die Revolutionär*innen spricht dabei jedoch auch Lemebels zu Lebzeiten immer wieder angebrachte Kritik am freudlosen, maskulinistischen Aufopferungskult und Macho-Gehabe in kommunistischen Gruppen. Dem entgegen setzt der Autor den aufmüpfigen Ton der „Tunte von der Front“. Auch Szenen der frustrierten Ehe des Diktators und seiner Gedankenwelt werden in einer parallel verlaufenden Erzähllinie immer wieder eingeflochten und münden als Höhepunkt im Aufeinandertreffen der beiden Linien am Tag des Attentats.
Lemebel nutzt Sprache und Genrekombinationen auf seine eigene Weise, verknüpft kitschige Ausdrücke mit pornografischen Szenen, Liebesgeschichte mit Politdrama. Wer die spanische Version kennt, muss sich zunächst an den ungewöhnlichen Sprachgebrauch, der nicht leicht ins Deutsche zu übertragen ist, jedoch gut von Strobel übersetzt wurde, gewöhnen. Es lohnt sich – Torero, ich hab Angst wird ganz zu Recht als Meisterwerk bezeichnet.