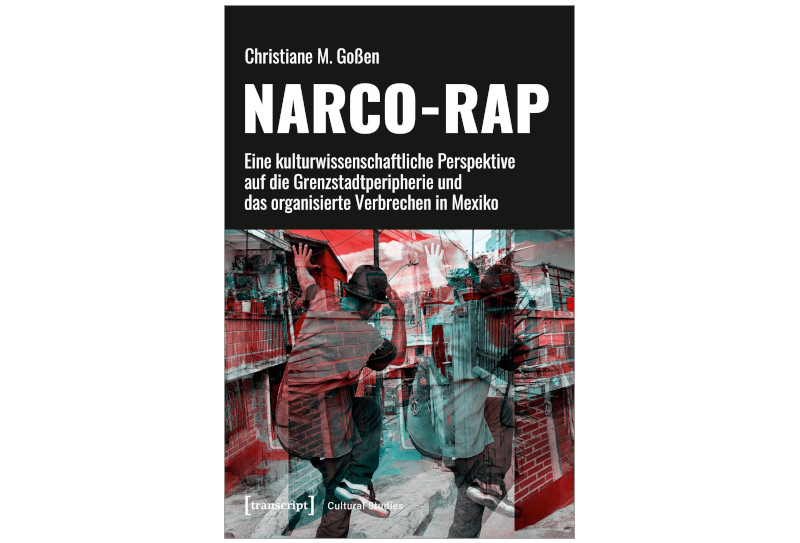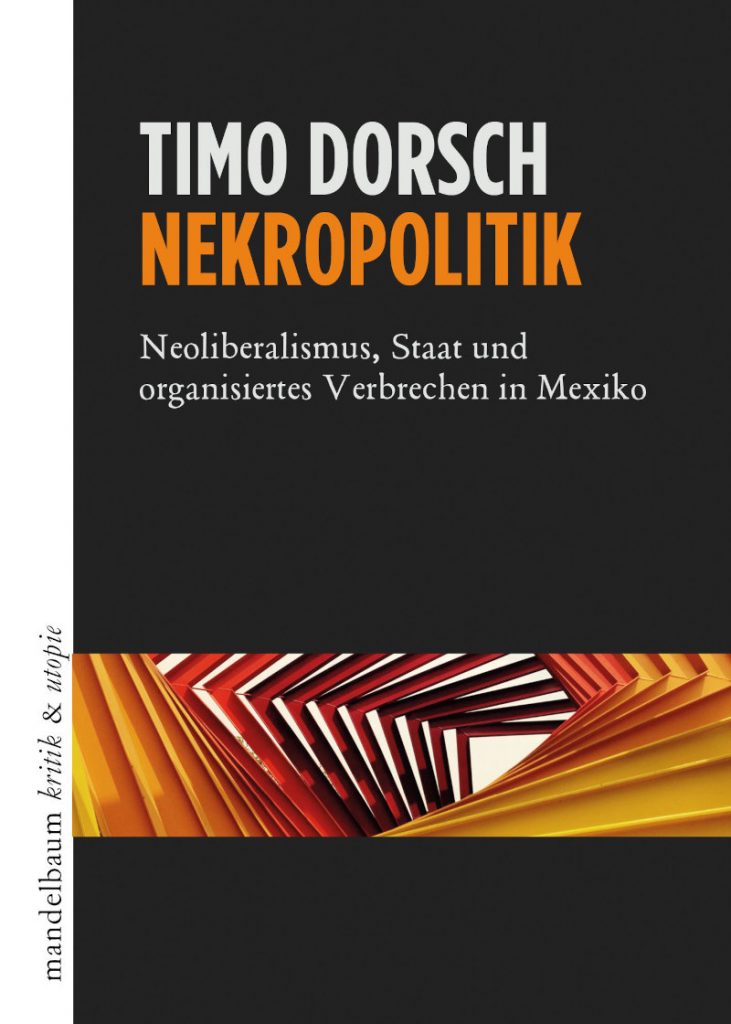Es ist das 18. Theaterprojekt der Reihe „Aus den Akten auf die Bühne“ der Bremer Shakespeare Company, die einem breiten Publikum, didaktisch aufgearbeitet, Geschichtsforschung zugänglich macht. Für eine szenische Lesung zum chilenischen Verfassungsprozess wurden unterschiedliche Dokumente zusammengetragen und ein Bild der jüngeren Geschichte Chiles bis hin zum Verfassungsentwurf von 2022 nachgezeichnet. Die im Rahmen des Projektes entstandene Textsammlung ist nun als begleitendender Sammelband erschienen. Die Herausgebenden – die Historikerin Eva Schöck-Quinteros und der Rechtswissenschaftler Heiner Fechner – haben hierfür die Beiträge und Quellen gebündelt und geordnet. In chronologischer Reihenfolge gibt die Sammlung auf 620 Seiten intensive und teils sehr detaillierte Einblicke in die wechselhafte Geschichte Chiles und seiner Verfassung seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Insbesondere die spezielle Beziehung zu Deutschland spielt bei der Auswahl der Themen eine besondere Rolle. Die Auswahl der gesammelten Dokumente deckt mit Reden, Anhörungen, Briefkorrespondenzen und Manifesten ein breites Spektrum von Textsorten ab. Nicht zuletzt einer engen Zusammenarbeit mit Chilen*innen ist der Reichtum dieses Sachbuches an Perspektiven aus erster Hand zu verdanken.
In seiner Struktur folgt das Buch einem übersichtlichen Aufbau. In der überwiegenden Anzahl der Kapitel führen die Autor*innen in das jeweilige Thema ein und beleuchten wesentliche Aspekte. Daran anschließend folgt eine Auswahl vertiefender Quellen, die den Leser*innen die Möglichkeit geben, den Kontext einzelner Argumente besser nachzuvollziehen. In einigen Kapiteln sprechen die Quellen sogar für sich selbst: Im Kapitel „Vom Estallido Social zum Verfassungskonvent (2019-2022)“ wird ein erklärender Beitrag dadurch ersetzt, dass die Zusammenstellung der Dokumente in ihrer zeitlichen Abfolge eine eigene Geschichte erzählt.
Scheinen die einzelnen Kapitel thematisch zunächst wenig miteinander zu tun haben – etwa das Massaker an der Schule Santa María de Iquique (1907), der Einfluss feministischer Bewegungen auf den Demokratisierungsprozess oder der Extraktivismus in Chile – entsteht durch den Blick auf den Verfassungsentwurf von 2022 eine Verbindung. Die Texte zeichnen ein Bild davon, was Chile und seine Bevölkerung über viele Jahrzehnte bewegt und geprägt hat und wie sich dies auf die damaligen Verfassungen bis hin zum jüngsten Entwurf für eine neue Verfassung ausgewirkt hat. Die Gewalt des Staates gegenüber seiner eigenen Bevölkerung ist ein wiederkehrendes Thema: Vom Massaker von Iquique (1907) bis zur Diktatur unter Pinochet wird so die herausragende Rolle der Menschenrechte für eine zukünftige Verfassung deutlich. Der Band schließt mit einem Auszug aus dem jüngsten Verfassungsentwurf im letzten Kapitel.
Damit gelingt die Idee, Autor*innenbeiträge und zugehörige Quellen gemeinsam zu präsentieren. Somit wird der historische Kontext eines Themas intensiver erlebbar. Insbesondere Geschichtsliebhaber*innen kommen mit dem Sammelband also auf ihre Kosten.
Der Ausgang des verfassunggebenden Prozesses bleibt letztendlich ungewiss. Das Buch wird diesem Umstand gerecht, indem der Titel als Frage formuliert ist. Die Leser*innen können sich zu dieser Frage am Ende selbst eine Meinung bilden und den weiteren Lauf der Geschichte verfolgen.