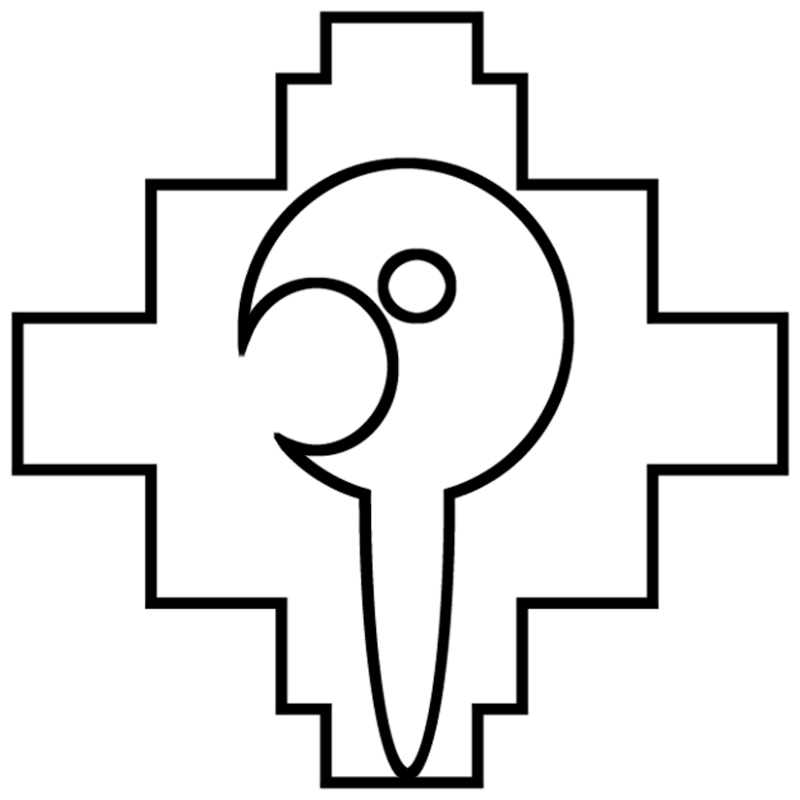Der Kampf um Land als Terrorismus
Im “Fall der Lonkos” ging die Justiz mit Antiterrorgesetzen gegen Indigene vor
Seit 500 Jahren kämpfen wir Mapuche und dieser Kampf wird nie aufhören.“ Das rief Pascual Pichún jenen rund 100 Menschen zu, die ihn bei seiner Freilassung vor dem Gefängnis in Traiguén, in der südchilenischen Region Araucanía, begrüßten. Das ungleiche Kräfteverhältnis in der Auseinandersetzung um die Verteilung von Grundbesitz gibt allen Anlass, Pichúns Prophezeiung Glauben zu schenken. Verarmte Mapuche, die von kaum mehr als einem Hektar Land mehrere Familien ernähren müssen, sehen sich einflussreichen GroßgrundbesitzerInnen und großen Forstunternehmen gegenüber, die für den Weltmarkt produzieren. Der Fall von Aniceto Norín und Pascual Pichún, in ihrer Sprache Lonkos (Oberhäupter) zweier Gemeinden der Araucanía ist beispielhaft für dieses Machtgefälle.
Wenige Tage nach einem Brandanschlag auf Haus und Forstbestand eines Großgrundbesitzers im Dezember 2001 waren Norín und Pichún als mutmaßliche Täter ausgemacht und verhaftet worden. Weil die Brandstiftung von der Staatsanwaltschaft als „terroristisches Delikt“ eingestuft wurde, kam ein Antiterror-Gesetz zur Anwendung, das die Rechte von Angeklagten im Prozess massiv einschränkt. Im April 2003 wurden die Beiden jedoch zunächst freigesprochen. „Trotz aller angebrachten Zweifel“ an der Unschuld der Angeklagten hätten die vorgebrachten Beweismittel nicht ausgereicht, um die RichterInnen von deren Schuld zu überzeugen, gab Richter Waldemar Koch bei der Bekanntgabe des Urteils zu verstehen. Ein Freispruch der Staatsanwaltschaft überraschte NebenklägerInnen und Angeklagte gleichermaßen. So wurde das Urteil von den FürsprecherInnen der Mapuche als „historisch“ gefeiert. Doch die Freude währte nicht lange. Auf den Freispruch folgte wenig später die Annullierung des Urteils. Der Oberste Gerichtshof verwies auf „formale Mängel“, entscheidende Beweise seien nicht angemessen überprüft worden. Für die Revision des Verfahrens gab es plötzlich neue ZeugInnen, deren belastende Aussagen unter Berufung auf das Antiterrorismus-Gesetz anonym aufgenommen wurden. Im September 2003 wurden Aniceto Norín und Pascual Pichún zu einer Haftstrafe von jeweils fünf Jahren und einem Tag verurteilt, wegen terroristischer Brandstiftung und illegaler Vereinigung. Seit dem Ende der Diktatur war das Antiterrorismus-Gesetz kaum angewandt worden.
Mächtige Nachbarn
Dass Pichún und Norín bereits ein halbes Jahr nach dem Freispruch in denselben Anklagepunkten für schuldig befunden wurden, führen BeobachterInnen des Falles, wie Luis Narvaéz und Maria Alonso von der Online-Tageszeitung Azkintuwe, auf den enormen Einfluss von Juan Augustín Figueroa zurück. Sie bezeichnen den Besitzer des abgebrannten Anwesens als den „unantastbaren Patron des Südens“. Der Verdacht, dass Figueroa im Laufe des Verfahrens nicht vollkommen untätig geblieben ist, scheint nicht so weit hergeholt. Als Ex-Agrarminister der Aylwin-Regierung (1990-1994) und zu Zeiten des Verfahrens Mitglied des chilenischen Verfassungsgerichts, pflegt er berufliche und private Kontakte zu vielen hohen VertreterInnen des chilenischen Justizapparates. Figueroa weist den Vorwurf, den Prozess beeinflusst zu haben, weit von sich. Seine Verbindungen zum Justiz- und Staatsapparat machen ihn jedoch zu einer Reizfigur in den Auseinandersetzungen um das Land südlich des Flusses Bío-Bío. Dass er zudem als Großgrundbesitzer, der seinen Besitz unter Pinochet noch erweiterte, gleichzeitig Präsident der Fundación Pablo Neruda ist, wird in der chilenischen Linken als Groteske empfunden. Die Witwe Pablo Nerudas hatte Aída Figueroa, eine Freundin des Dichters, und ihren Bruder, den Anwalt Juan Augustín als Mitglieder der Stiftung bestimmt. Letzterer leitet die Stiftung seit nunmehr 20 Jahren. Und so verwaltet der Großgrundbesitzer, der so vehement und mit allen Mitteln seine Eigentumstitel an Mapuche-Territorium verteidigt, bis heute den Nachlass eines Schriftstellers, der Zeit seines Wirkens für die Rechte der Indigenen einstand.
Kritik am Antiterrorgesetz
Doch dies ist nicht der einzige Widerspruch, den sich Figueroa leistet. „Als Agrarminister hat er sich gegen das Antiterrorismus-Gesetz ausgesprochen, später war er der Erste, der dafür sorgte, dass es wieder angewandt wird“, empört sich Pascual Pichúns Sohn Rafael, der ebenfalls eine Haftstrafe wegen „terroristischer Bedrohung“ absitzt.
Internationale Organisationen kritisieren das Antiterrorismus-Gesetz mit aller Schärfe. Human Rights Watch sieht darin einen klaren Verstoß gegen die Internationale Konvention über zivile und politische Rechte der UNO und gegen die Menschenrechtskonvention der Organisation Amerikanischer Staaten. Verträge, die auch Chile unterzeichnet hat.
Mitte der 80er Jahre hatte Pinochet das Gesetz erlassen, um die politische Verfolgung von RegimegegnerInnen zu legitimieren. Unter Präsident Patricio Aylwin wurde es reformiert, um das Gesetz, so das vorgebliche Ziel, an internationale Menschenrechtsstandards anzupassen. Dabei wurde Brandstiftung neu in den Anwendungsbereich des Gesetzes übernommen. Seither kann selbst das Anzünden von unbewohnten Gebäuden oder gar Wäldern, Büschen und Zäunen als terroristischer Akt gewertet werden.
Die Anwendung des Gesetzes hat schwerwiegende Folgen für Angeklagte wie Verurteilte. Am schärfsten kritisieren Menschenrechtsorganisationen die Aushöhlung des Rechtes auf ein ordentliches Verfahren, insbesondere durch die Anhörung von „Zeugen ohne Gesicht“, die Angeklagte anonym belasten können. Auf solche Zeugenaussagen stützen sich große Teile der Urteilsbegründung im Fall von Norín und Pichún. Darüber hinaus können des Terrorismus Verdächtigte wesentlich länger festgehalten werden, ohne einem Richter vorgeführt zu werden, als im Normalfall möglich. Die gesamte Kommunikation der Angeklagten darf zudem überwacht und abgehört werden, mit Ausnahme der Kontakte zu den AnwältInnen.
Über das Gesetz hinaus beklagen Mapuche und Menschenrechtsorganisationen vor allem das brutale Vorgehen der staatlichen Sicherheitskräfte. Landbesetzungen werden oft mit äußerster Gewalt und unter Einsatz schwerer Waffen aufgelöst. Höhepunkt dieser Gewaltexzesse war die Ermordung des siebzehnjährigen Mapuche Alex Lemún im November 2002, der während einer Landbesetzung gegen ein Forstunternehmen von einem Polizisten erschossen wurde.
Im Fall der beiden Lonkos kam sogar Kritik von UN-Seite: Taten, die im Zusammenhang mit sozialen Auseinandersetzungen um Land begangen würden, dürften nicht als terroristische Akte gewertet werden, so UN-Menschenrechtsbeobachter Rudolfo Stavenhagen im Jahr 2003. Das Urteil gegen Norín und Pichún müsse revidiert werden.
Der chilenische Staat hat seinen Umgang mit den Konflikten im Süden des Landes jedoch kaum geändert. Hatte der ehemalige Präsident Ricardo Lagos im Jahr 2002 noch gefordert, den Rechtsstaat „mit harter Hand“ zu verteidigen (s. LN 335), versprach die heutige Präsidentin Michelle Bachelet noch im Mai letzten Jahres, das Antiterrorismus-Gesetz würde unter ihrer Regierung nicht mehr angewandt. Auch konventionelle Gesetze böten ausreichend Möglichkeiten gegen Gewaltakte vorzugehen. Eine Annulierung des Gesetzes stellte sie hingegen nicht in Aussicht.
Auch noch gegen Ende seiner Haft hatte Pascual Pichún seine Unschuld an der Brandstiftung des Hauses Figueroas beteuert. Er gab jedoch zu verstehen, die Armut der Mapuche ließe ihnen „keine andere Wahl als den Kampf“ und kündigte an, weiterhin für ihre Rechte zu streiten, „koste es was es wolle“.