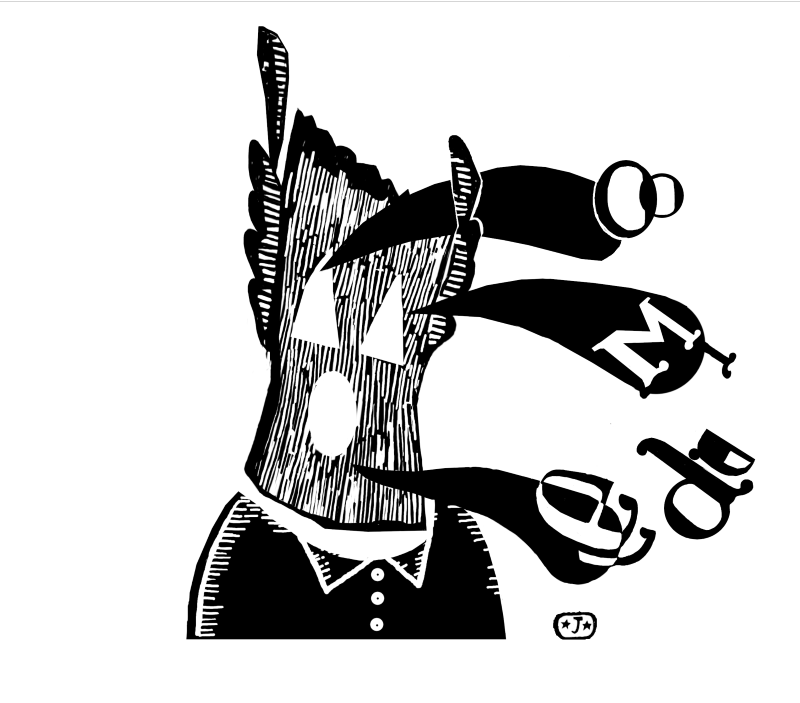Die Unfähigkeit wahrzunehmen
Todesschwadrone und Gesellschaft in Brasilien
Ein italienischer Anthropologe reist zu Studienzwecken ins Amazonasgebiet. Zunächst landet er in Sao Paulo, um an der dortigen Universität an einer Tagung teilzunehmen. Während der Tagung wird der Vize-Rektor der philosophischen Fakultät (Prof. Rui Coelho) verhaftet und eine junge Soziologin der Universität (Yara Yavelberg) von der Polizei verschleppt und ermordet. Verantwortlich: Die polizeilich-militärische Organisation OBAN mit Sitz in der Rua Tutóia in Sao Paulo.
Der Italiener bricht sein Amazonas-Vorhaben ab. Er bleibt in Sao Paulo und beginnt, über Repressionen und Todesschwadrone zu recherchieren. So geschehen 1971.
Das 350 Seiten starke Buch des Anthropologen Ettore Biocca über den Staatsterrorismus in Brasilien erschien 1974 unter dem Titel “Strategia del Terrore” bei dem angesehenen italienischen Verlag De Donato und beeindruckt noch heute durch die detaillierten Beschreibungen der Entstehungsgeschichte von Todesschwadronen in Brasilien. Biocca verknüpft die Geschichte der staatlichen und halbstaatlichen Repression mit einer Analyse des Systems der sozialen Ungerechtigkeit in Brasilien. Am 5.9.1972 berichtet amnesty international zum ersten Mal ausführlich über den systematischen Einsatz von Folter und Todesschwadronen in Brasilien. Das zweite Russel-Tribunal fand sich im Frühjahr 1974 in Rom zusammen, um die internationale Aufmerksamkeit auf den Staatsterrorismus in Lateinamerika zu lenken; auch über Brasilien wurde ausführlich und dramatisch berichtet.
Die Anfang der 70er Jahre in Sao Paulo aufgebauten polizeilichen Killerkommandos bestehen noch heute. Zum Teil sind es dieselben Chefs, dieselben Namen, dieselben Waffen, die die staatliche Mordmaschine betreiben. Der einzige Unterschied: Ihre Anzahl hat sich ungefähr vervierfacht (von 250 auf über 1000 Mann), und ihre nach militärpolizeilicher Statistik jährlich begangenen Morde haben sich ebenfalls ungefähr vervierfacht. (1992 haben sie in der Stadt Sao Paulo 1470 Personen erschossen.)
Ein zweiter, allerdings gesellschaftspolitischer Unterschied springt ins Auge: Heutzutage bricht kein Professor deswegen seine Forschungsreise ab. Kein internationales Tribunal klagt an. Keine wissenschaftlichen Bücher werden darüber geschrieben. Keine Schriften mit politisierender Absicht dazu abgefaßt. Keine großen Kampagnen entfesselt.
Mörder machen Medien
Alle wissen, daß es in Brasilien Morde an Straßenkindern gibt und daß der brasilianischen Militärpolizei der Colt locker sitzt. Weltweit wird über Massaker berichtet – als Skandal. Es gibt sogar brasilianische Radiosender und Tageszeitungen, die ausschließlich über Mord und Totschlag – auch von Todesschwadronen – berichten. Sie sind in der Hand der Hintermänner der Todesschwadrone, die Repression organisiert die Information gewissermaßen selbst.
Aber über die Kontinuität des Apparats berichtet niemand. Liegt das daran, daß die Stadtguerilla, gegen die damals die Killerkommandos aufgebaut wurden, nicht mehr existiert? Daß die politische Opposition von heute nicht mehr von den Spezialeinheiten attackiert wird? Entsteht eine gesellschaftliche Unfähigkeit wahrzunehmen, was an den Rändern der offiziellen Gesellschaft geschieht? Wächst die Welt der Ausgeschlossenen, der Armen, der Billiglohnverdienenden, der Wohnungslosen – wird dieses soziale Universum zu einer neuen terra incognita?
Altes Thema – Neue Verpackung
Gegen diese Annahme spricht, daß der investigative Journalismus Brasiliens zu diesem Thema jüngst einen Bestseller landen konnte: Claudio (“Caco”) Barcellos, ein Reporter des Medientrusts “Globo”, schrieb einen Kriminalroman unter dem Titel “ROTA 66. A história da polícia que mata”.(*) Der Titel spricht für sich: In Brasilien weiß jeder, daß die Abkürzung ROTA 66 für eine berüchtigte Killereinheit der Militärpolizei in Sao Paulo steht. Ihre Entstehungsgeschichte seit 1970, ihre Praktiken, statistische Informationen über ihre Einsätze und Morde, ihre politischen Hintermänner, ihre Deckung und Einbindung in den gesamten polizeilichen und militärischen Apparat finden sich – nicht in einer politischen Analyse, nicht in einer juristischen Anklageschrift, nicht in einer soziologischen Abhandlung über Repression und Armut – sondern in einem Kriminalroman. Dem Bestseller-Erfolg schloß sich keine Menschenrechtskampagne und keine staatsanwaltliche Ermittlung an. Für die sofortige Abschaffung dieser Spezialeinheit hat bisher keine Demonstration stattgefunden.
Ein Kriminalroman: Zum einen bietet dem Autor dieses Genre Möglichkeiten, auch persönliche Geschichte aufzuarbeiten. Als Jugendlicher lebte Caco Barcellos Anfang der 70er Jahre in der Kultur der Gegenbewegungen, die gerne nächtliche Autorennen in der Stadt veranstalteten, häufig kifften, die Rolling Stones hörten. ROTA 66 brachte den Tod auch in diese Gruppen mittelständischer Herkunft: So zieht sich das Band der Reportage von diesen frühen Erfahrungen bis zu dem Versuch einer journalistisch gefärbten Bestandsaufnahme dessen, was aus dieser Killereinheit heute geworden ist. Am gelungensten sind sicherlich die “politischen” Passagen: Dort verläßt Caco Barcellos die Krimi-Handlungsstränge und berichtet, resümiert, klagt an. So festigt sich der Eindruck, daß hier etwas erzählt wird, für das es im Grunde kein literarisches Genre mehr gibt. Ein Hintergrundaufsatz zum Thema würde keine Beachtung finden, eine große Aufmachung, eine Enthüllung wäre morgen vergessen. Also wird verpackt in die Form des Krimis.
Und damit ist die andere Seite angedeutet: Ein Kriminalroman ist Lektüre aus einer anderen Welt, ähnlich wie Science Fiction. Ein Krimi entspricht der Schnellebigkeit unserer Zeit. Der Zugewinn an Erkenntnis wird gesellschaftlich nicht umgesetzt. Der Bestseller, die kritisch-kriminalistische Aufarbeitung, gehört gleichermaßen zum Bestehenden wie “die Polizei, die tötet”.
Jeder weiß von den Todesschwadronen. Man weiß, welche Autos sie fahren. Man kennt die Namen der Veranwortlichen. Die Einsatzzentrale ist bekannt. Aber über die sozialpolitischen Gründe ihrer Kontinuität, über die systemhaften Ziele ihrer Einsätze, über ihre gesellschaftliche Funktion wird nicht gesprochen, nicht geschrieben, dagegen wird nicht gehandelt.
Der Krimi von Claudio “Caco” Barcellos ist zu empfehlen. Dem Autor gebührt Respekt und Schutz – er hat Todesdrohungen erhalten. Der Zugewinn an kritischer Erkenntnis ist beispielhaft.
Doch die Existenz dieses Buchs weist darauf hin, daß die herrschende Gesellschaft Grenzen im eigenen Lande aufzieht: Berichtet wird über die andere Welt der Ausgeschlossenen, der bis aufs Blut Ausgebeuteten, der Verhungernden, der von Killerkommandos Bedrohten nur noch in den Formen des schnellen Vergessens: Skandalblätter, Krimis und Massakermeldungen werden zur Abschottung dieser neuen terra incognita beitragen.
Caco Barcellos berichtet, daß er sich oft als Reporter in lebensbedrohlichen Situationen befunden hat: Er eilt zum Ort des Verbrechens in die Favelas und wird von einer aufgebrachten Menge empfangen. Er schreibt, die Favelabewohner würden die Reporter regelmäßig mit den Polizisten “verwechseln”, die dort als Killerkommandos gewütet haben, und es würde unendliche Mühe kosten, sie zu überzeugen, auf welcher Seite die Reporter in Wirklichkeit stehen. Vielleicht ahnt Caco Barcellos aber auch, daß die Herumstehenden in der Regel richtig erkannt haben, aber in der Situation ohnmächtig sind, weil sie keine Stimme in der Medienwelt haben. Im Grunde arbeitet sich Barcellos an diesem Widerspruch ab, und gerade das macht das Buch von ihm so lesenswert.
(*) Wörtlich: Sondereinsatzkommando (Rondas Ostensivas Tobias Aguiar) Nummer 66. Die Geschichte der Polizei, die tötet”. Sao Paulo 1992. Der deutsche Titel “Mord in Sao Paulo. Den Todesschwadronen auf der Spur”, Göttingen (Lamuv) 1994 erfaßt leider nicht die Brisanz des Originalstitels. An manchen Textstellen des Kriminalromans wäre eine freiere Übersetzung angebracht. Die assoziative Einbettung in das Großstadtleben Sao Paulos ist für das hiesige Lesepublikum ohne Erläuterungen teilweise schwer nachzuvollziehen.