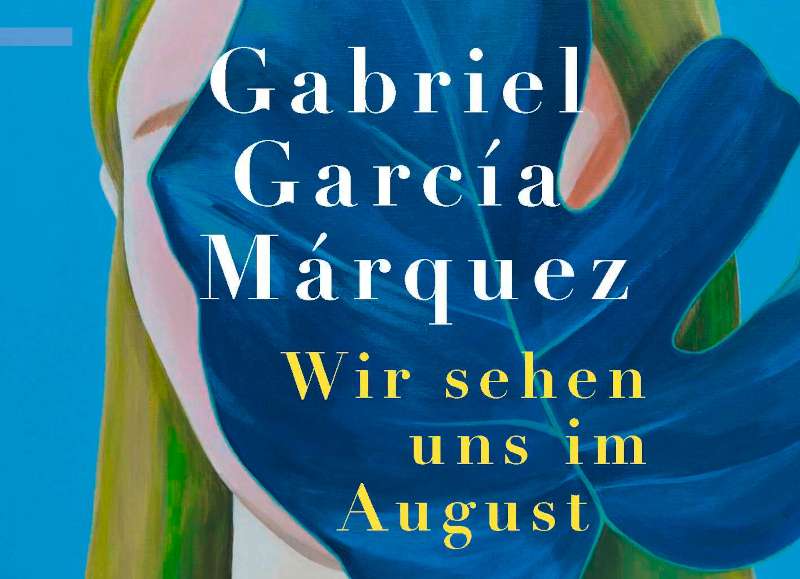Mehr als eine Liebesgeschichte
Der neue Roman von Gabriel García Márquez
“Von der Liebe und anderen Dämonen”, so der Titel des neuesten Romans vom kolumbianischen Vorzeigeschriftsteller. In seiner unverwechselbar bildreichen Sprache, in der Lebensfreude und Schwermut untrennbar miteinander verwoben sind, erzählt García Márquez die Geschichte der zwölfjährigen Sierva María de Todos los Angeles, die im Haus ihrer Eltern, dem Marqués de Casalduero und dessen Frau Bernarda Cabrera als eine Fremde heranwächst.
Von ihrem Vater vernachlässigt, von ihrer Mutter gehaßt, wächst sie unter den Sklaven des Hauses auf, deren Sprache und Religion sie verinnerlicht.
Das Unglück beginnt, als Sierva María an ihrem zwölften Geburtstag von einem tollwütigen Hund gebissen wird. Ihr Vater, der daraufhin seine Zuneigung zu ihr entdeckt, unterwirft sie in panischer Angst, seine Tochter könne erkranken, den qualvollen Behandlungen sämtlicher Wunderheiler und Quacksalber von Cartagena.
Als Sierva María sich verzweifelt wehrt, beginnt sich plötzlich der Bischof der Diözese für sie zu interessieren: hinter dem kratzbürstigen Widerstand des Kindes glaubt er, das Wirken Satans zu erkennen. Deshalb drängt er den Marqués, seine Tochter zur Beobachtung in das nahegelegene Kloster der Klarissinnen zu geben, was dieser schweren Herzens auch tut.
Das Verhängnis nimmt seinen Lauf, als der mit den Exorzismen betraute Pater Cayetano Delaura sich in das Kind verliebt, woraufhin er in eine schwere Glaubenskrise stürzt.
In dieser “zauberhaften Geschichte über irdische, himmlische und geistige Leidenschaften”, so der Klappentext, ist García Márquez, nach seinem etwas schwerfälligen Roman über den lateinamerikanischen Befreier Simon Bolívar, nun wieder zu dem zurückgekehrt, worauf er sich am besten versteht: phantastische Bilder, wie aus einem vergangenen Traum, werden zu lateinamerikanischen Realitäten verdichtet. So ist es vielleicht kein Zufall, daß auch der Ort der Handlung derselbe ist wie in García Márquez’ großem Erfolgsroman “Die Liebe in den Zeiten der Cholera”.
Der Roman ist freilich mehr, als nur die Geschichte einer unmöglichen Liebe. Anhand dieser und um sie herum zeichnet Márquez ein Bild der eigentlichen und ungleich verheerenderen Dämonen, die Lateinamerika seit dessen gewaltsamer Christianisierung vor fünfhundert Jahren heimsuchen.
Aberglaube, Unterwürfigkeit, innerkirchliche Machtkämpfe und eine entartete Religiosität zur Zeit der spanischen Inquisition erheben allüberall ihr Haupt und es ist förmlich zu spüren, wie sich die Hoffnungslosigkeit gleich einem dieser “apokalyptischen Tropenstürme” unaufhaltsam heranschiebt.
Mit journalistischem Scharfsinn fängt García Márquez Stimmungen ein und hält das Tempo in seinem Roman, der nie schleppend wirkt. Und das paßt dann auch zu den Worten, die er seiner Geschichte vorausschickt und in denen er den wahren Ursprung seines Berichtes behauptet. Er gebe doch nur eine Legende wieder, die in den Dörfern der kolumbianischen Karibik seit Jahrhunderten existiere.
Andererseits wirkt die Erzählung bisweilen übereilt, ja sogar gehetzt, als ob der Autor sich selbst vor den Dämonen, die er beschwört, nicht sicher fühle und sich zum Ende des Romans hinflüchte.
So bleibt beim Leser der Eindruck, eben erst den Entwurf eines großen und lesenswerten Romans kennengelernt zu haben.
Gabriel Garcia Marquez, Von der Liebe und anderen Dämonen, Kiepenheuer & Witsch, 224 S. 38 DM, ISBN 34620236-08