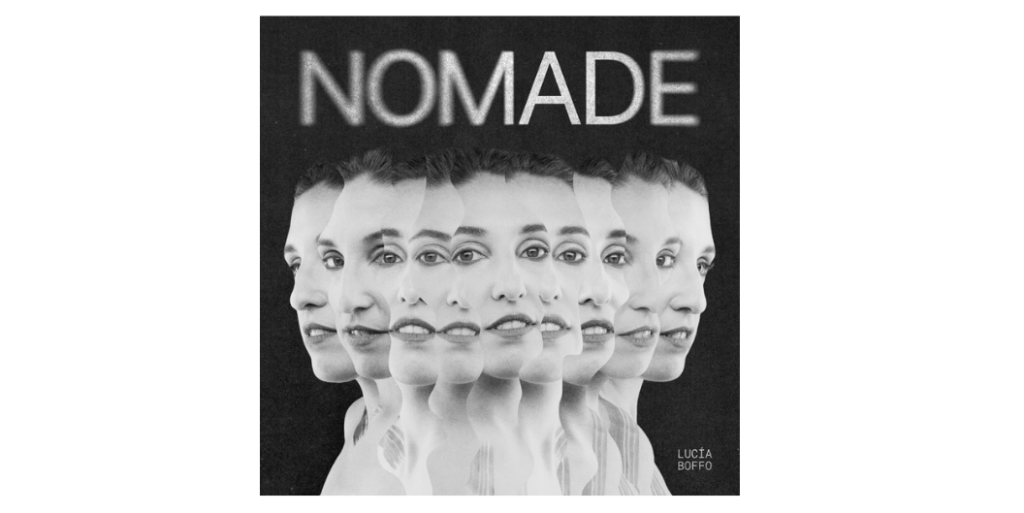Roots – Reggae – Ragga
Die Dancehall als Bindeglied der jamaikanischen Musik
Rückblickend ist Reggae vielleicht die wichtigste Musik für die 90er Jahre, schrieb Diedrich Diederichsen kürzlich in der Kölner Musikzeitschrift Spex. Gut zehn Jahre vor der Einführung des gesprochenen Wortes als musikalisches Element im Hiphop hatten jamaikanische Soundsystem-Djs begonnen, ihren oftmals illegalen Open air-Tanzveranstaltungen mehr Würze zu verleihen, indem sie das Publikum über Mikrofon anfeuerten und mit gereimten Einlagen und Wortspielen unterhielten. Deshalb heißen die Rapper auf Jamaika bis heute “Djs” oder “DeeJays”.
Etwa zur gleichen Zeit hatte der Studioingenieur King Tubby festgestellt, daß sich auf dem einfachsten Zweispurgerät die erstaunlichsten Effekte erzielen lassen, wenn man die Rhythmusspur, den sogenannten Riddim, und die Stimme der Sänger wieder trennt und mit Echos, Delays und anderen Geräten bearbeitet, um sie dann wieder neu zusammenzusetzen. So ließen sich immer wieder neue Dub-Versionen eines Riddims erzeugen und bei Livedarbietungen auf Soundsystems mehr Platz für das “Toasting” der DeeJays schaffen, indem der Gesang nach zwei Takten in der Echokammer verschwand und Baß und Schlagzeug in den Vordergrund traten.
Darin kann man natürlich die Blaupause aller zeitgenössischen schwarzen Musik von Rap bis zu den elektrischen House-, Techno- und Drum & Bass-Beatdekonstruktionen entdecken, die zunehmend die Hierarchien zwischen Rhythmus, Songstruktur, Geräusch und Stimme auflösen. Während diese Genres inzwischen in einer transnationalen Kulturindustrie zirkulieren, scheint Reggae ungleich stärker an den dialektischen Widerpart der Globalisierung, an die ungewollte Lokalisierung gebunden zu bleiben – kulturell wie ökonomisch.
Während ständig Neu-Aufnahmen auf so hervorragenden Labels wie Blood & Fire und Pressure Sounds erscheinen und monatlich Einblicke in die Verdienste des 70er Jahre-Rootsreggae gewähren, scheitern alle Versuche, die DeeJay-Kultur des modernen Dancehallreggae auf dem internationalen Markt zu etablieren. Selbst Bounty Killer, einer der renommiertesten “Djs”, dessen letztjähriges Album “My Experience” den bisher avanciertesten Versuch darstellt, ohne Kompromisse ein internationales Publikum zu erreichen, ist an seiner Majorplattenfirma gescheitert.
Von einer kleinen Raggamuffin-Szene abgesehen, folgt das Reggaeverständnis außerhalb Jamaikas einer Linie, die nach dem Tode Bob Marleys abbricht. Die Rezeption durch Linke, Punks und Hippies gleicht sich und bietet Raum für politische wie touristische Authentizitätsprojektionen. Demnach ist Reggae zuallererst Rebel Music, eine Musik des Rastafarianismus, des offenen Protests. Die Entwicklungen der letzten 15 Jahre werden allenfalls als Anzeichen der Degeneration interpretiert, auf deren harten elektronischen Riddims höchstens noch dem Recht auf amerikanische Konsumgegenstände gehuldigt und dem Sexismus gefront wird.
Roots und Ragga
Auch Issac Juliens sehr wichtigem und gutem Dokumentarfilm “Darker Side of Black” über Sexismus in der Dancehall und im Hiphop liegt eine Auffassung von Dancehall Reggae zugrunde, die der populären Opposition von Roots und Ragga vertraut. Ragga erscheint dort als Ausdruck der sozioökonomischen Veränderungen, durch die die einstige Radikalität der Resignation gewichen sei und als Teil eines Entsolidarisierungsphänomens innerhalb der schwarzen Unterschicht. Der im Film interviewte Cornel West bezeichnet das unter Bezug auf ähnliche Entwicklungen im Hiphop als “Nihilismus”.
Mit dem Tod Bob Marleys 1981 habe nicht nur der Rastafarianismus seinen Einfluß auf die Musik verloren, sondern sei auch ein “bemerkenswertes soziopolitisches Experiment” zu Grabe getragen worden, so der ebenfalls interviewte jamaikanische Ex-Premier Michael Manley, “für das Bob Marley selbst als Symbol stand”.
Die Ausdrucksformen des Dancehall erscheinen aus dieser Perspektive nur als Degeneration und Zeichen einer “psychologischen Krise”. Isaac Juliens Erzähler illustriert dessen pessimistischen Ansatz in einem einleitenden Off-Kommentar: “Im Konzept der Dancehall hat der Ehrgeiz, die Welt zu verändern, keinen Platz. Dancehall ist der Soundtrack einer enggesteckten Philosophie. Auf globale gesellschaftliche Ziele wird verzichtet, man huldigt lieber dem Körperkult. Der eigene Körper ist die einzige Ausdrucksmöglichkeit, die den Machtlosen bleibt. Man modelliert sein Äußeres, wenn die Welt kein Interesse für das innere Leid zu zeigen bereit ist.”
Die Kritik des Off-Kommentars trifft nicht nur die säkularisierte Semantik der Dancehall-Kultur, sondern zugleich auch (ganz rockistisch) die Produktionsweise von Ragga als moderne Studiomusik. “Und auch die Musik klingt anders: Technische Innovationen haben die Bedeutung der Virtuosität an einem Instrument verringert. DeeJays und Rapper haben die Macht übernommen.”
Selbst der afrobritische, marxistische Kulturtheoretiker Paul Gilroy – unter dem Schock des Neo-Konservatismus der Thatcher-Ära stehend – greift auf die dominante Gegenüberstellung zurück. Dort erscheint der digitale Dancehallreggae ebenfalls unter dem Vorzeichen der Degeneration und Entpolitisierung, die in Verbindung steht mit der Auflösung der “Interpretatonsgemein-schaft” der Rastasemantik zugunsten einer Pluralität verschiedener sozialer Gruppen zu Beginn der frühen 80er Jahre (z.B. Revival des “schwarzen Christentums”, wie es mit Martin Luther King verbunden war).
Der Pan-Afrikanismus und der Bezug auf Äthiopien in der Rastasemantik hatte es nicht nur ermöglicht, individuellen und kollektiven Handlungen eine historische und philosophische Dimension zu verleihen, sondern strukturierte auch den Populismus Manleys in den 70er Jahren, der seine Wahlkämpfe mit Rootsreggae-Songs geführt hatte (so 1972 z.B. mit Max Romeos “Let The Power Fall”).
Mit der Ablösung von Manleys sozialistischem Kurs durch Edward Seagas pro-Amerikanischen, transformierte sich das Verhältnis von Politik und Musik sowohl inhaltlich wie ökonomisch. Die Verdrängung der Rastasemantik durch die DeeJay-Kultur korrelierte im internationalen Rahmen mit der Spaltung der Karrieren der älteren Reggaebands in Pop und Roots. Die moderne Dancehall-Kultur ist deshalb der Ausdruck der militarisierten Reagonomics.
“Unter Seaga”, schreibt Gilroy, “schwand der Einfluß der Sänger und Songwriter. Sie nahmen Abstand von der Revolution, die die Sprache der Rastas von ihnen gefordert hatte. Die DeeJays rückten ins Zentrum des Interesses (…) Die jamaikanischen DeeJays führten die Dancehallseite der Rootskultur weg von politischen und historischen Themen hin zu “Slackness”, rüde und oftmals beleidigende Wortspiele, die sich um Sexualität und sexuelle Differenz drehten. (…) Die Rolle und der Inhalt von Reggae veränderten sich nach 1980 deutlich. Diese Veränderung stand im Verhältnis zur Konsolidierung von Seagas Regime und der resultierenden Militarisierung des Ghettolebens. Beides drückte sich auch in der Roots-Musik und in den sozialen Verhältnissen der Soundsystemsubkultur aus, in der Schußwaffen ein immer wichtigerer Teil der Rituale wurden, mit denen die Menge ihr Vergnügen den DJs mitteilte.”
Obwohl die von Gilroy formulierten historischen Veränderungen natürlich offensichtlich sind, verwahrt er sich selbst gegen eine simple Polarisierung zwischen “reaktionären” DeeJays und “revolutionären” Sängern. DeeJaying hat sich an seinem Ausgangspunkt gerade in der Hochphase des Rastafarianismus in den späten 60ern und frühen 70ern gleichzeitig mit der Entstehung des modernen Reggae der Nach-Rocksteady-Ära entwickelt. “Ich schlage keine einfache Polarität vor, in der alle Toaster Agenten der Reaktion und alle Sänger Troubadoren der Revolution sind. Die jamaikanische DJ Tradition hat sich während der Ausbreitung des Rastafarianismus in den späten 60er und frühen 70er Jahren entwickelt. Diese beiden Aspekte der Reggaekultur interagierten und kombinierten sich auf komplizierteste Weise.”
Von der Perpektive der Kontinuität dieser beiden Aspekte her – ästhetisch als Soundsystemkultur, sozial als Kultur der Marginalisierten – läßt sich der oppositionelle Gehalt von Reggae anders als in der verlorenen oder wiedergefundenen Rastasemantk bestimmen. Dadurch werden auch die nicht ausgewiesenen Grundannahmen eines Reggaeverständnisses deutlich, das seinen Begriff von Politik allein aus der rebellischen Rhetorik der Roots-Ära speist und eine politische Lektüre der Dancehallkultur unterdrückt. Zum einen ist dies die Behauptung, daß der “klassische” Reggae seine Wurzeln ausschließlich im manifesten sozialen Protest hat, zum anderen, daß der zeitgenössische Dancehall-Reggae einen entscheidenden ideologischen Bruch mit dieser Traditionslinie markiert. Ein derartiges Verständnis vermag widerständige Momente nur in theatralischer Form auf der Ebene von Textinhalten zu erkennen.
Dancehall stiftet Kontinuität
Die jamaikanische Feministin Carolyn Cooper versucht, diese implizite Opposition zu stören, in dem sie darauf hinweist, daß der jamaikanische Begriff der “Dancehall music”, des “Dancehall Reggae”, statt des hauptsächlich in Großbritannien gebräuchlichen Neologismus “Ragga”, gerade die Kontinuität von “Reggae” und “Ragga” als “Dance music” und “Körperpolitik” stiftet. Auch der “klassische” Reggae als jamaikanische Undergroundmusik war schon immer auf seine Aufführung in den Dancehalls der damaligen Soundsystems angewiesen, war also schon immer in seiner Funktion Dancehall Musik.
Die im Tanz und in den “karnevalisierten” Kommunikationsformen der Soundsystems vollzogene Kritik des Alltagslebens setzt unterhalb der sozialrevolutionären Rhetorik an, die “Protest” als einziges definierendes Moment des “klassischen” Reggae isoliert. Der versklavte Körper, dessen Freiheit im Rootsreggae wie in der amerikanische Soulmusik noch in religiösen Paradiesen, in Derivaten des Todes, antizipiert wurde, bindet sich in der neuen sexualisierten Körperpolitik an das Leben.
Diese performative Ebene, die Cooper mit dem Begriff der “Politics of Noise” (Lärm als Politikmittel) belegt, schreibt sich immer wieder in die Texte des Rootsreggae ein. Bob Marleys berühmte Zeile “I want to disturb my neighbor” (Ich möchte meinen Nachbarn aufschrecken) aus dem Song “Bad Card” läßt sich für Cooper deshalb so als “aufregende Hymne für die Dancehallkultur: die Politik des Lärms” lesen. “Lärm”, wie er sich in den Stimmen der modernen DeeJays manifestiert, und wie er schon immer Element der Soundsystemkultur war, beinhaltet nicht nur die wörtliche Lärmbelästigung der Nachbarn, sondern als “Rhythmus des Widerstandes” eine Unterbrechung und Störung der sozialen Rhythmik des warenförmigen Alltagslebens und seiner Bedeutungsorganisation.” Du wirst bei meinem Anblick müde. Ich kann nicht aus meiner Rasse. Oh Mann, du sagtest, ich bin an deiner Stelle, und dann zogst du die “schlechte Karte” (…) Ich möchte meinen Nachbarn aufschrecken, denn ich fühle mich im Recht. Ich möchte mit meiner Disko anfangen, die Boxen voll aufdrehen in einem “Rub-a-Dub”-Stil.” Die Anspielung auf den Megawatt-Lärm läßt sich, wenn auch gegen den Strich, als mögliche historische Referenz an die Watts-Riots (Aufstand von Schwarzen in einem Stadtteil von LA) lesen und situiert den Lärm in einer diasporischen Widerstandsgeschichte, die vielfältiger ist als der Befreiungsnationalismus der Rastasemantik.
“Rub-a-Dub”
“Rub-a-dub style”, so Carolyn Cooper, “das lärmende Idiom von Bob Marleys explosiver Klassenpolitik, ist eben auch die erotische Körpersprache der DJs. “In der “rub-a-dub”-Ästhetik der Dancehall überlagern sich zwei Ausdrucksweisen und Formen des sozialen Protests: die der DeeJays ist offen sexuell und verborgen politisch, die der Sänger offen politisch und untergründig sexuell.
Die offen sexuelle Sprache der Dancehall, die freizügige Mode der Slacknesskultur, genauso wie untergründige Artikulation sozialer Kommentare durch illegitime Formen des Sprachgebrauchs (dem Signifyin, dem Andeuten, und dem “Lärm” der DeeJays) sind deshalb paradoxerweise immer wieder nicht nur Hauptgrund für das Mißverständnis und Mißvertrauen der offiziellen Kultur gewesen, sondern machen zugleich auch die Politizität des Genres aus.
Die Ausdrucksformen der schwarzen Diaspora stellen aber aufgrund ihrer Geschichtlichkeit nicht das ganz Andere der okzidentalen Rationalität oder Modernität dar, betont Gilroy gegen essentialistische Nationalisten. Sie haben sich vielmehr in einer langen Dialektik mit der westlichen Rationalität durch die schmerzvolle Erfahrung der Sklaverei und des rassistischen Terrors entwickelt, sind genauso Teil dieser Modernität wie die Diaspora.
Ein derartiges Du Bois’sches Doppelbewußtsein, zugleich Teil der kapitalistischen Modernität wie ihr Ausgeschlossenes zu sein, macht es möglich, in schwarzen Kulturen jenseits reiner Textualität antikapitalistische Momente ausweisen zu können. Im Reggaekapitel seines Buches “There Ain’t No Black In The Union Jack” (Es gibt keine Schwarzen im vereinigten Königreich), das als versiertester Versuch gelten kann, eine derartige Politizität der Soundsystemkultur beschreiben zu wollen, macht Paul Gilroy drei Punkte fest, um die sich deren inhärenter Antikapitalismus gruppiert:
1. Als Kritik des kapitalistischen Produktionsimperativs, der Arbeit, des Arbeitsprozesses und der Arbeitsteilung.
2. Als Kritik des Staates, der Herrschaftsfunktion des Gesetzes und der Polizeibrutalität.
3. Als “leidenschaftlicher Glaube an die Bedeutung von Geschichtlichkeit”, als Kritik der Unterdrückung historischer Wahrnehmung im Spätkapitalismus.
Seit der Sklaverei haben schwarze Menschen nicht nur die Gewaltsamkeit der kapitalistischen Warenproduktion auf den Plantagen der neuen Welt erfahren müssen, sondern wurden selbst als Waren gehandelt. Die Kritik an der Warenfömigkeit speist sich aus der Erfahrung der Warenförmigkeit am eigenen Leibe und die babylonische “Slavery” wurde so in der Rootsrhetorik zu deren bevorzugter Metapher der kapitalistischen Gesellschatsform. Von Burning Spears grandios-beschwörendem “Do you remember the days of slavery” – Erinnerst du dich an die Tage der Sklaverei (dessen schmerzhafter Vortragsstil klarmacht, daß es nicht um Historismus geht, sondern um die anhaltenden Bedingungen der Diaspora) über Gregory Isaacs “Slave Driver” (Jedes Mal, wenn ich den Peitschenknall höre, gefriert mir das Blut in den Adern) bis zu Buju Bantons “Work 7 to 7 but I’m still penniless. All the food upon my table Massa God bless” (Arbeit von 7 bis 7 bin ich immer noch ohne Geld, das Essen auf meinem Tisch verdanke ich meinem weißen Herren) in “Til I’m Laid To Rest”.
In der Bedeutung der Sexualität in der Slackness findet sich die Kritik der Arbeit als autonomes Begehren, in dem der Körper als Instrument der Lust und nicht der Arbeit erscheint. Die Polysemie von “Work” bzw. dem kreolisierten “Wuk” als Arbeit, aber auch Tanz und sexueller Aktivität (z.B in Lady Saws “Good Wuk”) bildet nicht nur nach Carolyn Cooper das Zentrum der Slackness, sondern auch eine Inversion des kapitalistischen Arbeitsethos, der Ökonomie von Zeit und Raum, der “World of Work and Wages” (der Welt der Arbeit und Löhne).
Waren Schwarze aus dieser Welt immer ausgeschlossen, erfährt dieser Ausschluß eine positive Umdeutung: in der Dancehall werden die dominanten Formen der Tageseinteilung zwischen Reproduktion und Arbeit umgestülpt. So erlebte ich einmal bei einem kleineren, lokalen Soundsystemdance der “Emperor-Crew” in Kingston-Harbourview, wie zur Prime Time mehrere Laster der nahegelegenen Zementfabrik vorfuhren, Arbeiter in Arbeitskleidung mit in ihrem besten Ausgehglamour gestylten Frauen ausstiegen, sich prächtig amüsierten, um zum Ende der Nachtschicht wieder an ihrem Arbeitsplatz zu sein.
Geistige Sklaverei
Mit dem Ende der Sklaverei wird das “Gesetz” zum Problem, da sich nunmehr trotz demokratischer Rhetorik Ausbeutungsmechanismen juristisch manifestieren. “Yet They say that we are free” (Doch sie sagen, wir sind frei), singt Gregory Isaac in “Slave Driver”, “Only to be chained to poverty” (Lediglich an die Armut gekettet). Die Kritik am Gesetz kleidet sich in der Rhetorik des Rootsreggae in einen biblischen Messianismus, von den “Armageddon Times” (Weltuntergangszeiten) eines Willie Williams bis zu Capeltons notorischem “Judgement upon thee Earth!” (Gottesstrafe für die Erde).
Der Gegensatz einer mensch-lichen und einer rächenden, göttlichen Gerechtigkeit speist auch die Gleichsetzung von Polizei und Babylon, die die Brutalität der ersteren nicht nur moralisch verwirft, sondern als notwendig anerkennt für das Fortbestehen von Babylon, der kapitalistischen “Mental Slavery” (geistige Sklaverei), der Diaspora. Die Kritik am juristischen System und den von ihm produzierten legalen Subjektivitäten als messianistischer Trangressionsbewegung findet ihr säkularisiertes Äquivalent in der gegenwärtigen Dancehall in den Trickstergeschichten der Gun-Lyrics, der Bad Boys und Gangster.
Das Motiv der jenseits der babylonischen Gesetzlichkeit marodierenden Rude Boys ist aber älter als der Rootsreggae. Der “Judge Dread” in Prince Busters gleichnamigen Ska-Stück verurteilt den kleinkriminellen Rudie nicht nur zu 500 Jahren Zuchthaus und 500 Peitschenhieben, sondern spricht ihn auf der B-Seite frei und feiert eine große Party zu seiner Entlassung.
Interessanterweise ist Prince Busters “Free Love” mit seiner Aufforderung an die Rude Boys “to speak true” und “our unity will conquer” auch so etwas wie das erste Rootsstück, obwohl Buster als einer der großen Individualisten der Reggaegeschichte immer bemüht war, außerhalb solcher Trends zu stehen. 1994 war er neben dem Art Ensemble of Chicago-Trompeter Lester Bowie an der Skatalites-LP “Hi Bop Ska” beteiligt, die sich als Hommage an den Skaposaunisten Don Drummond und den Free Jazzer Albert Ayler verstand.
Die Wiedergewinnung von Geschichtlichkeit erscheint in der Roots-Rhetorik als Vorbedingung individueller und kollektiver Befreiung, weil das Ergebnis der kolonialen Regimes und des zeitgenössischen Rassismus die Repression der Erinnerung an die Sklaverei ist. Dieses Eingedenken betrifft in erster Linie den gewaltsamen, traumatischen Charakter der Diaspora, das was Slavoj Zizek als den “ahistorischen Kern” jeder Epoche bezeichnet.
In einem so kanonischen Roots-Stück wie Burning Spears “Slavery Days” findet die Wiederholung der Traumata ihre Funktion nicht so sehr in der rhetorischen Frage “Do you remember the days of slavery?” als in deren performativer Inszenierung, deren Sprachweise, dem nichtsemantischen Gehalt seiner Vokal-Improvisationen (dem Noise der heutigen DeeJays), den Schreien, dem geflüsterten Stöhnen oder Ächzen: Als Kommentar über die Grenzen der Sprache hinaus, weil sich bestimmte Wahrheiten in der Sprache der Sklavenhalter nicht ausdrücken lassen und weil sich diasporische Kulturen erst in der Differenz zu dieser konstituieren.
Auf einem fundamentalem Level organisiert sich im Reggae diese differente Zeit- und Geschichtlichkeit als Praxis der Version: Die grundsätzlich endlose, kollektive Wiederholung bestimmter Riddims (Rythmusspuren) als Basis jeder Äußerung und Innovation. Allein in den ersten neun Monaten nach Wayne Smith legendärem, weil zum ersten Mal digitalisierten, “Under Mi Sleng Teng” (1985) entstanden angeblich 239 Versions, und in der mehrfachen, modischen Wiederholung dieses damals neuen Riddims über die letzten zehn Jahre hat jeder Chronist die Ordnung verloren.
All dies bildet in den Worten Paul Gilroys die “Tiefenstruktur” diasporischer Kulturformen und verdichtet sich in der Soundsystemkultur. Deren dialogischer Charakter definiert den öffentlichen Raum neu, indem er die zeitliche und räumliche Wahrnehmungsorganisation der herrschenden Kultur für Momente des kollektiven Eingedenkens suspendiert: “Wenn Kabel der Soundsystems verknüpft sind und die Lichter ausgehen, können Tänzer überall hin in die Diaspora transportiert werden, ohne daß sich die Qualität ihrer Lüste verändert.”
Diese Charakteristika artikulieren einen Chronotopos der Diaspora: Eine Raum und Zeit verdichtende Metapher in der Art von “we are here, because you were there”. Dadurch wird die Ordnung der dominanten, rassistischen Kultur kurzzeitig aufgehoben. Vergangenheits- und Wahrheitskonzepte, die dabei entstehen, bieten nicht nur die Antworten auf die Mystifikationen, die ein integraler Teil rassistischer Herrschaft und der postkolonialen Erfahrung sind, sondern konstituieren die Community symbolisch, indem sie die kollektive Erinnerung, Wahrnehmung und Erfahrung regulieren.
Diese Tiefenstruktur der kulturellen Produktion jenseits der Dichotomie von Roots und Dancehall macht zugleich deren innere Kontinuität und den Antagonismus zwischen den ökonomischen, politischen und ideologischen Strukturen des Kapitalismus und diasporischen Subkulturen aus.
Literatur: Carolyn Cooper, Noises in the Blood – Orality, Gender and the “Vulgar” Body of Jamaican Popular Culture. London 1993; Paul Gilroy, There ain’t no Black in the Union Jack, London 1995