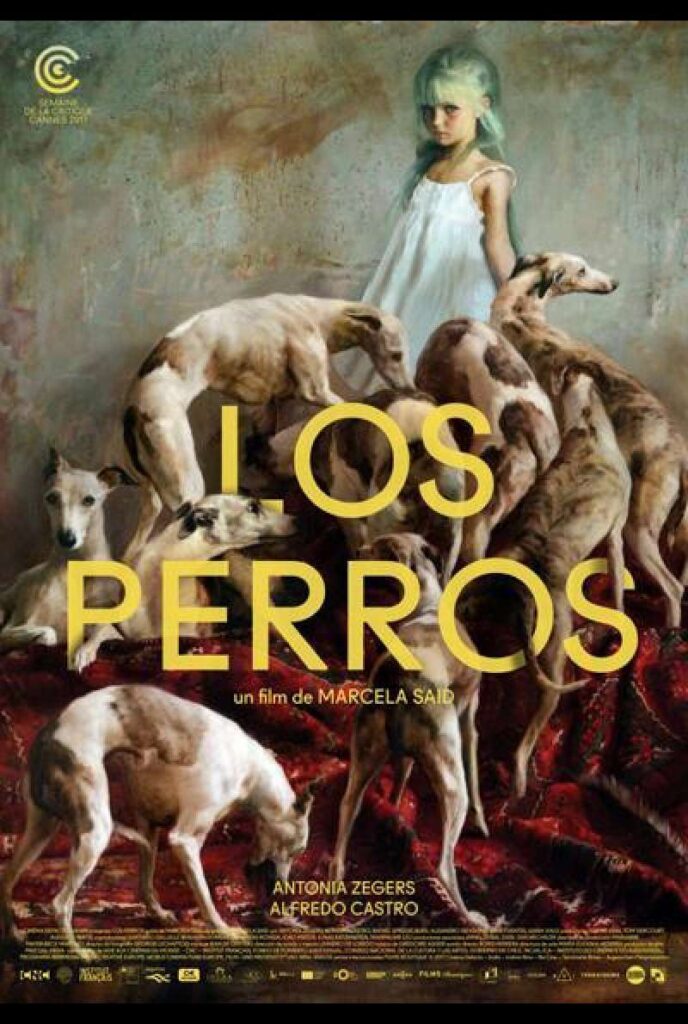Der 11. September bestimmte sein Leben
Herr Guzmán, zahlreiche Regisseure nutzen das Genre des Dokumentarfilms als Einstieg und wechseln dann zum Spielfilm. Sie hingegen sind über dreißig Jahre dem Dokumentarfilm treu geblieben. Was fasziniert Sie an diesem Genre?
Der Dokumentarfilm ist der kinematographische Sektor, der sich in den vergangenen 10 bis 15 Jahren am weitesten fortentwickelt hat. Seit den 1980er Jahren ist dieses Genre immer perfekter geworden. Die narrativen Elemente wurden feiner und ausgeklügelter. Dokumentarfilme sind nicht mehr nur realistisch oder naturalistisch. Heutzutage kann ein Dokumentarfilmer ohne weiteres subjektive Elemente nutzen. Vor allem jedoch ist das thematische Spektrum viel breiter als früher. Mir persönlich bereitet es sehr viel Freude, Dokumentarfilme zu machen. Allerdings darf man sich nichts vormachen: das Leben als Dokumentarfilmer ist schwierig. Es ist nicht sehr lukrativ und man muss viel arbeiten. Der Filmverleih ist langsamer und die Verbreitung geringer. Zudem werden die Filme von weniger ZuschauerInnen gesehen.
Vor diesem Hintergrund erliegen Filmemacher immer wieder der Versuchung, Spielfilme zu machen. Auch ich habe mich einmal daran versucht, musste dann aber einsehen, dass dies ein großer Fehler war. Meine Initiative endete in einem totalen Misserfolg. Durch den Spielfilm, glaubte ich, würde meine Arbeit stärker gewürdigt, ich bekäme mehr Einladungen zu Filmfestivals und würde mehr Geld verdienen. Das war eine große Illusion.
Heute sind Sie also Dokumentarfilmer aus Leidenschaft?
Alles in allem musste ich mich also erst daran gewöhnen, Dokumentarfilme zu machen. Heute bin ich sehr glücklich damit. Die Arbeit als Dokumentarfilmemacher ist sehr viel bescheidener und diskreter, aber gleichzeitig wirklich mit viel Leidenschaft verbunden. Bei Beginn der Dreharbeiten zu einem Film weiß man nie, wie er enden wird. Der Filmprozess ist kaum zu kontrollieren, das Drehbuch ist offen. Jeder Film ist ein Prototyp. Es gibt keine Formeln dafür, wie man einen guten Dokumentarfilm macht.
Darüber hinaus ist der Dokumentarfilm ein sehr fragiles Genre und leicht zu manipulieren, was gefährlich sein kann. Aber er bietet mir einen Raum der Reflexion, auf den ich nicht verzichten möchte. Ich würde nie mehr zu einem anderen Genre wechseln.
Vor kurzem haben Sie mit El Caso Pinochet (Der Fall Pinochet) einen Film vorgelegt, der sich mit der Aufarbeitung der Diktatur Augusto Pinochets beschäftigt.
El Caso Pinochet ist praktisch Fortsetzung und Ende der Geschichte. Dieses Mal gehe ich auf den Prozess ein, der Pinochet gemacht wurde. Der Film handelt vor allem von Frauen, die 25 Jahre warten mussten, bis sie ihrer Stimme Ausdruck verleihen konnten. Ein Vierteljahrhundert hat kein einziger Richter in Chile sie angehört. Sie wurden nicht einmal empfangen. Wie durch ein Wunder konnten diese Frauen in Madrid dem spanischen Richter Baltasar Garzón, der maßgeblich die Untersuchungen führte, ihre Geschichte erzählen.
Darüber hinaus handelt der Film natürlich auch davon, wie außergewöhnlich es ist, wenn ein Diktator wegen seiner Menschenrechtsverbrechen als Regierungschef verhaftet wird, während er sich in einer Klinik behandeln lässt.
Die Interviews, die Sie in El Caso Pinochet mit den weiblichen Folteropfern, den Müttern und Ehefrauen der desaparecidos führen, sind von einer beeindruckenden Tiefe. Wie haben Sie es geschafft, dass sie so offen erzählen?
Ich besitze vielleicht eine bestimmte Fähigkeit, eine Atmosphäre zu verbreiten, in der die Personen, die ich interviewe, daran glauben, was sie sagen. Von fundamentaler Wichtigkeit ist es, glaubwürdig und authentisch zu sein. Obwohl die Kamera läuft, muss man sich vollkommen in die Stimmung der Gesprächspartner begeben. Das Allerwichtigste ist die totale Hingabe des Regisseurs an die Situation. Darüber hinaus ist das Szenario von enormer Bedeutung. Stellen Sie sich nur mal vor, diese Frauen wären in ihrem eigenen Haus gewesen, wo ein vertrautes Bild an der Wand hängt, eine bestimmte Lampe steht oder wo eine Katze vom Schrank springt. Bei einem Interview muss man auf alles verzichten, was in irgendeiner Weise die Konzentration ablenken könnte. Man muss die Schönheit in der Leere suchen.
Das Interview muss mit einem Minimum an Kontext auskommen und den Charakter des Interviews verlieren, damit man in eine andere Dimension der Kommunikation vordringt. Dabei ist die Ruhe mindestens genauso wichtig wie die gesprochenen Worte.
El Caso Pinochet erzählt auch Ihre persönliche Geschichte. Wie manifestiert sich diese inhaltliche Verbundenheit ästhetisch?
In El Caso Pinochet ist es die erste Sequenz, die dem Film seinen Stil verleiht. Ich meine die Sequenz in der Wüste, wo die Menschen nach ihren verscharrten Angehörigen suchen. Zu Beginn wusste ich nicht, dass ich diese für den Film so wichtige Sequenz drehen würde. Der Film ist insgesamt so voll mit anderen Ereignissen, dass man diese Sequenz leicht vergisst. Diese Sequenz ist wie die Ouvertüre einer Symphonie.
Die Schlüsselsequenz allerdings ist die Einstellung mit den Frauen, in der sie wie für ein Gemälde posieren. Hier ist die direkte Adressierung wahrnehmbar, die die Zuschauer unmittelbar in das Filmgeschehen einbezieht.
Ich habe mich entschieden, Frauen für die Interviews auszuwählen, weil ich überzeugt bin, dass sie offener über ihren Schmerz sprechen können als Männer. Die Interviews machen deutlich, dass die Opfer der Militärdiktatur Pinochets ihr Leid gut verarbeitet haben. Die Frauen sind in guter Verfassung und haben bis heute nicht aufgehört zu kämpfen.
Wie würden Sie das Lebensgefühl und die Stimmung in Chile zur Zeit beschreiben?
Chile ist heute ein völlig anderes Land als früher. Charakteristisch für die Zeit während der Unidad Popular war, dass die Menschen gelernt hatten, zu diskutieren und sich auszudrücken. Heutzutage gibt es diese Eloquenz nicht mehr. Es gibt keine Leidenschaft, kein Leben mehr. Der Wunsch, sich zu artikulieren, ist verschwunden. Was ja auch verständlich ist. Viele Menschen tragen noch immer die Enttäuschung über den Militärputsch im Herzen. Man schätzt, dass ungefähr die Hälfte der chilenischen Bevölkerung hinter Allende gestanden hat. Das heißt, wir reden von ungefähr fünf Millionen Menschen, die mit dieser Enttäuschung leben.
Wie wichtig ist Ihrer Meinung nach kollektive Erinnerung für eine Nation?
Sie ist immens wichtig. Nehmen wir zum Beispiel Spanien. Bis jetzt ist dort kein öffentlicher Prozess der Erinnerung in Gang gekommen, der sich beispielsweise den Ereignissen des Bürgerkriegs stellt und diese aufarbeitet. Es gibt kaum Denkmäler für die Gefallenen, kaum eine Straße, die den Namen der damaligen Befreiungskämpfer trägt. Was es gibt, ist Folklore. Spanien hat zwar so etwas wie ein europäisches Projekt hervorgebracht, es hat aber als Land keine Kraft, keine Stärke. Die Situation Chiles ist ähnlich. Es ist ein Land mit Menschen, die eine Kreditkarte haben, aber es ist keine Nation. Es ist ein Unternehmen.
Das kollektive Gedächtnis am Leben zu erhalten, ist nicht nur wichtig für Kunst oder Film. Es ist von einer fundamentalen Bedeutung für die integrative Entwicklung der zivilen Gesellschaft, für die Identität der Menschen. Dabei geht es nicht um Nostalgie. Es geht nicht nur darum, sich an die Toten zu erinnern oder sich noch einmal dem Leid und Schmerz von damals auszuliefern. Es ist ein eigenständiger Prozess, die nationale Erinnerung zu beleben.
Kann man als Filmemacher dazu beitragen?
Im Filmsektor ist in Chile ein Prozess in Gang gekommen, sich den damaligen Ereignissen zu stellen. Verhalten und schüchtern noch, aber junge Filmemacher nehmen das Thema in verstärktem Maße auf. Es gibt inzwischen Filme über die Rolle des Nationalstadions während der Diktatur, über das Konzentrationslager in Chacabuco und es gibt sogar einen Film über die so genannten caravanas de la muerte, die gezielten Exekutionskommandos nach dem Militärputsch 1973. Seit der Verhaftung Pinochets tut sich immer mehr in dieser Richtung. Noch aber handelt es sich um zaghafte Versuche, die Vergangenheit aufzuarbeiten.
Hatten Sie diese Faszination für den Dokumentarfilm bereits in den 1970er
Jahren in Chile gespürt?
Damals war es anders. Damals habe ich mich in die Realität verliebt. Die Vorgänge in Chile waren so faszinierend und dynamisch, dass ich regelrecht in ihren Bann gezogen wurde. Ich spürte so viel Energie, dass ich überzeugt war, alles filmen zu müssen. Jetzt, heute, hier. Es hat mich einfach gefesselt. Ein großes Abenteuer, in den Straßen von Santiago de Chile zu filmen, wie eine Safari. Auf der Straße zu filmen, ist etwas Wunderbares. Man muss ständig improvisieren. Es ist wie Jazz!
Für die Dreharbeiten zu La Batalla de Chile (Die Schlacht um Chile – Der Kampf eines unbewaffneten Volkes) stand Ihnen nicht viel Filmmaterial zur Verfügung. Haben Sie sich einer besonderen Methode bedient, um sich zu beschränken?
Es würde sehr lange dauern, unsere damalige Arbeitsweise im Einzelnen zu erläutern. Das Wichtigste aber ist, dass wir ein Drehbuch geschrieben haben. Es war kein normales Drehbuch. Auf der einen Seite haben wir ein Schema mit der gesellschaftlichen und politischen Realität, den politischen Parteien, dem Kampf im Parlament, den beteiligten Medien sowie den umkämpften Themen entworfen.
Auf der anderen Seite haben wir die konkreten Situationen, die wir drehen wollten, aufgezeichnet. Beides haben wir daraufhin konzeptionell verbunden. Dies alles haben wir immer wieder einer strengen Prüfung unterworfen und geschaut, ob die Dreharbeiten unserem Schema entsprachen. Ohne diese Struktur, da bin ich mir sicher, wäre unser Filmmaterial spätestens nach zwei Monaten aufgebraucht gewesen.
Wie gestaltete sich denn ihr Leben nach dem Putsch von Pinochet im September 1973?
Gleich nach dem Putsch wurde ich von der Polizei festgenommen und ins Nationalstadion von Santiago de Chile gebracht. Man hielt mich zwei Wochen fest. Zu meinem Glück konnte man mir nichts nachweisen. Gleich nach meiner Freilassung telefonierte ich mit Freunden in Spanien. Sie schickten mir Tickets, so dass ich wie ein normaler Tourist aus Chile ausreisen konnte. Das Filmmaterial zu La Batalla de Chile konnte zum Glück mit Hilfe der schwedischen Botschaft nach Kuba gebracht werden. Mein damaliger Kameramann Jorge Müller aber blieb in Chile. Er sagte mir noch, dass ich mir keine Sorgen machen müsste, ihm werde nichts passieren. Das war ein tragischer Trugschluss. Ein Jahr später wurde er von der Geheimpolizei abgeholt und ermordet.
Mit vier Stunden Dauer ist La Batalla de Chile ein monumentales Werk der Dokumentarfilmgeschichte. Wie lange dauerte die Montage zu dem Film?
Geschnitten habe ich den Film in Kuba am nationalen Filminstitut, dem ICAIC. Ursprünglich wollte ich nur ein halbes Jahr in Kuba bleiben, um den Film zu schneiden.
Die Montage des Filmmaterials hat sich jedoch als sehr schwierig herausgestellt, so dass aus den ursprünglich geplanten sechs Monaten sechs Jahre wurden. Zu Beginn des Schnitts erschien mir alles als so wichtig und historisch wertvoll, dass ich mich nicht traute, auf irgendetwas zu verzichten. Ganz allmählich aber bekam ich ein Gefühl für die wichtigsten Sequenzen.
Insbesondere der dritte Teil des Films bereitete mir große Probleme. In diesem Teil geht es nicht um die großen Ereignisse, von denen die ersten beiden Teile erzählen. Er handelt eher von den kleinen Variationen, von der Utopie und dem kollektiven Traum der chilenischen Bevölkerung. Sobald ich aber diese Szenen in die ersten Teile integrieren wollte, habe ich gemerkt, dass der gesamte Film an Rhythmus und Geschwindigkeit verlor. Um dies zu vermeiden, habe ich dieses Material, das feiner, weicher ist als das andere und auch ein anderes Zeitgefühl aufweist, zu einem eigenständigen Film verarbeitet.
Wie haben Sie sich damals im Exil gefühlt?
Während ich am Film arbeitete, fühlte ich mich stark und glaubte, dass ich etwas bewirken könne. Nachdem ich den Film jedoch im Jahr 1979 fertig gestellt hatte, fiel ich in ein großes Loch. Ich war sehr deprimiert. Erst zu diesem Zeitpunkt wurde ich mir über die persönlichen Konsequenzen des Putsches bewusst. Plötzlich dachte ich, dass ich keine Zukunft mehr hätte, dass der Putsch alles zerstört hätte. Mir ging es wirklich sehr schlecht. Heute glaube ich, dass es mindestens acht bis zehn Jahre dauert, bis man realisiert, im Exil zu leben und nicht mehr nach Hause zurückkehren kann. Es war eine sehr traurige Zeit für mich.
In den 1990er Jahren haben Sie sich entschlossen, den Kommentar zu La Batalla de Chile zu verändern. Weshalb?
Ich habe nur einige Worte ausgewechselt, die mir nicht mehr zeitgemäß erschienen. Ich habe keine semantischen Änderungen vorgenommen. Jede Generation denkt, dass ihre Sprache definitiv sei. Sprache aber verändert sich ständig. Meine Motivation war es deshalb, den Kommentar an die Sprache der neuen Generation anzupassen. Ich habe ihn entideologisiert. Insgesamt habe ich vielleicht zwölf oder sechzehn Begriffe ausgewechselt.
Zum Beispiel heißt es nun „Mittelklasse“ statt „Bourgeoisie“, „US-amerikanische Regierung“ statt „Imperialismus“, und an Stelle von „Faschismus“ ist nun von „Opposition“ die Rede. Ich bin überzeugt, dass ich den Kommentar damit verbessert habe.
1996 haben Sie gleichsam eine Fortsetzung von La Batalla de Chile gedreht. Ihr Film Chile – La Memoria Obstinada (Chile – die hartnäckige Erinnerung) handelt von der Verarbeitung der Ereignisse zu Beginn der 1970er Jahre in Chile. Warum haben Sie sich entschieden, diesen Film zu machen?
La Memoria Obstinada ist ein sehr emotionaler Film. Es ist ein Film gegen das Vergessen, in dem ich fünfundzwanzig Jahre nach dem Putsch von Pinochet nach Chile zurückkehre und die Personen aufsuche, die bereits in La Batalla de Chile zu sehen sind. Als ich La Batalla de Chile erstmals in Chile gezeigt habe, war ich über die ersten Reaktionen sehr betroffen. Nach der Vorführung hat niemand applaudiert oder auch ein nur Wort gesagt. Zunächst dachte ich, ich hätte vielleicht den falschen Film gezeigt. Als aber das Licht anging, habe ich gesehen, dass alle geweint haben. Das war der Moment, als ich die Idee hatte La Memoria Obstinada zu machen.