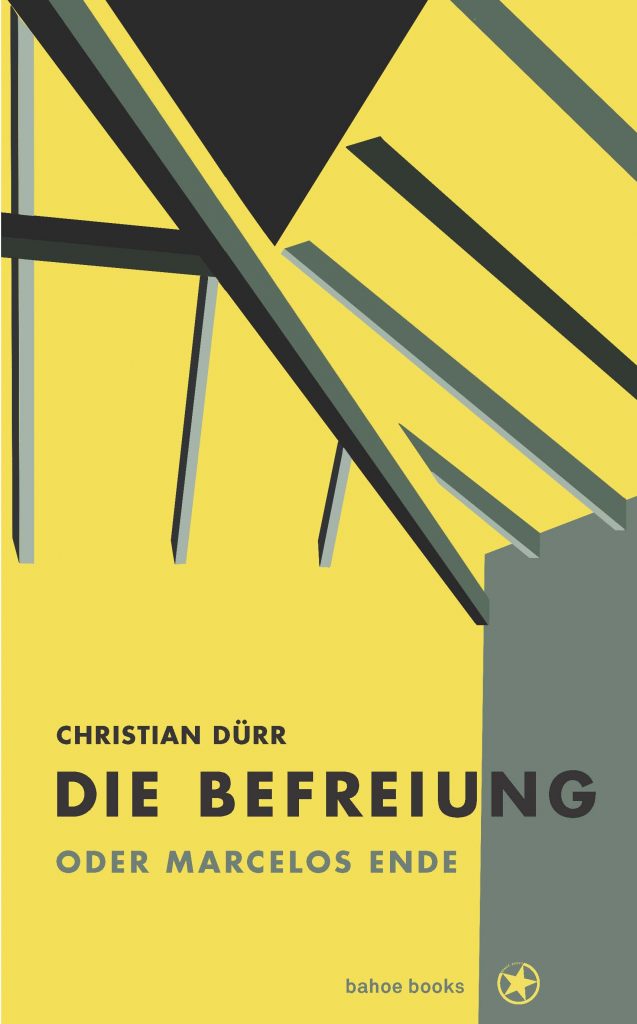Der Vizegraf vom Río de la Plata
Spät entdeckt: Vizconde de Lascano Tegui
Der Vizconde de Lascano Tegui gibt Rätsel auf, und das nicht zu knapp. Nicht, daß er sich in seinem langen Leben (1887-1966) bewußt versteckt gehalten hätte nach Art eines B. Traven – daß er an die Stelle seines bürgerlichen Vornamens Emilio den behäbigen Adelstitel Vizconde setzte, klingt eher nach Selbstironie als nach einem Pseudonym. Es scheint Zufall gewesen zu sein, daß sein gutes Dutzend Bücher weder ein breites Publikum fand noch große Verlage auf ihn aufmerksam wurden. In den Literaturgeschichten und Autorenlexika sucht man seinen Namen jedenfalls vergeblich: er ist ein Vergessener. Mag sein, daß Lascano Tegui auch nicht das Bedürfnis verspürt hatte, für den eigenen Ruhm selbst zu sorgen.
Einige Philologen, mit detektivischem Scharfsinn ausgestattet, sind biographischen Einzelheiten des Argentiniers Emilio Lascano Tegui auch schon auf die Schliche gekommen. Langsam werden die Spuren sichtbar, die er hinterlassen hat, über die jedoch schon viel Gras gewachsen war.
“Von der Anmut im Schlafe” hingegen, und an seine Bücher sollten wir uns in erster Linie halten, ist ein kleines Verwirrspiel, dem nicht so leicht beizukommen ist.
Sollte es stimmen, was Lascano Tegui seinen Freunden von der Künstlergruppe “Pua” aus Buenos Aires in einer Widmung dem Buch voranschrieb, so hätte er “Von der Anmut im Schlafe” bereits 1914 geschrieben gehabt. Eine sehr verwirrende Behauptung, denn das Buch spielt in Bougival, einem Vorort von Paris, flußabwärts am linken Ufer der Seine gelegen. Lascano Tegui hatte im Gefolge von Rubén Darío die Hinwendung zu Frankreich und insbesondere Paris als “geistiger Hauptstadt” Lateinamerikas mitvollzogen, und es verwundert überhaupt nicht, daß die Handlung ebendort angesiedelt ist. Aber: “Von der Anmut im Schlafe” ist mit solcher Kenntnis der örtlichen Atmosphäre geschrieben, daß er eigentlich dort gelebt haben müßte.
In Europa
1908 und 1909 war er auf zwei längeren Reisen durch Europa unterwegs, aber erst 1914 siedelte er (wenn zutrifft, was wir bisher über ihn wissen) für mehr als zwanzig Jahre nach Paris über. Entstand das Buch nach intensiven Beobachtungen auf seinen ersten Reisen, las er es den Freunden in Buenos Aires vor – veröffentlichte aber erst, wie geschehen, 1925? Oder ist die Datierung von 1914 Fiktion, schrieb der Vizconde das Buch später, während des Frankreichaufenthaltes, als er eine zeitlang in Chatou wohnte, das Bougival gegenüber am anderen Seineufer liegt?
Auch wenn die Frage (noch?) offenbleiben muß, für das Nachdenken über das Buch ist sie nicht ohne Bedeutung.
Es könnte ein Entwicklungsroman sein, natürlich nicht in der realistischen Tradition des 19. Jahrhunderts, sondern ein moderner, reflektiver Roman: ein inwendig zurückgelegter, im Nachhinein und vom Ziel aus vermessener Weg; der Untertitel “Intimes Tagebuch” deutet darauf hin. Am Beginn steht die Ankündigung eines Mordes, am Ende seine Ausführung, ein Rahmen also. Dazwischen erzählt uns der Tagebuch-Schreiber sein Leben (“19. Mai 18.. – Ich bin in Bougival geboren”) wie eine stark fragmentierte Autobiographie. Es stehen eine Fülle von Begebenheiten und Beobachtungen aneinander, nachlässig chronologisch geordnet, zeitlich gebrochen durch detailversessene Momentaufnahmen, aber auch durch Auslassungen vieler Jahre. Als hätte sich einer hingesetzt und immer, wenn ihm etwas aus seiner Vergangenheit in den Sinn kommt, es unterm jeweiligen Datum festgehalten.
Aber diese Tagebuchebene wirkt nicht zuverlässig; so kann es sich eigenlich kaum verhalten haben. Besonders am Schluß des Buches, mit dem Wissen um den tatsächlich ausgeführten, grauenhaft kaltblütigen Mord an einer unschuldigen jungen Frau, drängt sich eher der Eindruck auf, es könnte sich doch um ein Schreiben vom Ende her handeln, um den Versuch zu erklären, wie es dahin gekommen ist und nun also das Bemühen, die wache Erinnerung des Mörders in der vergangenen Zeit zu fixieren, das Geschehen einsehbar werden zu lassen, nachvollziehbar, wenn schon nicht entschuldbar.
Zweierlei durchzieht die Aufzeichnungen und hält die – manchmal abstrus nebensächlich erscheinenden – Bruchstücke zusammen: das Sehen und Beobachten, und die Frage nach Unschuld und Schuld. Der Tagebuchschreiber ist ein begnadeter Seher (und der Vizconde de Lascano Tegui in dieser Hinsicht ein brillanter Autor), denn: Er sieht selbst. Er verfügt über eine bewundernswerte Leichtigkeit, Ideologien und Moralpostulate seiner recht muffigen Kleinstadtwelt zu ignorieren (an anderer Stelle klagt er sie deswegen an) und statt dessen, mit unvoreingenommenem, kindlichen Blick die Dinge zu sehen, wie sie ihm erscheinen. Dabei gelingen ihm feinfühlige Beobachtungen von liebenden Menschen genauso wie von verkrachten Existenzen, so über die frühe Greisenhaftigkeit von Wunderkindern (“Sie haben alle Genüsse kennengelernt ausser dem sinnlichen”). Aber es finden sich auch Zeilen – fast möchte ich sagen: Delikatessen – wie “das Geräusch, das eine Katze machen kann, die auf einer Zeitung eingeschlafen ist und sich umdreht”, oder: “Die Stimme schwindet die Treppe hinauf. Man hört eine Person laufen. Ihre Schritte scheinen an der Decke zu hängen.”
Dabei ist natürlich letzten Endes seine eigene Person das, was er sieht. Als er seine Unschuld verliert (dazu gleich), notiert er: “Ich kehrte nach Hause zurück und erkannte schnell an den Gesichtern derer, die mir nahe standen, die Größe meines Verlustes.” Die Welt sehen heißt, sich selbst sehen, sie ist dem Ich ein Spiegel. Die altvertraute Scheidung von Ich und Du ist aufgehoben, durch Freuds These von Ich, Über-Ich und Es zumal. So durchschlagend diese Erkenntnis ist, so abgrundtief ist der Schrecken über ihre Kehrseite: die Einsamkeit. Wenn alle Stricke reißen und die altverläßlichen Zusammenhänge sich auflösen, wird das Vertrauen auf liebende Geborgenheit und sichere Glaubensinhalte bitter enttäuscht. Weder die Kleinstadt Bougival noch der Tagebuchschreiber können daran etwas ändern.
In “Von der Anmut im Schlafe” korrespondiert diese Einsamkeit dem Problem des Schuldigwerdens. Während der Schreiber als Kind, in schlafender, anmutiger Unschuld, sich für sein Tun keiner Verantwortung bewußt ist und der Welt spielerisch begegnet, fällt in einem bestimmten Moment etwas von ihm ab “wie ein Fuchspelz von der fühllosen Schulter einer sportlichen Frau”. Es ist wie ein Erwachen, aber: Plötzlich weiß er nichts mehr mit sich anzufangen. Er ist allein.
Keine Blut-und-Boden-Dummheiten
Zum Militär nach Afrika eingezogen, findet er in einem Bordell zum ersten Mal eine große Liebe; als er nach Ende der Dienstzeit nach Frankreich zurückkehrt, hat er die Syphilis im Gepäck. Immer deutlicher zeichnet sich nun vor seinen Augen die Verderbtheit der Welt ab, dieser “Landschaft der Schlaflosigkeit”, und vor allem: Er ist deren Teil und kann gegen diese, scheint’s, schicksalhafte Zugehörigkeit nichts tun. Er beobachtet an sich Veränderungen und ist machtlos, ihnen entgegenzuwirken. “Die Männer sterben hundertjährig, ohne eine Frau kennengelernt zu haben”, sieht er. “Wir betreten eine neue Welt”, in der ein Zug fährt, “randvoll mit Kranken… Der Zug wird von einem Maschinisten gefahren, der unterwegs verrückt werden und durch die letzte Station rasen wird, ohne anzuhalten.” Das schreckliche, beziehungs- und lieblose Neue wird Synonym von Geschwindigkeit, Hast und Großstadt (ohne daß Lascano Tegui zum naiven Landidylliker oder gar zum Anhänger von “Blut und Boden”-Dummheiten geraten würde; seine Alternative liegt wohl eher innen), er beklagt die unvollkommen bleibenden Menschen; die Verkümmerung des Menschlichen ist ihm die eigentliche Unmenschlichkeit. Seine Antwort schließlich: “Ich befreie die Menschheit von einem unvollkommenen Wesen, von einem debilen Wesen.”
Ergo: Der Mensch in unserer Zeit ist nur harmlos, solange er kindlich “schläft”; sobald er erwacht, zerstört er. Eine bittere Analyse, wenn sie auch im Umfeld des Weltkrieges bestürzend klarsichtig ist. Vizconde de Lascano Tegui wird angesichts der Massenabschlachtungen auf den Kriegsfeldern zum Pessimisten – und sollte er das Buch tatsächlich vor 1914 geschrieben haben, könnte man ihm nicht nur Klarsicht, sondern auch eine gewisse Gabe zur Voraussicht zuschreiben.
Bei diesem “könnte” will ich es aber auch belassen, und mich beschleicht überhaupt ein Argwohn bei so einer schlüssig klingenden Interpretation – es kann auch ganz anders gelesen werden, natürlich. Der Herausgeber und Übersetzer Walter Boehlich zieht in seinem Nachwort von dem Mord eine literarische Parallele zu André Gides 1914 erschienenen Roman “Les Caves du Vatican” und erklärt beide Morde als “sinnlos und grundlos”. Abgesehen davon ist “Von der Anmut im Schlafe” voll von Abzweigungen, Andeutungen und Nebenschauplätzen, daß es nicht schwer sein dürfte, zu vielen anderen Lesarten zu finden. Ein Buch jedenfalls, das von der kleinen, feinen Friedenauer Presse sehr ansehnlich ediert wurde und für Gourmets wie Abenteurer Reize und Herausforderungen bereithält.
Das Essener “Schreibheft” legte in seinem diesjährigen Maiheft nach. Auf knapp 100 engbedruckten Seiten findet sich ein erstes exzellent geschriebenes Resumée über den derzeitigen Kenntnisstand betreffs Vizconde de Lascano Tegui (Dietrich Lückoff) und eine Sammlung von Auszügen aus seinen Werken – Gedichte, ein programmatischer Brief, journalistische Arbeiten, Romane. Sie geben den Blick auf die Vielfalt des Vizconde frei. Es gibt kaum ein Genre, in dem er nicht geschrieben hätte; thematisch bewegt er sich vorrangig in Argentinien, “Von der Anmut im Schlafe” ist da eine Ausnahme.
Da in Argentinien auch in diesem Jahr eines der Bücher des Vizconde neu editiert wurde (Mis queridas se murieron), darf man auf Weiteres in hiesigen Verlagen gespannt sein. “Von der Anmut im Schlafe” und das “Schreibheft”-Dossier sind ein gelungener Anfang.
Vizconde de Lascano Tegui: Von der Anmut im Schlafe. Intimes Tagebuch, herausgegeben und übersetzt von Walter Boehlich, Friedenauer Presse, Berlin 1995, 36,- DM. (ca. 18 Euro).
Schreibheft. Zeitschrift für Literatur, Heft 49 (Mai 1997), Rigodon-Verlag Essen, 17,- DM. (ca. 9 Euro).