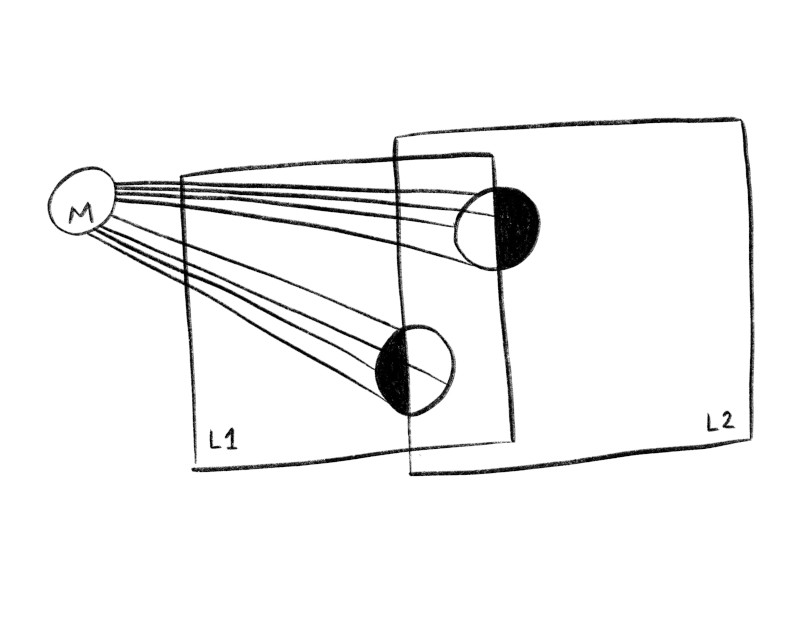„Die richtigen Fragen stellen”
Der argentinische Autor Raúl Argemí über den politischen und literarischen Umgang mit der Diktatur
Das zentrale Thema des argentinischen Gastland-Auftrittes auf der Frankfurter Buchmesse ist der Umgang mit der Militärdiktatur. Die Regierungen Kirchner/Fernández haben dieses Thema zu einem Teil ihrer Politik gemacht. Wie bewerten Sie die argentinische Form der Geschichtspolitik?
Zunächst einmal muss man klarstellen, dass Erfolge bei Wiedergutmachungsprozessen, beim Kampf um Menschenrechte und Gerechtigkeit, niemals Verdienste von Regierungen sind. Niemals wird eine Regierung hier vorangehen, ohne von unten dazu gezwungen worden zu sein, und der Druck in Argentinien war nach den Enttäuschungen der achtziger Jahre und den lähmenden neunziger Jahren sehr groß. Das unbestreitbare Verdienst der Kirchner-Regierungen ist, dass sie begriffen haben: Jetzt ist der Moment, um die Gesetze in Frage zu stellen, die bisher die Folterer geschützt haben. Sie haben sich dafür interessiert, was der Bevölkerung wichtig war. Aber der Druck kam von unten. In diesem Sinne sind Regierungen eigentlich immer konservativ – außer wenn sie dazu gezwungen werden, es nicht zu sein.
Wie haben Sie persönlich diesen Druck erlebt?
Als ich aus dem Gefängnis kam, sprach man gerade über die „Theorie der zwei Dämonen“. Ernesto Sábato hat sie 1984 im Vorwort zum Menschenrechtsbericht Nunca más verbreitet. Dabei ging man davon aus, dass es eine kleine Gruppe von Bösen auf der Rechten und eine andere kleine Gruppe von Bösen auf der Linken gegeben habe, und der Rest habe dem Geschehen in der Diktatur unbeteiligt zugeschaut. Das entlastete tausende und abertausende von Menschen, die sehr aktiv an der Diktatur beteiligt waren. Alle, die seither gegen den Strom geschwommen sind mit ihrer Auffassung, haben heute im Grunde gewonnen. Die Menschen trauen sich zu sprechen, ihre Vergangenheit zu benennen.
Aber die Regierungspolitik hat doch den Nebeneffekt, dass die Geschichte wieder durch die Macht uminterpretiert wird – im Sinne von deren eigenem Machterhalt.
Dem würde ich nur teilweise zustimmen. Wenn man ein Konzentrationslager wie die ESMA in ein Museum der Erinnerung umwandelt, wo die Fotos nicht nur der Verschwundenen, sondern auch der Folterer gezeigt werden, damit man weiß, wer diese waren und damit auch die Kinder und Enkel das gezeigt bekommen können – dann kann das die Politik nur geringfügig vereinnahmen. Sicher, jede Regierung wird versuchen, die Geschichte für sich zu instrumentalisieren. Aber die Verankerung dieser Zusammenhänge in der Erinnerung scheint mir viel wichtiger zu sein. Auch mit den Müttern und den Großmüttern der Plaza de Mayo ist das ja so geschehen – aber es ist wichtig, dass diese immer noch da sind und rufen: „Bewahrt die Erinnerung!“
Sprechen wir von Literatur. Viele argentinische Autorinnen und Autoren suchen derzeit nach einer Neubewertung der linken Geschichte, sie räumen Irrtümer und Schuld auch auf der Linken ein. Ist das Ihrer Meinung nach ein guter Weg?
Anzunehmen, jemand sei gut, nur weil er eine bestimmte politische Position einnimmt, ist schwachsinnig. Wir haben auf der Linken fürchterliche Fehler gemacht. Wir haben geglaubt, wir könnten die ganze Welt verändern. Wir meinten, eindeutig zu wissen, wer der Feind war, und mit dem gab es nichts zu diskutieren, den konnte man nur bekämpfen. Heute müssen wir uns darüber klar werden, was wir damals wollten, was wir getan haben und warum wir gescheitert sind. Das brauchen wir, um überhaupt mit der Welt zurechtzukommen. Wichtiger als auf diese Fragen gute Antworten zu finden, scheint mir erst einmal die Fähigkeit zu sein, überhaupt diese Fragen zu stellen.
Ihr neues Buch Und der Engel spielt dein Lied ist Rodolfo Walsh gewidmet. Was verdanken Sie Walsh?
Ich verdanke ihm viel als einem Menschen, der seinem Gewissen verpflichtet gewesen ist – und der zugleich schrieb wie ein Gott. Walsh schreibt sozusagen immer besser: Bei jeder neuen Lektüre von Operación Masacre fällt mir das von Neuem auf. Es gibt hier einen Rhythmus, eine Erzählweise, die zutiefst berührt. Er ist einer der ganz großen argentinischen Schriftsteller, aber er wird wohl nie als solcher vom Parnass der Intellektuellen anerkannt werden, weil er politisch aktiv war, und das stört. Aber er hatte die Fähigkeit, bei den LeserInnen Leidenschaft zu wecken. Das ist das Entscheidende.
Als 1956 das Massaker passierte, von dem Walsh schrieb, war ich neun Jahre alt, ich ging in die Grundschule. Er erzählt, dass bei der Rebellion die Kaserne der Aufständischen mit Flugzeugen angegriffen wurde, das war in La Plata, in der Provinz Buenos Aires. Ich bin aus La Plata. In der Nacht vorher wurden wir wach, weil wir die Einschläge der Geschosse hörten, und am nächsten Morgen kam ich mit ein paar anderen Jungen auf einer Dachterrasse zusammen, wo wir den Flugzeugen zuschauten, die die Kaserne angriffen. Insofern bin ich ein wenig ein Teilnehmer an diesem Geschehen, und das Buch von Walsh hat mich dann sehr angesprochen.
Sie selbst haben die Diktatur miterlebt, die ja in Ihren Büchern auftaucht. Sind Ihre Texte ein Kommentar über Ihre eigene Geschichte?
Völlig. Da ich das Glück hatte, eine so belastende Phase wie die Diktatur zu überleben, erschaffe ich Personen, die damit zu tun haben. Sie sind geprägt von meinen Vorstellungen, meinen Wünschen und Ängsten, und ich lasse das zu. Dabei kommen Dinge zutage, die ich überhaupt nicht vorhergesehen habe, die nichts mit der Rolle zu tun haben, die ich den Personen eigentlich zugedacht hatte. Für mich sind die entscheidenden Fragen: Wer sind wir? Wie weit können wir wir selbst bleiben, ohne zu zerbrechen? Wir wissen, dass man uns in ein Konzentrationslager stecken und uns dort zu Hunden machen kann.
Dann ist für Sie das Schreiben ein Akt der Befreiung?
Mir erlaubt das Schreiben nachzudenken. Mir die richtigen Fragen zu stellen. Und ich weiß, dass alle Antworten, zu denen ich gelange, vorläufig sein werden. Das macht mich nicht zu einem besseren Menschen, aber es hilft.