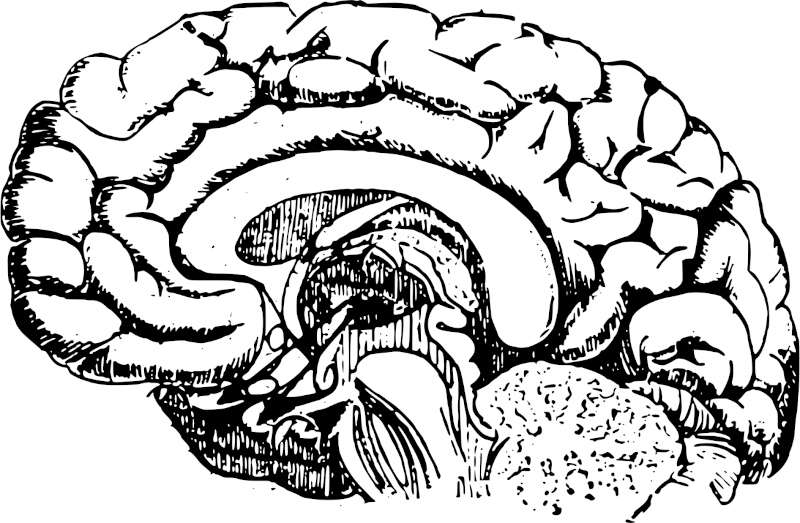Kinder und Alte bleiben zurück
Über die Bedeutung von Überweisungen durch Migrant*innen im Ausland und die Folgen für die honduranische Wirtschaft

Alle zwei Wochen fährt Julissa Gómez aus dem Dorf Ticamaya nach San Pedro Sula. Dort holt sie bei einer Bank den Gegenwert von 125 US-Dollars in der honduranischen Währung Lempira ab. Das Geld schickt ihr Mann, Elbin Antony, der vor vier Monaten illegal in die USA gereist ist. Der 26-Jährige lebt dort in New Jersey bei seinem Vater, den er über 20 Jahre lang nicht gesehen hat. Zunächst arbeitete Elbin in einem Supermarkt, jetzt als Tellerwäscher in einem Restaurant. Julissa erzählt: „Das Geld verstecke ich gut in der Hosentasche und kaufe dann sofort Lebensmittel und die Pulvermilch für meine beiden Kinder. Letzten Monat musste ich auch viel Geld für Medikamente ausgeben, weil sie unter Eisenmangelanämie leiden.“
Wie Julissa geben über 80 Prozent der Empfänger*innen ihre remesas für grundlegende Lebenshaltungskosten aus. Kein Wunder, denn in Honduras kosten allein die Lebensmittel für eine fünfköpfige Familie mehr als der Mindestlohn. Darüber hinaus müssen Patient*innen in den öffentlichen Krankenhäusern viele Medikamente selbst bezahlen, Lehrer*innen verlangen Schulmaterial und oft auch Geld von den Eltern. Auch die Mieten sind nach der Pandemie stark gestiegen.
Laut einer aktuellen Studie der honduranischen Zentralbank vom August 2023 sind die Rücküberweisungen das einzige Einkommen für weit über ein Drittel der Familien, die sie erhalten. So auch für Julissa, denn sie arbeitet nicht, um sich um ihre beiden Kinder zu kümmern. Immerhin lebt sie mietfrei im Haus ihrer Geschwister.
„Das Geld der Auslandshonduraner*innen hält das Land über Wasser“, fasst der junge Ökonom der Arbeitgeberorganisation COHEP, Alejandro Kaffati, die Situation zusammen. Im Jahr 2022 betrugen die remesas 8,68 Milliarden US-Dollars. Das entspricht einem guten Viertel des Bruttoinlandproduktes, was wiederum dem Wert aller Exporte außer Textilien entspricht. Dieses Jahr werden die Überweisungen der Auslandshonduraner*innen vermutlich erneut um gut 7 Prozent wachsen. Fast 24 Millionen US-Dollars werden jeden Tag durch die Rücküberweisungen in die Wirtschaft gepumpt. Das ist ein Segen für den Handel überall im Land: Von kleinen Lebensmittelläden, Kleidergeschäften und Restaurants über Dienstleistungen wie Schönheitssalons und Werkstätten bis hin zu nationalen Ketten, die Haushaltsartikel und elektronische Geräte vertreiben, oft auf Kredit. „Diese wirtschaftliche Dynamik trägt zum Wirtschaftswachstum von rund 4 Prozent bei, denn neben den vielen importierten Artikeln werden auch einheimische Produkte konsumiert. Dazu kommen Löhne für die Angestellten, die ebenfalls konsumieren“, erklärt der Ökonom und Universitätsdozent Rafael Delgado.
Nicht nur für die Empfänger*innen und die Wirtschaft sind die remesas lebenswichtig, sondern auch für den honduranischen Staat: Er kann den Wechselkurs der Landeswährung Lempira gegenüber dem US-Dollars stabil halten, indem er Devisenvorräte anhäuft. Noch wichtiger ist jedoch, dass sich der Druck auf das öffentliche Gesundheits- und Bildungssystem verringert. Alejandro Kaffati schätzt, dass ohne die Rücküberweisungen der Anteil der Armen in Honduras von aktuell 71 Prozent auf 80 Prozent steigen würde. Ein Anstieg an Menschen in finanziellen Notlagen hätte unweigerlich noch größere soziale Konflikte zur Folge, in einem Land mit hoher Kriminalität und einem fragilen sozialen Netz.
Obwohl alle Regierungen das Sozialbudget kontinuierlich erhöht haben, lag das Land im Menschlichen Entwicklungsindex der UNO 2022 bloß auf dem 137. Platz von 191 evaluierten Ländern. Eine bessere Zukunft scheint also nur im Ausland möglich.
Sechs von zehn Auslandshonduraner*innen, die remesas an ihre Familie schicken, tun das monatlich und überweisen mit 467 US Dollars etwas mehr als den honduranischen Mindestlohn. Fast die Hälfte von ihnen lebt seit über 20 Jahren in den USA. Ein großer Teil der honduranischen Arbeiter*innen in den USA ist im Service-Sektor tätig: Sie sind Putzpersonal in Hotels oder Angestellte in Restaurants und Altenpflege, Männer arbeiten oft im Baugewerbe. Laut der bereits erwähnten Studie der Honduranischen Zentralbank verdienen Auslandshonduraner*innen durchschnittlich rund 3.000 US-Dollars pro Monat und setzen zwischen 8 Prozent und 14 Prozent ihres Einkommens für Rücküberweisungen an ihre Angehörigen in der Heimat an. Dazu kommen Überweisungen in Notfällen sowie für spezielle Anlässe und große Pakete mit Kleidern und Geschenken zu Weihnachten.
„Wer remesas bekommt, hat meist keine Alternative”
Macht Geld, für das die Menschen nicht selbst arbeiten, faul? „Nein“, sagt José Manuel Pineda, Vizepräsident der Nationalen Entwicklungs-stiftung von Honduras (FUNADEH). „Wer remesas bekommt, hat meist keine Alternative, denn er findet keinen Job, ist alt oder krank oder kümmert sich um die zurückgebliebenen Kinder. Es gibt einfach nicht genug Jobchancen, die wenigen Stellen sind zudem sehr schlecht bezahlt.“
Julissa will nicht illegal emigrieren, weil das Risiko, dass ihr auf dem beschwerlichen Weg durch Mexiko etwas zustößt, zu groß sei: „Unser Ziel ist es, Geld für ein kleines Restaurant zu sparen und es dann gemeinsam zu führen.“ Falls das nicht klappt, ist sie sich bewusst, dass die Familie möglicherweise viele Jahre lang getrennt leben wird, nimmt das aber auf sich. Um sie herum geht es vielen so.
Óscar Bautista ist Kaffeeproduzent und Bürgermeister von Santa Rita, einer Gemeinde im Departamento Santa Bárbara im Westen des Landes. Er schätzt, dass 90 Prozent der circa 4.000 Einwohner*innen von Santa Rita Angehörige im Ausland haben, die ihnen remesas schicken. „Das sieht man an neuen Häusern, mehr Autos sowie Investitionen in die Plantagen. Aber da es fast keine jungen Leute mehr gibt, fehlt es an Arbeiter*innen, besonders für die arbeitsintensive Kaffee-Ernte zwischen November und März. Die Landwirtschaft kann nicht wachsen, das wird in Zukunft zu höheren Lebensmittelimporten führen“, befürchtet Bautista. Zurück bleiben die Älteren, die dank des Geldes der Migrant*innen einigermassen würdevoll leben können.
Getrennte Familien sind der soziale Preis, den Länder bezahlen, aus denen viele Menschen emigrieren. Dazu kommen weitere negative Aspekte der Rücküberweisungen, so dass sie von vielen Ökonomen sogar als Falle bezeichnet werden. In erster Linie sinkt die Produktivität und damit die internationale Wettbewerbsfähigkeit aufgrund fehlender Arbeitskräfte in allen drei wirtschaftlichen Sektoren sowie Investitionen in Firmen aller Art. Besonders junge Leute aus ruralen Gebieten verlassen das Land in Scharen und setzen ihre Arbeitskraft in den Ländern des globalen Nordens ein. Dazu kommen immer mehr Fachkräfte, die aufgrund fehlender Perspektiven – sprich Weiterbildung, adäquate Löhne und bessere Lebensqualität – auswandern. Dank ihnen kommen viele Devisen ins Land, von denen ein Teil in importierte Güter investiert wird. Das erhöht kurzfristig die Lebensqualität, trägt aber nicht zu einem nachhaltigen Wirtschaftswachstum bei, das zusammen mit gerechteren Strukturen den Exodus aus Honduras zumindest etwas verringern würde.
Der Staat ermutigt die Migration dabei durch offizielle Programme
Rafael Delgado bringt es so auf den Punkt: „Die remesas erlauben einer gewissen Bevölkerungsschicht eine Bequemlichkeit, die längerfristig aber fatal ist und immer mehr Personen dazu motiviert, ebenfalls zu emigrieren.“ Der Staat ermutigt die Migration dabei durch offizielle Programme. Fernseh- und Radiospots, die vor den vielen Gefahren auf der Route durch Mexiko warnen und von der Behörde für Entwicklungszusammenarbeit der US-Regierung bezahlt sind, werden praktisch ignoriert. Zu groß sind die Not und der Traum von einer besseren Zukunft und dieser beinhaltet auch die Hilfe an die „daheimgebliebenen“ Familienmitglieder.
Ein konkreter Weg aus der Falle der Rücküberweisungen wären laut Alejandro Kaffati spezifische Kredite für die Empfänger*innen von remesas. Drei Viertel von ihnen verfügen zur Zeit nicht einmal über ein Bankkonto. Dennoch gibt es Personen, die über genug Geld für eine Investition wie ein Grundstück oder sogar ein Haus verfügen. „Durch Kredite mit niedrigeren Zinssätzen könnten Investitionen ermöglicht werden, beispielweise in Immobilien oder Kleinfirmen. Das stärkt Wirtschaftsbranchen wie das Baugewerbe, das bisher nur wenig von den remesas profitiert. So würde die Arbeitslosigkeit bekämpft und das Wohnungsdefizit verkleinert“, so Kaffati. Dafür ist ein gewisses Kapital sowie ein finanzielles Grundwissen nötig und eine klare Vision der Zukunft, die weit über das simple Konsumieren hinausgeht.
Mit größeren Investitionen in Bildung und Anreizen für neue, innovative Firmen kann der Staat die wirtschaftliche Dynamik erhöhen. Das allerdings setzt einen starken politischen Willen voraus, der die vierjährige Amtszeit einer Regierung überschreiten müsste. Nicht sehr wahrscheinlich in diesen Zeiten, wo sich nicht nur in Honduras die politische Rechte und Linke unversöhnlich gegenüberstehen.
Rafael Delgado schlägt daher vor, Modelle aus Mexiko zu übernehmen, wo der Staat auf verschiedenen Ebenen mit den remesa-Empfänger*innen zusammenarbeitet, um ihre Gemeinden zu stärken. So soll weniger konsumiert und mehr investiert werden – in soziale Infrastruktur wie Schulen, Gesundheitszentren, Wege und Trinkwasser, aber auch in ihre Häuser und Kleinstfirmen. Mexiko erhält nach Indien weltweit die meisten Rücküberweisungen.
Das ernüchternde Fazit ist, dass laut einer Studie des Internationalen Währungsfonds keines der zehn Länder, die zwischen 1990 und 2017 in Relation zu ihrem Bruttoinlandsprodukt die meisten Rücküberweisungen erhielten, sein BIP pro Kopf im Vergleich zu Ländern mit weniger Rücküberweisungen steigerte. In der Mehrheit sind die Wachstumsraten der großen Empfängerstaaten sogar um rund einen Prozent geringer als die der vergleichbaren Länder. Zu den Staaten, die besonders von Rücküberweisungen profitieren, gehören neben Honduras auch Jamaika, Kirgisien, Nepal und Tonga. Es handelt sich also keineswegs um ein rein lateinamerikanisches Phänomen. Doch rund tausend Honduraner*innen verlassen ihr Land fast täglich auf der Suche nach besseren Chancen und diese Dynamik scheint unaufhaltbar.