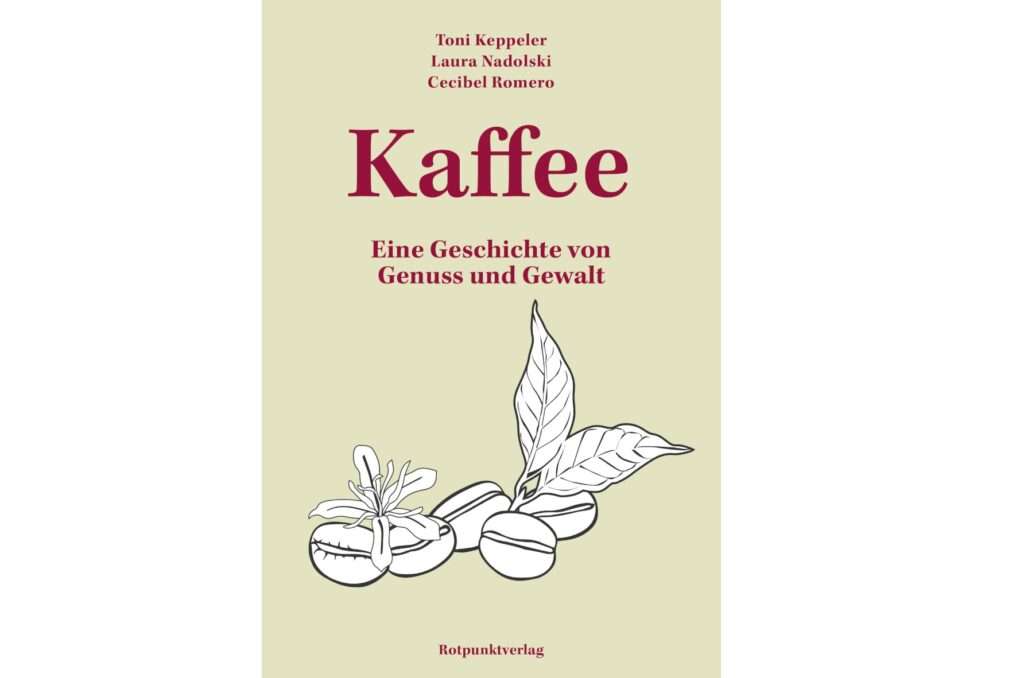Tanger ohne Mythos
In Rey Rosas neuem Roman „Tanger“ wird die marokkanische Stadt vor allem gesehen und gehört
Tanger – das ist doch vorbei. Das war die Stadt von Paul Bowles und der „Roten Wüste“, die Stadt der Beat Generation der 50er und 60er Jahre. Aus Tangers Charme sind längst schon Reiseführer–Tipps geworden, aus seinem Mythos ein Museum. Oder? Rodrigo Rey Rosa, literarischer Enkel und Freund von Paul Bowles, hat die Stadt lange Jahre über kennen gelernt und zeigt in seinem neuen Roman, dass Tanger lebt, wenngleich anders als damals.
Das heutige Gesicht kann entdecken, wer nicht mit Tunnelblick nach dem alten, legendären sucht. Überhaupt geht es in „Tanger“ viel ums Sehen, auf fast jeder Seite. Rey Rosa schreibt in einem sehr sparsamen, auf den ersten Blick sehr kühlen Stil. Er erzählt, was die vielen Figuren seines Romans tun und, vor allem, was sie sehen und wahrnehmen. Auch Geräusche spielen eine große Rolle, selbst Temperaturen. Er vermag sie zum Leben zu erwecken, obwohl so etwas wie eine Personenbeschreibung fast ausgeblendet bleibt. Wer und wie sie sind und was sie antreibt, darüber schweigt sich der Autor aus. Wir erfahren wohl, dass sie aus verschiedenen Welten stammen, dass sie Einheimische sind oder aber Reisende und Gebliebene, sie treffen sich und gehen wieder auseinander. Das Gesicht Tangers aber, das sind für Rey Rosa nicht Charaktere, sind auch nicht die alten Geschichten, sondern vielmehr diese heutigen Beziehungen und Begegnungen, ein Menschengeflecht, das sich ständig wandelt.
Umherstreifende Menschen…
Da gibt es einen Lateinamerikaner, einen Kolumbianer, der bis kurz vor Ende des Buches namenlos bleibt. Er erscheint weder als Tourist noch als Geschäftsreisender, aber dauerhaft bleiben will er auch nicht, denn Frau und Arbeit hat er in Cali zurückgelassen. Sein Aufenthalt verzögert sich, weil ihm in einer durchzechten Nacht der Pass gestohlen wird. Während seine mitgereisten Freunde wieder heimfliegen, schlägt er sich mit immer weniger Mitteln in Tanger durch. Er streift durch die Straßen der Altstadt und kommt mit ihren BewohnerInnen in Kontakt. Zum Beispiel mit Rashid, von dem er sich mit Marihuana versorgen lässt, mit diversen Pensionsinhabern, Händlern, Taxifahrern und einem Tierarzt, aber auch mit zwei französischen Frauen, die sehr von ihm angetan sind und ihn zu sich aufs Land einladen.
Und es gibt die Einheimischen. Das sind einerseits diese Städter, andererseits aber eine Familie, die arm und auf althergebrachte Weise in der Nähe von Tanger an der Küste lebt. Hamsa, der Junge, verdingt sich als Schafhirt; die Großeltern arbeiten im Anwesen der erwähnten Französinnen. Hamsas Onkel hingegen hat die Welt seiner Vorfahren verlassen, er lebt in Spanien und verdient an den illegalen Überfahrten über die Meerenge von Gibraltar. Bald soll Hamsa seinem Onkel einmal helfen – als Wachposten auf der marokkanischen Seite. Dort kennt er sich aus. Bereits jetzt schon trägt Hamsa ein Kennzeichen der globalisierten Welt an den Füßen: ein Paar imitierte Nikes.
Schließlich gibt es noch eine Eule. Sie, die nachts sehen kann und die „jede auch noch so unscheinbare Bewegung in ihrem Umkreis“ wahrnimmt, wie es im Buch heißt – sie wird ihrerseits von den Menschen gesehen. Den alten Griechen war sie ein Symbol für die Weisheit. Der Kolumbianer kauft sie in der Altstadt einem Jungen ab, weil er auf ihre Augen aufmerksam wird, auf ihren wachen, genauen Blick. Sie wird ihn begleiten, ihretwegen zieht er um und prügelt sich mit einem Dieb, und ihretwegen ergreift ihn, als sie ihm das zweite Mal gestohlen wird, „ein Gefühl von Verlorensein, das nichts mit einer einfachen Eule zu tun haben konnte.“
…und eine Eule als heimliche Hauptfigur
Es ist überzeugend, dass in einem Buch, welches so sehr auf die Sinne und das Sehen orientiert ist, das „Seh–Tier“ Eule der rote Faden ist. Faszinierender noch als die Symbolik fand ich, wie Rey Rosa diese Eule zeichnet. Ohne Sentimentalität, aber mit großer Zärtlichkeit ist hier ein Mensch in der Lage, ein Tier als Gegenüber ernst zu nehmen und aus seiner Anwesenheit Konsequenzen zu ziehen – ein besonderes Kleinod in diesem Roman.
Für die Marokkaner gilt die Eule als Unglücksvogel. Aber die Leute glauben auch, wenn man ihr die Augen ausreißt und diese als Amulett trägt oder isst, dann kann man die Nacht über wachen und schläft nicht ein. Deshalb ist der Hirtenjunge Hamsa derjenige, der sie dem Kolumbianer stiehlt, als er sich bei den Französinnen aufhält. So soll die nächtliche Wache für Hamsas Onkel gelingen. Aber nicht nur der Kolumbianer und Hamsa, sondern auch ein Tierarzt, ein Konsul, ein Drogenhändler und die Französinnen, alle haben sie ein Verhältnis zur Eule, ihr je eigenes Verhältnis, welches sich von dem der anderen unterscheidet.
Was Rey Rosa an der Eule vielleicht am ausführlichsten zeigt, zieht sich motivisch durch das gesamte Buch: Immer wieder geht es um die Unterschiede oder die Übereinstimmungen zwischen dem, wie verschiedene Menschen etwas wahrnehmen.
Zum Beispiel: Während Hamsa von den kalten Winden am Meer drei Tage lang ernsthaft krank wird, teilt Madame Choiseul, die ältere der Französinnen, mit: „Ich leide, wenn es kalt ist“, und zündet den Kamin an. Während ein marokkanischer Gast bei Madame Choiseul erklärt: „Es ist doch völlig in Ordnung, dass Schwarze ohne Aufenthaltserlaubnis eingesperrt werden“, überlegt Hamsa wenige Schritte entfernt, auf der anderen Seite des Gartens, wie er genau deren nächtliche Überfahrt bewachen kann. Das, was für Hamsa lediglich das „Hauptgebäude“ ist, in dem seine Großeltern arbeiten, ist für den Gast drinnen ein „mit Blumentöpfen überfüllter Wohnraum, in den das Licht durch mehrere Rundbogenfenster“ fällt.
Dabei ist „Tanger“ sicherlich kein Sozialroman. Rey Rosa spart sich alle eindeutigen Fragen (ganz zu schweigen von den Antworten). Seine Absichten lässt er im Verborgenen und überlässt das Erkunden denen, die den vielfältigen, sich immer weiter verzweigenden und überlagernden Wahrnehmungsbeziehungen folgen wollen. Auch der Name des Kolumbianers, den wir kurz vor Schluss noch erfahren, ist kein Zufall: Ángel Tejedor, Ángel der Weber. Es ist ein höchst anspielungsreiches Gewebe von 55 kurzen Abschnitten, das Rey Rosa bietet, ein zwar weitgehend linear erzähltes Buch, das aber beim Lesen doch einige Rätsel aufgibt. Ein spanischer Rezensent hat das auf den Punkt gebracht: Rey Rosa sei ein Autor, „dem es gelingt, in vier Zeilen vier Dinge zu erzählen und 26 anzudeuten.“
Wer Bücher mag, die sich nicht gleich von selbst erschließen, sondern solche, in denen man blättern muss, um nachzulesen, wie dieser Baum, jener Garten einige Seiten vorher beschrieben wurde, – der wird an „Tanger“ reichlich Spaß haben. Gratis dazu gibt’s die Lust, sich die Stadt einmal anzusehen.
Valentin Schönherr
Rodrigo Rey Rosa: Tanger. Aus dem Spanischen von Arno Gimber. Rotpunktverlag, Zürich 2002, 188 Seiten, 17,50 Euro