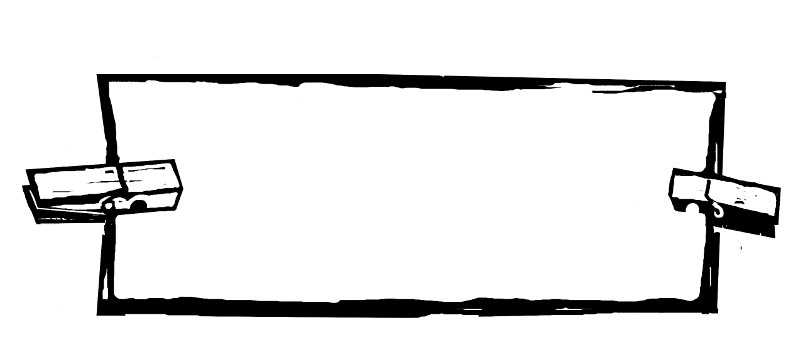Wer zahlt?
Das Jahrbuch “Lateinamerika – Analysen und Berichte” präsentiert “Offene Rechnungen”
“Die Welt wird kleiner, Lateinamerika rückt näher. Es ist auch unsere Sache, die dort verhandelt wird”, hieß es im Vorwort der ersten Ausgabe von “Lateinamerika – Analysen und Berichte”. Der Anspruch, den die HerausgeberInnen 1977 an ihre gerade aus der Taufe gehobene Jahrbuch-Reihe stellten, war es, die wirtschaftliche und politische Entwicklung des Subkontinents darzustellen und kritisch zu diskutieren. Eine Entwicklung, die – so die AutorInnen – “in eine eindeutige Richtung” ging: Hin zu einem Modell der Kapitalakkumulation, das die Kombination von wirtschaftlichem Liberalismus mit extremer politischer Repression benötigte, um hohe Profite zu erzielen. Tatsächlich ergab der Blick auf Lateinamerika in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre – nach Chile und Uruguay hatten sich nun auch in Argentinien die Militärs an die Macht geputscht – ein reichlich düsteres Bild. Hoffnungen auf revolutionäre Veränderungen hin zu einer gerechteren Gesellschaft, sei es nach kubanischem oder chilenischem Vorbild, wurden allmählich zu den Akten gelegt.
Zehn Jahre später stellten die unfreiwilligen “Chronisten von Niederlagen” zwar nicht ihre damaligen Einschätzungen in Frage, gingen aber dennoch mit sich ins Gericht: Skepsis sei angebracht gegenüber der in den ersten Bänden praktizierten Lesart der lateinamerikanischen Aktualität – basierend auf der Überzeugung, anhand ökonomischer “Akkumulationsmodelle” ließen sich quasi automatisch Tendenzaussagen über die politische Zukunft im “abhängigen Kapitalismus” treffen. Solcherlei “Ableitungen” hatten der komplexen Wirklichkeit der jeweiligen Länder nicht Rechnung getragen und ließen umgekehrt auch nur mangelhaft auf die Qualität der Gegenkräfte zur herrschenden Ordnung schliessen. Was die Beobachtung jener anbetraf, brauchte sich das Jahrbuch-Team freilich keine Vorwürfe gefallen zu lassen. “Neue Organisations- und Kampfformen” gegen wirtschaftliche Marginalisierung und politische Unterdrückung – Stadtteilbewegungen, Basisgemeinden, Indígena-Organisationen und linke Parteien jenseits leninistischer Konzeptionen – hatten von Beginn an das Augenmerk der HerausgeberInnen gefunden. Nur – voraussagbarer wurde die Zukunft Lateinamerikas damit auch nicht.
Verdrängung allerorten
Im zwanzigsten Jahr der “Analysen und Berichte” war es wieder einmal an der Zeit, sich anhand der Entwicklungen der vergangenen Jahre über die “Zukunftsfähigkeit” des Untersuchungsobjektes Rechenschaft abzulegen. “Offene Rechnungen” heißt dementsprechend Band 20 der Reihe, denn – so die im Vorwort geäußerte Ansicht – zukunftsfähig ist Lateinamerika nur, wenn nicht “Vergessen und Verdrängen” die Tagesordnung bestimmen. Vergessen und verdrängt wird freilich überall, und in eigener Sache fehlt nicht der Hinweis auf die Gefahr, die “besseren Einsichten von gestern” – Solidarität mit den sozialen Kämpfen und das Ziel einer befreiten Gesellschaft – der modischen Anpassung an herrschende Terminologie und Themensetzung zu opfern.
Offensichtlich unbewältigte Schatten der Vergangenheit sprechen die ersten beiden Beiträge an. Daß die Ökonomie in Chile “zur Staatsreligion erhoben” worden ist, und die Regierenden eine konsequente Aufarbeitung der unter der Diktatur begangenen Menschenrechtsverletzungen scheuen, schildert David Becker und liefert zudem eine überzeugende Analyse der psychischen Mechanismen bei den Opfern, aber auch der Bevölkerungsmehrheit. Die “internalisierte Angst”, so Becker, ist das zentrale Element der neuen chilenischen Demokratie: Nachdem die auf dem zuerst nur zähneknirschend akzeptierten Konsensprinzip basierende transición zumindest teilweise gelungen war, blieb die traumatische Erinnerung an Putsch und Repression der Garant für die “politisch wirksame Gleichung Konflikt = Zerstörung = Neuauflage der Diktatur”.
Unter diesem Vorzeichen werden Mutlosigkeit und fehlender Wille der regierenden Concertación und ihrer christdemokratischen Präsidenten verständlicher, wenn auch nicht legitimer. Tragischerweise deckt sich hier der Wunsch vieler Politiker nach schnellem Vergessen und weitgehend folgenlosen Symbolhandlungen mit dem Bedürfnis der nicht direkt von der diktatoriellen Repression betroffenen ChilenInnen, Konflikten aus dem Weg zu gehen. Folteropfer und Angehörige von Verschwundenen sehen sich in einem Umfeld mangelnden Erinnerungswillens neuerlich diskriminiert. Das, meint Becker, muß allerdings nicht so bleiben: Trotz aller Versuche seitens Präsident Frei und seinem Technokratenteam, mißliebige Erinnerungen an Vergangenes auszuklammern, meldet sich dieses immer wieder zu Wort – und sei es durch das Säbelrasseln der Militärs. “Das unvermittelt Konflikthafte kann nicht mehr unter den Teppich gekehrt werden, es sucht sich seinen Weg an die Öffentlichkeit. Und das ist ein wesentlicher Bestandteil einer echten Demokratisierung.”
Linke Altlasten
Gedächtnislücken einer ganz anderen Art beschreibt Ricarda Knabe in ihrem Bericht über die Studie, die eine salvadorianische Frauenorganisation unlängst der FMLN und der aus ihr hervorgegangenen Partido Democrático vorgelegt hat. Das Thema ist brisant, geht es doch um die Rolle der Frauen im Guerillakampf, genauer: um ihre Sexualität. Viele der guerrilleras – entstammten sie nun dem hauptstädtisch-intellektuellen Milieu oder den Dörfern im Kriegsgebiet – litten nicht nur an der Brutalität der Kämpfe sondern ebenso an der sexuellen Diskriminierung durch ihre eigenen compañeros und die Bevormundung durch die FMLN-Hierarchie. Diese, so die Autorinnen der Studie, hatte in den ersten Kriegsjahren noch eine rigide Kontrolle über das Privatleben der GenossInnen ausgeübt und qua selbst durchgeführten Eheschließungen (revolutionäre) Moral praktiziert. Später, als Kampfbereitschaft Priorität vor ideologischer Festigkeit gewann und diese Einflußnahme nachließ, kamen etliche der in den Camps lebenden Frauen vom Regen in die Traufe. “Den Körper mit den Genossen solidarisch teilen”, war ein häufig mißbrauchtes Schlagwort. Den guerrilleras, die aus eigener Entscheidung ein promiskuitives Verhalten praktizierten, schlug freilich nicht selten die geballte männliche Verachtung entgegen. Daß diese Problematik inzwischen offen thematisiert und diskutiert wird, hält Knabe freilich für eine hoffnungsvoll stimmende Errungenschaft.
Die “Multis”: unheilvolle Wohltäter
Der Frage “Was von den Multis noch zu erwarten ist” geht Urs Müller-Plantenberg in seinem Artikel nach. Dabei konstatiert er die bemerkenswerte Wandlung, die die Beurteilung transnationaler Unternehmen in Lateinamerika selbst in der Sichtweise einstiger Kritiker durchgemacht hat: Wurden die “Multis” zu Zeiten der “Importsubstituierenden Industrialisierung” mit Argwohn betrachtet und nach Möglichkeit rigiden Kontrollen unterworfen, hat spätestens seit den achtziger Jahren ein Wettlauf um die Gunst der ausländischen Wohltäter eingesetzt.
Aufschlußreich ist Müller-Plantenbergs historische Analyse, mit der er zu zeigen versucht, wie gering schon immer der tatsächliche Beitrag transnationaler Unternehmen zum ersehnten Kapitalzufluß gewesen ist. Das gegenwärtige, gerade von steigenden Portfolioinvestitionen geprägte Szenario ist noch bedenklicher: In dem Maße, in dem das global allgegenwärtige Kapital dank moderner Technologie immer mobiler, ja “scheuer und flüchtiger” geworden ist, überwiegt das Risiko des unkontrollierbaren Zusammenbruchs, eines Kollaps, wie er Mexiko 1994 ereilte.
Auch die Hoffnung auf Beschäftigungseffekte und Technologietransfer, die Direktinvestitionen entgegengebracht wird, hält einer eingehenderen Betrachtung nicht stand. Dennoch ist die Gier nach frischem Kapital nicht einfach ein “frommer Selbstbetrug” wirtschaftsliberaler Regierung, folgert Müller-Plantenberg. “Vielmehr entsprechen massive Direktinvestitionen auch den handfesten Interessen derer, denen es darauf ankommt, ein Wachstumsmodell zu fördern, das schnelle Bereicherung erlaubt und unter der Drohung von möglichen Kapitalabflüssen immer weiter geführt werden muß.”
Handfeste Interessen weltweit agierender Konzerne stehen auch im Mittelpunkt der Debatte um “Biodiversität”, die Elmar Römpczyk nachzeichnet. Vor allem Pharmaunternehmen aus den USA versuchen, sich die Verfügungsgewalt über den genetischen Reichtum des tropischen Lateinamerika zu sichern – sei es mittels Druck auf internationale Gremien wie die Welthandelsorganisation WTO oder Lobbying bei lateinamerikanischen Regierungen. Sollte es diesen “Multis” gelingen, so Römpczyk, über die Schaffung eines verbindlichen Patentschutzsystems die Resultate ihrer Forschung zu monopolisieren und dementsprechend exklusiv zu verwerten, käme den Ländern des Südens einer ihrer größten Reichtümer – die Verfügung über ihre Artenvielfalt – abhanden. “Nebeneffekt” der transnationalen Offensive ist der skrupellose Eingriff in den Lebensraum der indigenen Völker, die den Kapitalinteressen nur insofern von Nutzen sind, als sie durch ihr tradiertes Wissen eine Informationsquelle über die Anwendung des “genetischen Materials” abgeben können.
Perspektiven für eine gerechtere Nutzung der Biodiversität sieht Römpczyk in ersten Initiativen indigener Gruppen, die sich ein Mitspracherecht erkämpft haben, aber auch in einer Weiterentwicklung der 1992 in Río geschaffenen Biodiversitätskonvention.
Die Kosten der (De)industrialisierung
Anhand der brasilianischen Aluminiumproduktion versucht Dieter Gawora, “offene Rechnungen” im Amazonasgebiet aufzuzeigen. In diesem Falle handelt es sich zwar weniger um den direkten Einfluß der allgegenwärtigen Transnationalen, wohl aber um die ökologische Zerstörung und ethnische Verdrängung, die Großprojekte wie die extrem energieintensive Aluminiumgewinnung und -verarbeitung zu verantworten haben.
Detailliert schildert Gawora die Situation am Rio Trombetas, einer Region mit reichen Bauxitvorkommen, in der seit Ende der sechziger Jahre entstandene Förderstätten und Retortenstädte die Nachkommen der vor zwei Jahrhunderten in dieses Gebiet geflohenen afrikanischen Sklaven, der quilombos, verdrängen. Im Zusammenhang mit einem Staudammkomplex, der den Energiebedarf der Produktion sichert, treiben die Aluminiumkonzerne die Umweltzerstörung voran; kritische GewerkschafterInnen werden mit zum Teil kriminellen Methoden mundtot gemacht. Gaworas Fazit: “Großprojekte sind immer geprägt von einer Ignoranz gegenüber ‘den anderen’. Sie sind unvereinbar mit ethnischen Differenzen und traditioneller Wirtschaftsweise”.
Mit Akribie und einer Fülle an Datenmaterial schildert Paul Singer eine andere Facette brasilianischer Realität: die fortschreitende Deindustrialisierung, ja “ökonomische Aushöhlung” des Großraums Sâo Paulo, wo sich vor den Inflationskrisen der achtziger Jahre und der in den Neunzigern forcierten Weltmarktöffnung mehr als ein Drittel der industriellen Arbeitsplätze Brasiliens konzentrierte. Symptomatisch für die Folgen der Strukturanpassung ist auch die stetige Zunahme prekärer, da informeller Arbeitsverhältnisse und ein Anwachsen der ohnehin starken Einkommenskonzentration.
Eine Option, sinnvoll auf die kurzfristig kaum umkehrbaren Rahmenbedingungen von Marktöffnung und Strukturkrise zu reagieren, erkennt Singer in dezentralen Kompensationspolitiken. Darüber hinaus denkt er über die Möglichkeit nach, “ausgehend von Initiativen der Stadtregierungen gemeinsam mit Kräften der Zivilgesellschaft einen neuen Wachstumszyklus zu eröffnen”, indem das enorme brachliegende Arbeitspotential der Arbeitslosen, Informellen und Unterbeschäftigten in “angepaßten Formen der Organisierung der Produzenten” aktiviert wird. “Alle Organisationsformen sind möglich, von isolierten oder zusammengeschlossenen Privatunternehmen bis zu kollektiven Unternehmen wie Kooperativen, Produktionsgemeinschaften oder was sonst noch ausgedacht und ausprobiert werden könnte”.
Revolutionäre Werte in Erosion
Inwiefern die kubanische Revolution alte Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten nicht restlos hat beseitigen, sondern nur verdrängen können, beschreibt abschließend Bert Hoffmann. Lange nicht für möglich gehaltene “Comebacks” – von der Wiederkehr des Weihnachtsfestes über die öffentliche Akzeptanz der santería bis hin zum Aufleben des latenten Rassismus – haben die Versuche von Partei und Regierung den KubanerInnen beschert, Wege aus der wirtschaftlichen Misere zu finden. Daß mit der faktischen Legalisierung des Dollarbesitzes, der beginnenden Liberalisierung der Arbeitsverhältnisse und den Privilegien des devisenträchtigen Tourismusgeschäftes neu-alte soziale Ungleichheit entstanden ist, erscheint noch weniger erschrekkend als die Renaissance einer rassistischen Mentalität, die von einem ebenso neuen wie alten sozialen Gefälle zwischen den Ethnien genährt wird. Das ideologisch verordnete Gleichheitspostulat erweist sich hier als wenig tragfähig, galten doch auf Kuba zaghafte Ansätze ethnischer Selbstartikulation etwa als “schwarzer Rassismus”. Für Hoffmann stellt gerade die von der kubanischen Führung betriebene Ineinssetzung von Revolution und sozialistischem Staat in diesen Krisenzeiten eine Gefahr dar, denn “wenn diese Verknüpfung nicht aufgebrochen werden kann, droht der Legitimitätsverlust des politischen Systems auch die der Revolution zugrundeliegenden Werte insgesamt in Frage zu stellen”.
Trotz der zum Teil ausgesprochen lesenswerten Artikel krankt die Konzeption des Jubiläumsbandes an der zu weit formulierten und locker gehandhabten Themenvorgabe. Vorausgegangene Ausgaben konnten deutlich stringenter der bewährten Schwerpunktsetzung folgen. Sicher: “Offene Rechnungen” werden präsentiert. Bloß läßt sich diese Interpretationshilfe mit ein wenig Geschick auf nahezu alle sozialen, politischen und ökonomischen Problematiken anwenden.
Daß die Herangehensweise der AutorInnen an ihr Thema stark variiert, hat weniger Auswirkungen auf den Gehalt ihrer Darstellungen als auf die Lesbarkeit. Während die HerausgeberInnen Singers Beitrag im Vorwort zu Recht als “sperrig” bezeichnen, fällt Hoffmanns feuilletonistischer Stil wohltuend auf.
Lesenswert sind wie immer die Länderberichte, die im zweiten Teil die Ereignisse des vergangenen Jahres in Brasilien, El Salvador, Guatemala, Haiti, Kolumbien, Kuba, Mexiko und Venezuela nachzeichnen. Bedauerlich ist allerdings die im vorliegenden Band reduzierte Anzahl von Ländern: Während durch den Kuba-Artikel eine gewisse Dopplung entsteht, wäre der Blick auf ein anderes der hier fehlenden Länder – Argentinien, Bolivien, Peru oder Ecuador – wünschenswert gewesen.
Nichts Neues in Sicht?
Die Zeiten großer gesellschaftlicher Gegenentwürfe sind vorbei. Zwar ist dem HerausgeberInnenteam zuzustimmen, daß sich “zentrale Fragen internationalisierter Ausbeutung und des Spielraums von Emanzipationsbewegungen gerade in Lateinamerika in exemplarischer Weise stellen”. Die Texte dieses Jahrbuches sind durchaus in der Lage, dies zu zeigen. Mit Vorschlägen für gangbare linke Alternativen – etwa wie der Globalmacht der “Multis” zu begegnen sei – halten sich allerdings die meisten AutorInnen vorsichtig zurück oder bleiben vage. Das Vorwort vermerkt dies mit Selbstkritik und verweist nur auf Singers locker konzipierten Entwurf einer Basisökonomie jenseits von Staatsunternehmen und Finanzkapital, da dieser “eine Diskussion über vorhandene und nicht vorhandene Alternativen der Linken zum Neoliberalismus eröffnen könnte”.
Eine revidierende Feststellung mußten die HerausgeberInnen – zwanzig Jahre nach Erscheinen des ersten Bandes – allerdings treffen: Lateinamerika steht nach den weltweiten Veränderungen der letzten Jahre zweifelsohne nicht mehr im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Daß dennoch auch im deutschen Sprachraum aktuelle und kritische Forschung weiterhin ein Sprachrohr hat, ist nicht zuletzt auch ein Verdienst der “Lateinamerika”-Reihe.
Lateinamerika – Analysen und Berichte 20: Offene Rechnungen, hg. von Karin Gabbert u.a., Horlemann 1996.