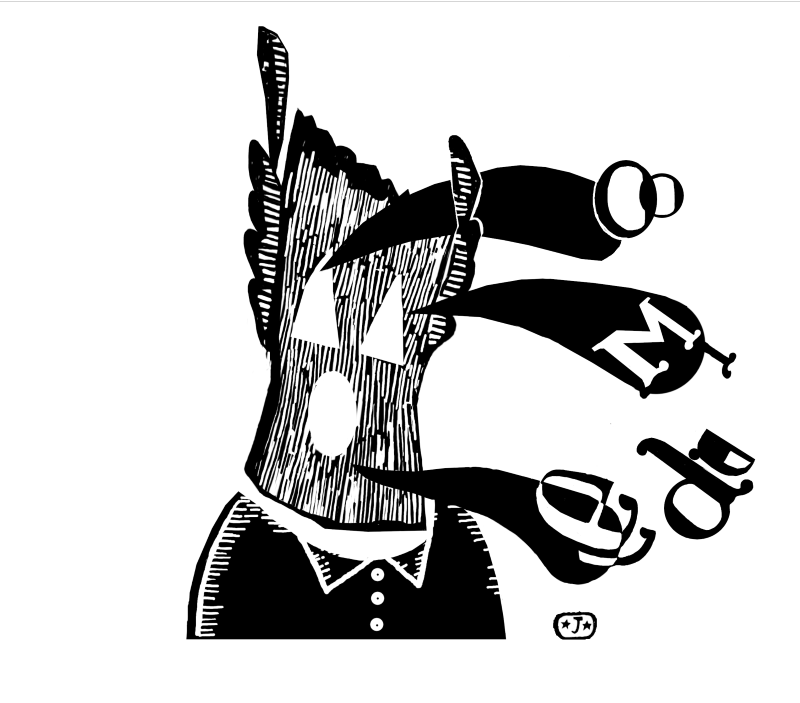Der Club der einsamen Träumer^
Notizen zu La Negra, dem neuen Roman von Raul Zelik
Die Orte: Barrancabermeja, die Erdölstadt am mittleren Magdalena, erleuchtet vom unwirklichen Licht der über den Häusern züngelnden Flammen. Eine “Leidenschaft, die man nicht los wird”, eine Stadt, wo man den Kapitalismus noch für eine schwere, aber besiegbare Krankheit hält. Medellín, Medallo, die becircende und blutrünstige Metropole; und schließlich die Kordillere Kolumbiens, je nach Blickwinkel des Betrachters die “rot-schwarze Heimat des Aufbegehrens” oder ein matschiges Dreckloch, wo das Wasser durch die Haut dringt und Mücken das Leben zur Tortur machen.
Die Truppe der Verrückten
Die dramatis personae: Flacoloco, der Dünne, Experte für elektronische Schwingkreise, der dem Wahlspruch seiner Mutter folgt, “den Schweinebacken Saures zu geben”. Sein Traum, mit Jugendlichen aus dem Stadtteil Altavista – “von hier oben blickt man in die Zukunft” – in Medellín ein Theaterstück von Dario Fo aufzuführen, scheitert an deren hartnäckiger Begeisterung für die Telenovela Elfrieda. Er liebt: Luisa, genannt La Negra, die Brasilianerin, a preta louca, die von Recife nach Kolumbien gegangen ist, weil Brasilien kein Land ist, um Revolutionen zum machen. Beide haben mit Ricardo, dem Blonden, zu tun, Comandante Nr. 5 der ELN, in früheren Zeiten Mitglied eines Haufens “beschlagener Neurotiker” und undisziplinierter Hippies, die sich Revolutionäre Studentenfront ohne Erlaubnis nannten. Heute ist er der unnahbare Stratege und in unbeobachteten Momenten der traurige Poet.
Geradezu verneigen möchte man sich vor der himbeerfarben geschminkten Camila, einer höflichen, wenn auch exzentrischen alten Dame, hinter der niemand die nervenstarke Verbindungsfrau vermutet, die den Ehrennamen “Heilige Teresa des Pulverfasses” trägt. Dann gibt es noch den Gewerkschafter Pablo García und Edith “vom Walde” Dubois, Telefonistin und unvermutete Sympathisantin bei der EU in Brüssel.
Ein wundervolles, kleines ejército loco also, welches im Sturm die Herzen der LeserInnen erobert. Sie eint der Traum von dem großen Ding, einer Sache, die Mut macht, die wirklich Sinn hat. Tatsächlich scheint sie unter dem Codewort “Glücklicher Kondor” Gestalt anzunehmen. Der Name ist einem argentinischen Film entlehnt, der in einer Parallelstruktur zur Haupthandlung des Romans von Flacoloco erzählt wird. Er spielt Mitte der 70er Jahre, handelt von Leuten, die “nach den Sternen griffen”, “sinnlos Kopf und Kragen riskierten”, Leuten wie ihnen selbst. Die Hauptdarstellerin reist mit ihrem Geliebten, einem ERP-Mitglied, in die Atacama-Wüste nach Nordchile. Ist das das Glück: eine atemberaubende, absolute Stille, ein grenzenloser Blick, wie ein Vogel im Aufwind, ein großer, glücklicher Kondor?
Für die verrückteste Sache der Welt
Doch da sind auch noch zwei komische Missionare, die sich der Bekämpfung Satans verschrieben haben. Der Viersternegeneral Ibrahim Ayala Diez, der Paramilitär und Vladimir, ein Mann mit Stiernacken und Goldkette in einem Chevrolet-Jeep mit getönten Scheiben. Und plötzlich entgleist die Geschichte, und man glaubt, sich in einem Splatterfilm zu befinden. Der Einbruch der Katastrophe, der Einbruch der kolumbianischen Realität, die ein naives Happy End verbietet?
Jedenfalls gerät der Roman ins Trudeln. Die – überlebenden – ProtagonistInnen, die LeserInnen (und der Autor?) haben Mühe, sich wieder aufzurappeln, eine Sprache für den Horror und den Schock zu finden, nachdem sie sich an den locker-ironischen Tonfall gewöhnt hatten.
Der Parallel-Film endet in einem “dunklen, fast blauen Rauschen”, das in eine erschreckende Stille mündet. Dort als letztes Bild der Strand, der Blick aufs Meer, auf die sich auftürmenden Wellenberge. Es ist die Zeit des Militärputsches, der argentinischen Tragödie. In der zwanzig Jahre später in Kolumbien spielenden Handlung entwickelt Luisa einen neuen Aktionsplan. Zwar fehlt ihm die Kraft des Ursprünglichen und er ist von Rachegefühlen geleitet, doch stemmt er sich der Niederlage entgegen, weil nichts zu tun falscher ist, als das Falsche zu tun.
Die beiden Handlungsstränge loten das Dilemma der Linken aus, die eine Antwort auf den Exzess der herrschenden, hier paramilitärischen Gewalt finden muss, ohne sie dabei einfach überbieten zu dürfen. Eine eindeutige Lösung gibt es nicht. Zum Schluss steht ein Paradoxon: Eine Aktion, hinter der “keine Träume mehr oder nur noch böse” stehen, wird zur Eintrittskarte in den Club der einsamen Träumer, den “Club, der nie stirbt, wie man hier sagt”.
All dies ist nachzulesen in La Negra, dem zweiten, atmosphärisch sehr dichten Roman von Raul Zelik, der in facettenreicher Weise das Bild Lateinamerikas in den 70er Jahren mit dem Kolumbien von heute verknüpft. Sicher inspiriert von lateinamerikanischen Autorenvorbildern (warum auch nicht?) schlägt er doch einen sehr eigenen Ton an. Sein Kennzeichen: der Geist der Komplizenschaft mit all jenen, die es nicht lassen können, an die verrückteste Sache der Welt zu glauben: die “Revo”.