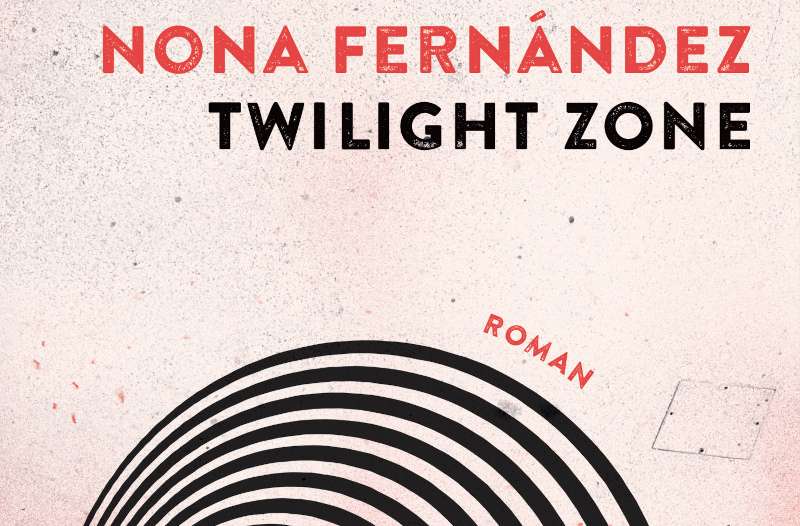Samuel Ruíz als Comic-Figur
Zum Roman “Schwestern” von Francesca Gargallo
Die Schwestern Amalia und Begonia wachsen im Italien der sechziger Jahre auf. Sie bewegen sich in marxistischen Studentenzirkeln und sind der Ansicht, etwas für das Wohl der Menschheit tun zu müssen. Aus der patriarchalen Welt der Eltern brechen sie auf, suchen nach gangbaren Wegen sich zu engagieren. Sie werden – so Amalia bei der FAO und Begonia als Leiterin eines kolumbianischen Kinderbuchverlags – Teil jenes entwicklungspolitischen Etablissements, das ja in den letzten Jahren tatsächlich ein beträchtliches Terrain in der Politik gewonnen hat. Mal leben sie ganz dicht beisammen, mal weit voneinander entfernt, aber in Kontakt bleiben sie immer. Dafür sorgt vor allem die Grundkonstellation dieser Geschwisterbeziehung: Während der attraktiven Amalia alles zufällt und ihr die Männer nur so nachlaufen, bleibt Begonia stets zweite Wahl. Nach langwierigem Hin und Her mit endlosen Job-, Orts- und Männerwechseln bleiben sich die Frauen schließlich selbst übrig und stellen fest, daß es sich so, gemeinsam, vielleicht von Anfang an am besten gelebt hätte.
Diese Geschichte taugt durchaus für einen Roman. Es könnte darin von einer Schnellebigkeit zu lesen sein, in der wir informationsüberfluteten Neuzeitmenschen uns wiederzuerkennen vermöchten. Worauf auch immer so ein Buch hinauswollte, ob auf eine Parodie des internationalen Politiktheaters, ob auf den Beschluß, sich per Ausstieg von dem ganzen Rummel fernzuhalten, ob auf das Lob der Langsamkeit oder darauf, uns slapstickartig vorzuführen, was für Kobolze unser Gehirn bei der täglichen Zeitungslektüre schießt – es ist vieles möglich. Es könnte darauf hinauslaufen, die Welt so gutzuheißen, wie sie ist, oder einen gewagten Denkvorstoß zu machen, bei dem einem die Luft wegbleibt, weil da noch keiner drauf gekommen ist – einerlei.
Wildern in der Vergangenheit
Francesca Gargallo, selbst gebürtige Italienerin und als junge Frau nach Mexiko gekommen, begnügt sich damit, durch die Hinterlassenschaften der letzten Jahre zu wildern. Dabei wird alles mögliche erwähnt, die brasilianische Militärdiktatur genauso wie der kolumbianische Bürgerkrieg, die sandinistische Revolution in Nicaragua und das Ende der Sowjetunion. Dom Helder Camara und Leonardo Boff stehen neben Lula und Samuel Ruíz. Amalia und Begonia machen jede Menge “Erfahrungen”, sie meditieren in einem Apenninkloster, lieben diesen und jenen, brausen durch die Welt, verirren sich im Amazonasurwald. Die Liste läßt sich fast beliebig fortsetzen. Aber das war es auch schon. Die Geschichte wird noch ein wenig in die Zukunft gesponnen, ohne daß sich dadurch irgendetwas ändern würde. Die Perspektive ist die von Begonia, die ihrer Nichte, also Amalias Tochter, alles erzählt. Aber dann ist seitenlang diese Du-Beziehung gar nicht wichtig, Begonia erzählt munter im Ich, und es hat gelegentlich den Anschein, als hätte sich die Autorin daran erinnert, daß sie ja in der Du-Form schreiben wollte, und fügt statt “Amalia” “Deine Mutter” ein… Es wird nicht klar, wozu die Perspektive eigentlich dienen soll.
Darin liegt die hauptsächliche Schwäche des Buches: Nichts bedeutet etwas. Alle Szenen, Figuren, Ereignisse, die so rasch ablaufen, wie wenn man ein Video schnell durchspulen läßt, sind einfach so da und im nächsten Moment wieder weg. Jede Meinung, die geäußert wird, kann auf der nächsten Seite vergessen sein, von ihrem Gegenteil verdrängt, entwertet. Die Geschichte ist eigentlich ein Comic; es fehlt jeder Schatten, es fehlen Nuancen, Verflechtungen und Wirkungen.
Nun deckt sich ja diese kurzlebige Bedeutungslosigkeit nur allzu genau mit dem, was uns alltäglich umgibt (nehmen wir nur das Fernsehprogramm). Und es wäre packend zu lesen, was diese unsere Wahrnehmung für Folgen hat, es wäre brisant zu erfahren, was in einem Menschen vor sich geht, der sich heute im Urwald etwas über die spirituelle Kraft des Mondes sagen läßt und morgen im Flugzeug große Entfernungen überwindet. Aber das ist für Gargallo alles kein Problem.
Francesca Gargallo setzt einfach noch eins obendrauf, sie spielt das Spiel mit und merkt nicht, was für eines es ist. Ein Satz als Beispiel, der zugegebenermaßen aus dem Kontext gerissen, aber doch typisch ist: “Als sein Flugzeug abhob, atmete ich erleichtert auf.” So einfach ist das: Das Flugzeug hebt ab, schlenz, sie atmet auf, hach. Alles klar, Problem gelöst. Fünfzehn Zeilen später schläft sie mit dem nächsten Mann.
Die Hast, mit der das Buch durch seine Geschichte stolpert, wird nie thematisiert. Aber es hat auch nicht den Anschein, als handle es sich um eine Parodie, um ein Dokument eines verpaßten Lebens, das uns auf dessen Verluste aufmerksam machen soll. Nein, die Eiligkeit, eine Bodenlosigkeit im eigentlichen Wortsinne, ist verinnerlicht, als Lebensform akzeptiert, für normal befunden. Die Comic-Figuren sind das Leben, und auf Schattierungen kann verzichtet werden.
Leider bleibt es nicht bei dem schauerlichen Mangel an Reflexion, denn auch sprachlich ist der Roman stellenweise ungenießbar. Zwar ist die Unbedarftheit, mit der die Personen durchs Leben geistern, in manchen Szenen gut getroffen, aber dazwischen stehen Formulierungen, bei denen sich einem das Nakkenhaar aufrichtet. Ein Beispiel: “Mich für Roberto anzuziehen, mich von ihm ausziehen zu lassen, eine bestimmte Bettwäsche auf unser Bett aufzuziehen, gemeinsame Pläne zur Wohnungsverschönerung, zu kochen und den Tisch für ihn mit Tischdecke und Blumen zu decken – das waren Ausdrucksformen eines rituellen Verhaltens, das ich in der zweifachen Absicht zelebrierte, ihm eine Freude zu machen und ihm zu zeigen, daß er mir gefiel.” Die “gemeinsamen Pläne zur Wohnungsverschönerung” passen weder grammatikalisch noch (in ihrem Bürodeutsch) stilistisch in den Kontext. Hat ein “rituelles Verhalten” “Ausdrucksformen”, oder ist nicht ein Ritual selbst schon Ausdruck? Weiter: “die Wunde des Zurückgewiesenseins”, “…die Personifizierung meiner eigenen Ablehnung des Normalen” – geht’s nicht ein bißchen eleganter?
Den Vogel schießt Gargallo mit folgendem Satz ab: “Mir gegenüber tat Amalia so, als seien die körperliche Verfassung ihres Mannes, die Unmengen Tabletten, die er schluckte, und die Fürsorge, mit der sie selbst ihn umgab, nicht so unübersehbar, daß ihre Angestrengung [sic], so zu tun, als habe sich in unserem Leben nichts verändert, sinnlos wurde.” Dafür würde selbst ein Philosophiestudent in seiner Proseminararbeit vom Professor ein “A” wie “schlechter Ausdruck” an den Rand gekritzelt bekommen.
Daß der Eichborn Verlag Francesca Gargallo im Klappentext zur “neuen Generation erfolgreicher feministischer Autorinnen Mexikos” rechnet, macht stutzig – was ist an diesem Buch feministisch? Daß die Erzählerin ihre sexuellen Lüste und Frustrierungen nicht draußenläßt, sondern einbezieht? Daß am Schluß angedeutet wird, daß die drei Frauen zusammenziehen? Oder soll das heißen, daß von Frauen geschriebene Literatur immer gleich feministisch ist? Wozu dann das Etikett? Zur Steigerung der Verkaufsrate, weil “feministisch” gut klingt?
Schließlich wird noch behauptet, diese Generation, zu der die Autorin des Erstlings nun gehören soll, wäre auch die von Elena Poniatowska. Einmal abgesehen davon, daß Poniatowska mit ihren ersten großen testimonios schon vor fast dreißig Jahren herauskam (Hasta no verte, Jesús mío, 1969/ La noche de Tlatelolco, 1971), liegen zwischen ihr und Gargallo Welten von sprachlicher Qualität und inhaltlicher Tiefe. Elena Poniatowska als Zugpferd vor ein schlechtes Buch zu spannen, sollte ein Grund mehr sein, das Buch nicht zu kaufen.
Francesca Gargallo, Schwestern, Eichborn Verlag, Frankfurt/Main 1996, 166 S.