„WIR WAREN SCHIMMELPILZE”
Die mexikanische Autorin Fernanda Melchor über feministischen Aktivismus in der Literatur und ihren neuen Roman Paradais
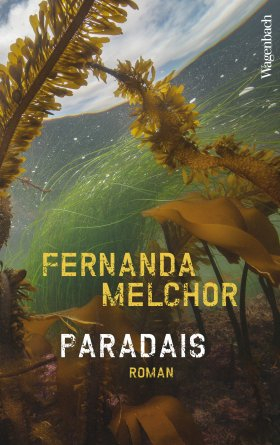
Foto: Wagenbach Verlag
Vor einem Jahr haben die LN ein Dossier zum Thema Feminizide und feministische Gegenwehr herausgegeben. Du behandelst die Problematik in deinen Romanen aus der Fiktion heraus. Welche Rolle kann die Literatur bei der Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt spielen?
Ich habe mich nie bewusst dafür entschieden, geschlechtsspezifische Gewalt anzuprangern. Vielmehr habe ich in meinem Leben die Folgen dieser Gewalt gesehen, ich bin mit ihr aufgewachsen, wenn auch mit gewissen Privilegien. Ich habe sie nicht so erlebt wie viele andere, aber auch ich habe familiäre Gewalt, Beziehungsgewalt, psychische Gewalt, körperliche Gewalt und auch sexuelle Gewalt erlebt. Das Schreiben war meine Art, darüber zu sprechen. Es hat mit dem Erfolg von Saison der Wirbelstürme zu tun, dass mich viele Leute danach fragen und ich mich hinsetzen und darüber nachdenken musste, was ich geschrieben habe. Aber so unschuldig war es auch nicht. Als ich mit Saison der Wirbelstürme fertig war, sagte ich mir: Ja, das ist, was in Mexiko passiert, das ist, was mich an Mexiko beunruhigt. Ich weiß nicht, ob die Rolle der Literatur darin besteht, die Dinge zu verändern. Ich persönlich bin der Meinung, dass Literatur kein angemessener Mechanismus für einen allgemeinen sozialen Wandel ist, weil sie von Person zu Person wirkt. Und in diesem Sinne denke ich, dass andere kreative Aktionen nützlicher sind. Ich denke zum Beispiel an das Lied und die Choreographie von LASTESIS. So ein poetisches Ausdrucksmittel, das Performance und Kollektivität beinhaltet, ist im übergreifenden Sinne viel mächtiger als ein Buch. Ich glaube schon, dass die Literatur dazu beitragen kann, einen sozialen Wandel herbeizuführen, aber das ist ein sehr langsamer Prozess, er beginnt mit der Erosion einer einzigen Person. Ich denke, die Literatur kann nur dann eine Veränderung bewirken, wenn sie darauf verzichtet, eine Veränderung bewirken zu wollen. Wenn sie von den Rändern eines Problems aus agiert. Wenn sie darauf verzichtet, Pamphlet zu sein, und darauf, eine Lektion zu erteilen. Wenn sie undurchsichtig arbeitet.
In deinen Romanen befasst du dich mit Feminiziden, es handelt sich aber um so komplexe Fälle, dass sie sich im Rahmen des juristischen Diskurses nicht so einfach einordnen lassen, sondern sich den Kategorien entziehen.
In Mexiko wurde viel darüber diskutiert, den Feminizid zu typisieren, ihn gesetzlich zu erfassen. Zum Beispiel, ob Verbrechen gegen Frauen, die mit dem organisierten Verbrechen zu tun haben, Feminizide sind. Viele sagten: „Nein, das hat mit den Narcos zu tun.“. Aber wer eine Frau tötet, um sich an einem Mann zu rächen, betrachtet diese Frau als ein Objekt des Mannes, daher denke ich, dass es sich sehr wohl um Feminizid handelt. Und wenn die Leiche in der Öffentlichkeit zur Schau gestellt wird, ist das eine der Typisierungen von Feminiziden in Mexiko, die auch aus den Erfahrungen der Juárez-Morde (siehe LN Dossier Nr. 18) resultiert. Die Sache mit den Feminiziden war etwas, das Saison der Wirbelstürme zugeschrieben wurde, aber nichts, was ich mir vorgenommen hatte. Der Roman wurde jedoch mit der Zeit als derjenige bekannt, der von Feminiziden in Mexiko handelt. Manchmal wurde nicht berücksichtigt, dass die Hauptfigur, die Hexe, eine trans Frau ist, dass sie manchmal auch genderfluid zu sein scheint. Das ist etwas, das ich auf undurchsichtige Weise behandeln wollte, weil ich mit der Mehrdeutigkeit der Figur spielen wollte. Ich wollte, dass sie eine vielschichtige, komplizierte Figur ist, die mehrere Aspekte thematisieren kann. Und mehr noch als eine direkte Problematisierung der Transphobie zu erreichen, wollte ich darstellen, wie eine bestimmte Person das Symbol für alle Ängste sein kann, die Männer eines Dorfes gegenüber Frauen im Allgemeinen empfinden. Und gleichzeitig erkunden, wie Frauen auch Gewalt ausüben, dass wir oft nicht nur passive Opfer sind. Ich denke, die wichtigste Lektion der Literatur besteht darin, dem Publikum zu zeigen, dass die Dinge nicht so einfach sind.
Etwas Ähnliches geschieht mit der intersektionalen Diskriminierung in deinen Romanen. Also mit jenem Konzept, das die vielen Marginalisierungsmechanismen beleuchtet, die Menschen ausgrenzen und sich gegenseitig beeinflussen. Ist diese Mehrdeutigkeit, diese Ungewissheit etwas Programmatisches in deinem Schreiben?
Ich habe nie über diese Kategorien nachgedacht. Ich kenne das Konzept, aber wenn ich schreibe, denke ich nicht daran. Mich interessiert dieses menschliche Element einzubringen, das immer mehrdeutig ist. Und jenseits der Kategorien schreibe ich über die Realitäten, die ich gesehen habe und die ich von innen kenne. Ich habe das Gefühl, dass wir uns im militanten Feminismus sehr darauf konzentrieren – aus gutem Grund – die Gewalt anzuprangern, die Männer gegen Frauen ausüben. Aber wir schweigen oft über die Gewalt, die wir selbst ausüben. Das ist etwas, das mich sehr motiviert. Ich fühle mich nicht wie ein perfektes Opfer. Ich war selbst Opfer von Gewalt, und ich habe Gewalt ausgeübt. Weil ich in einer Macho-Gesellschaft aufgewachsen bin, habe ich auch diesen Macho-Blick gelernt, und ich habe gelernt, anderen Frauen gegenüber machohaft zu sein. Ich habe all dies in meine Lebensweise integriert. Im Schreiben habe ich mich selbst dekonstruiert. Es ging darum, meine eigenen Narrative aus dem Kontext herauszunehmen, in dem sie entstanden sind, und mich zu fragen: Glaube ich das wirklich? Es ging darum, meine Narrative zu hinterfragen. Und dann ein anderes Narrativ zu konstruieren. Eins, das meinen wahren Ansichten gerechter wird.
Hast du dich auch deswegen in Paradais dafür entschieden, die Geschichte aus der Perspektive der toxischen Männlichkeit zu erzählen?
Ja. Paradais teilt viele Anliegen mit Saison der Wirbelstürme. Und ich fragte mich: Hey, willst du wirklich noch einen Roman über Männer schreiben, die Frauen schreckliche Dinge antun? Und ich sagte mir: Nun, das ist die Geschichte, die ich erzählen will. Denn ich war daran interessiert, mit diesen Schatten zu sprechen. Viele Leute überrascht das, sie fragen mich: Fernanda, wie schaffst du es, über die fragmentierte, gewalttätige Sexualität der Männer zu sprechen, wie kannst du das als Frau tun? Für mich ist das eine Möglichkeit, das zu erforschen, was ich kenne. Ich habe das alles doch auch verinnerlicht. Durch das Zusammenleben mit Männern, durch Gespräche, dadurch, dass ich sie lese, sie beobachte. Ich analysiere meine Beziehungen zu Männern. Ich verstehe nicht, warum das so überraschend sein soll, wenn doch Männer in der Lage sind, tiefgründig über weibliche Erfahrung zu schreiben und dies schon immer getan haben.
Einer der gravierendsten Unterschiede zwischen den beiden Romanen ist der Mangel an Zärtlichkeit in Paradais. Obwohl Saison der Wirbelstürme sehr roh und gewalttätig ist, gibt es dort Zärtlichkeit und Solidarität, Zuneigung zwischen Figuren. Hast du dich für Paradais davon verabschiedet?
Ich denke, wir werden bis zu einem gewissen Grad zur Empathie mit Polo, der Hauptfigur in Paradais, angehalten. Wir denken: armer Kerl. Er hat es echt nicht leicht. Er hat keine Vaterfigur, seine Mutter ist eine Frau, die mit allen Wassern gewaschen ist, und sie will ihm die Lektion erteilen: „Sohn, das Leben ist hart, auch du musst hart sein“. Und das ist alles irgendwo verständlich. Es ging mir darum, herauszustellen: Ja, armer Polito, aber er trifft schreckliche Entscheidungen, die viele Menschen betreffen, und diese feige ‚Es war doch nicht meine Schuld‘-Haltung hat mich an ihm sehr gestört. In Paradais gibt es also eine größere Distanz zur Figur. Und deshalb gibt es auch nicht so viel Empathie. Ich wollte aufzeigen: Seht euch diesen Kerl an, der sich für einen Macho hält, seht euch an, was er gerade getan hat, seht euch an, was für ein Feigling er ist. Seht euch an, wie er versucht, alle Frauen in seinem Leben für seine Misere verantwortlich zu machen, anstatt sich selbst zu betrachten. Ich habe das Gefühl, dass ich etwas weniger traurig und etwas wütender war, als ich Paradais geschrieben habe.
Ähnlich ist es mit der Hoffnung. In Saison der Wirbelstürme gibt es eine Spur Hoffnung, die in Paradais nicht existiert.
Paradais ist der Moment, in dem jemand erkennt, was er getan hat. Dass es kein Zurück mehr gibt und er an die Lüge denkt, die er allen erzählen wird. Es ist ein äußerst klaustrophobischer Roman. Saison der Wirbelstürme ist ein offenerer Roman, in dem diese Momente der Zärtlichkeit, von denen du gesprochen hast, sehr notwendig waren. Es gibt dort Personen, die wissen, dass sie schreckliche Dinge getan haben, oder die wissen, dass sie mehr verdient haben. Und die erkennen, dass sie anders hätten sein können, aber nicht konnten, eine sehr schmerzhafte Erkenntnis. Doch in Paradais scheint, von wenigen Ausnahmen abgesehen, der Hass zu überwiegen. Einer der wenigen Momente der Solidarität zwischen seiner Mutter und seiner Cousine ist Polos schlimmster Albtraum. Selbst die señora aus der Luxusanlage glaubt an Polo, während er nur aus seinem Hass heraus handelt. Ich wollte, dass der Roman das mentale Labyrinth einer Person darstellt, die von den Konditionierungen ihres Lebens völlig niedergewalzt wird. Der Alptraum eines Lebens, das in dem Versagen gefangen ist, das der machismo ist. Deshalb ist der Roman so schrecklich, aber auch so menschlich.
Der internationale Erfolg deiner Bücher seit Saison der Wirbelstürme ist außergewöhnlich. Hast du den Eindruck, dass es ein wachsendes Interesse an vielfältigen Stimmen in der Literatur aus Lateinamerika gibt?
Wir erleben heute, dass zum Beispiel in Europa ein großes Interesse daran besteht, Stimmen von Frauen aus der sogenannten Dritten Welt zu lesen. Das klingt ein bisschen seltsam. Neulich habe ich das auf einem Podium in Barcelona gesagt, und alle waren schockiert. Dort fragten sie uns: Welche Rolle spielt Barcelona als Zentrum des Verlagswesens der spanischsprachigen Welt in Ihrer Literatur? Und ich habe gesagt, dass wir eigentlich Pilze waren, Schimmelpilze, wir wuchsen im Dunkeln, in der Stille, niemand hat uns probiert, bis ein Markt uns entdeckt hat und festgestellt hat, dass es ein großes Interesse gibt, dass wir eine exquisite Speise sind und dass jeder über uns Bescheid wissen sollte. Tatsächlich schrieben wir, ohne jemals etwas zu erwarten. Jetzt sehe ich lateinamerikanische Autorinnen, die mit ihren ersten Romanen unter Vertrag sind und schon in Spanien veröffentlichen, was früher sehr selten war. Wir erleben gerade eine Art Bewusstseinserweiterung vieler Menschen und ein großes Interesse an Übersetzungen, sogar in Ländern wie Deutschland, die mit ihrer Nationalliteratur ziemlich verschlossen waren. Und diese Offenheit hat viel mit Feminismus zu tun, mit dem, was du über die Intersektionalität gesagt hast. Viele Menschen erkennen, dass es nicht ausreicht, immer nur das Gleiche zu lesen, dass sie an anderen Stimmen interessiert sind, an anderen Positionen und Orten.




