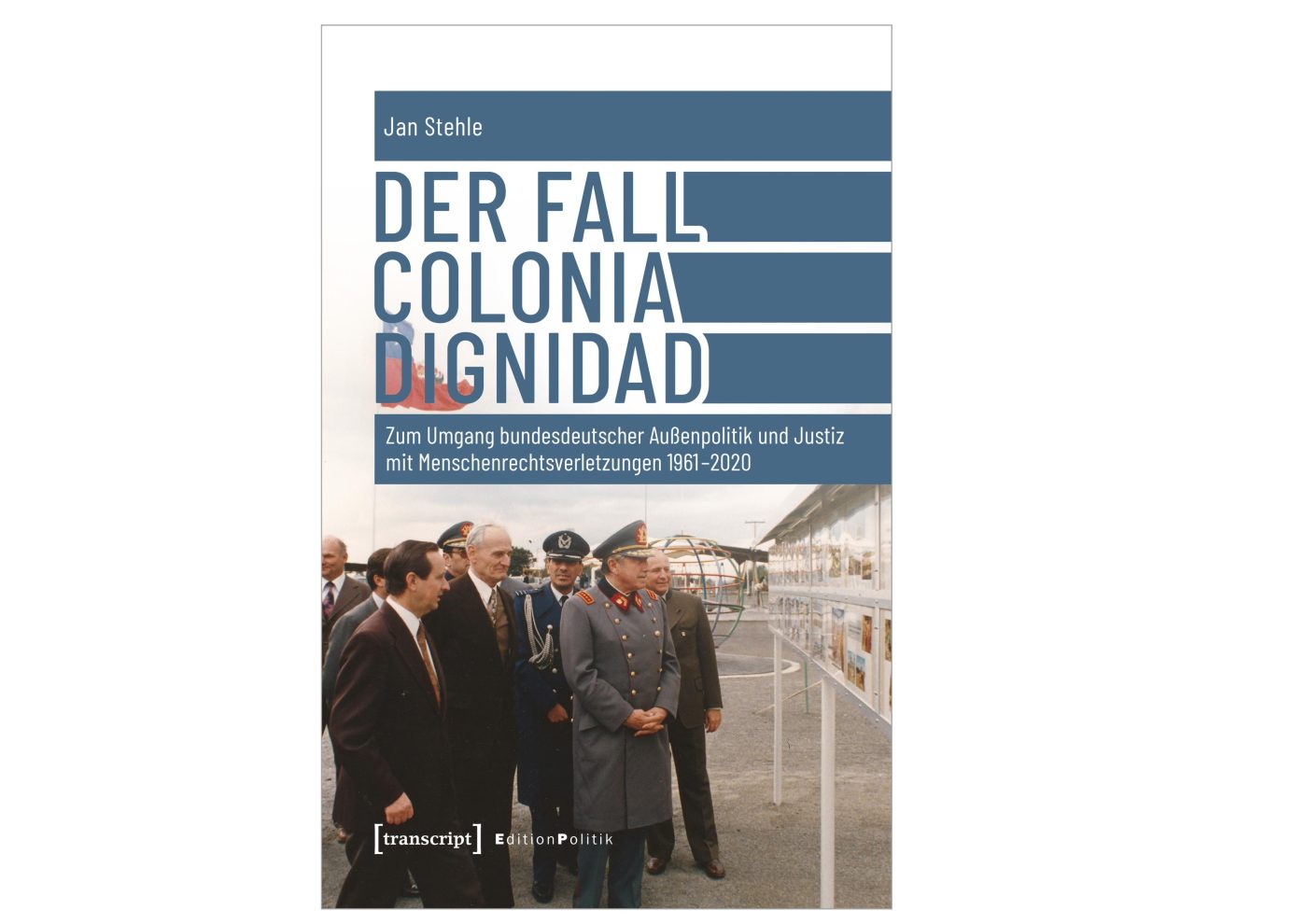Vor über 60 Jahren, im Jahr 1961, gründete der deutsche Laienprediger Paul Schäfer mit etwa 300 Anhänger*innen im Süden Chiles die sektenartige Gemeinschaft der Colonia Dignidad. Diese auslandsdeutsche Siedlung, die drei Jahrzehnte lang einen Status der Gemeinnützigkeit innehatte, war repressiv nach innen und kriminell nach außen. Der Alltag der Bewohner*innen war von unentlohnter Zwangsarbeit, sexualisierter Gewalt, Trennung von Frauen, Männern und Kindern sowie von Freiheitsentzug, Prügel und Erniedrigungen jedweder Art geprägt. Während der Diktatur (1973 bis 1990) richtete der Geheimdienst DINA ein Gefangenenlager in der deutschen Siedlung ein. Hunderte Oppositionelle wurden auf dem Gelände gefoltert, Dutzende ermordet oder zu Verschwundenen gemacht. Ihr Schicksal ist bis heute nicht aufgeklärt. Ihre Leichen wurden verscharrt, viele später wieder ausgegraben, verbrannt, ihre Asche im Fluss Perquilauquén verstreut.
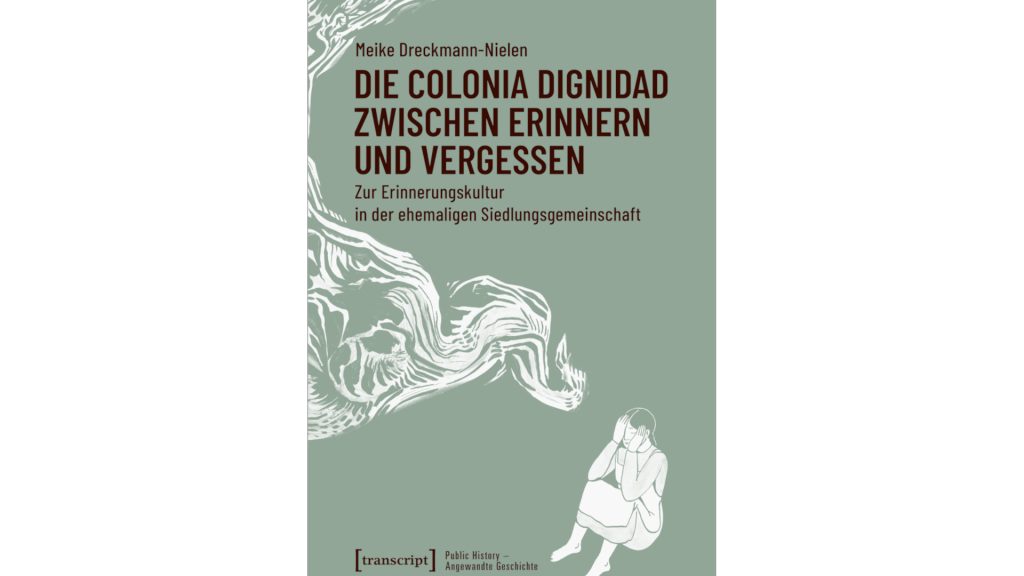
Die Historikerin und Kulturwissenschaftlerin Meike Dreckmann-Nielen präsentiert nun ihre Forschung zu Dynamiken im (B)Innenleben der Gruppe von Personen, die teils bis heute in der deutschen Siedlung leben, die sich inzwischen Villa Baviera (Bayerisches Dorf) nennt und von Tourismus und Landwirtschaft lebt. Im Jahr 2019 hielt sie sich mehrere Wochen dort auf und interviewte fast 20 Bewohner*innen. Außerhalb der Siedlung führte sie einzelne Gespräche mit Folterüberlebenden, Angehörigen von Verschwundenen oder Menschenrechtsgruppen, einer Psychologin und einem Psychiater. Auf Basis dieser Arbeit konnte Dreckmann-Nielen prägende Narrative und „innergemeinschaftliche Vereinbarungen“ unter den heutigen Bewohner*innen identifizieren. Im besonders lesenswerten und auch für Nicht-Wissenschaftler*innen gut verständlichen fünften Kapitel zu erinnerungskulturellen Dynamiken beleuchtet sie psychologische Aspekte und religiöse Einflüsse, die in dieser zusammenhängenden Form bisher nicht beschrieben wurden. Sehr treffend entwickelt die Autorin eine „Denkfigur“, die einen sich selbst reproduzierenden Kreislauf interner Dynamiken skizziert. Diese basieren auf der Erinnerungskultur der ehemaligen Siedlungsgemeinschaft, also dem bewussten Erinnern an historische Ereignisse, Persönlichkeiten oder Prozesse.
Religiöse „Vergebensmaxime“
Alltägliche Konflikte und auch schwere Verbrechen könnten demnach „nur innerhalb der Glaubensgemeinde“ geklärt werden, „weltliche Gerichte“ würden nicht akzeptiert. Eine „Spirale des Schweigens“ sei die Folge. Dass ehemalige Bewohner*innen kaum bereit sind, über die Strukturen der Siedlung und die dort begangenen Verbrechen zu sprechen, wird von Angehörigen der Verschwundenen als Affront empfunden. Die Historikerin zeichnet nach, dass das nicht nur die Straflosigkeit von Verbrechen der Diktatur fördert, sondern auch die historische Aufarbeitung und auch den Dialog zwischen Siedler*innen und Menschenrechtsgruppen blockiert.
Die Colonia Dignidad als „sich selbst verstärkender Resonanzraum“
Verfestigte historische Feindbilder, Konkurrenzgefühle zwischen verschiedenen Opfergruppen, Abgrenzung von „den anderen“ und Rückzug in die jeweils eigene Gruppe verstärken nach Dreckmann-Nielens Analyse das in der ehemaligen Siedlungsgemeinschaft bestehende Gefüge einschließlich der Vergebungsmaxime. Die Gruppe werde, so die Autorin, „zu einem sich stetig selbst verstärkenden Resonanzraum“. Allerdings sei dieser nicht statisch. Juristische, politische, monetäre Einflüsse von außen sowie psychosoziale Interventionen wirkten nach Dreckmann-Nielens Einschätzung auf die Aushandlung von Konflikten und damit auf den gesamten Kreislauf ein.
An aufklärerischen politischen und juristischen Einflüssen mangelt es allerdings. So hat die chilenische Justiz zwar einzelne Prozesse geführt und Urteile gefällt. Die deutsche Justiz hat jedoch bis heute keine einzige Anklage wegen Verbrechen der Colonia Dignidad erhoben. Die politische Aufarbeitung geht in Chile indes noch langsamer voran als in Deutschland. Dabei sind Verbindungen von Führungspersonen der Colonia Dignidad zur chilenischen Diktatur offensichtlich und sogar in einem von Siedler*innen selbst angelegten Geheimarchiv abzulesen.
Geheimarchiv mit 45.000 Karteikarten
45.000 Karteikarten umfasst dieses Archiv, das vor allem Gerd Seewald, 2014 verstorbener Angehöriger der Führungsriege der Colonia Dignidad, ab 1974 bis 1990 akribisch führte. Viele mit Tarnkürzeln bezeichnete Informantinnen lieferten teils sehr intime Details über Zivilist*innen und Militärs. Die chilenische Polizei fand und beschlagnahmte das Archiv im Jahr 2005 in der ehemaligen Colonia Dignidad.
Seit 2014 haben Dieter Maier, der mehrere Bücher über die deutsche Sektensiedlung veröffentlicht hat, und der chilenische Journalist Luis Narváez die inzwischen digitalisierten Karteikarten in eine Datenbank eingepflegt. Sie haben die einzelnen Karteikarten verschlagwortet, mit den darauf erwähnten Quellen, Personen, Parteien und anderen Metadaten angereichert und online zur Verfügung gestellt.
„Repressionsallianz“
In Kartei des Terrors verweisen Maier und Narváez immer wieder auf diese Datenbank. Gemeinsam mit dem Buch stellt sie ein besonderes Nachschlagewerk zur Recherche konkreter Fälle zur Verfügung. „Ein Ziel der Recherche für dieses Buch war, zu rekonstruieren, wie und wo die Gefangenen verschwanden. Eine direkte Antwort gibt das Karteikartenarchiv nicht“, schreiben die Autoren. Aber sie präsentieren exemplarisch Karteikarten, die Aufschluss über Verhöre einzelner Gefangener, über Interna der Diktatur und der Struktur ihrer Repressionsorgane geben. Eine zentrale Rolle kommt dabei der Zusammenarbeit zwischen der Colonia Dignidad, der Geheimpolizei DINA, dem Geheimdienst des Heeres SIM sowie Polizisten der Carabineros und Militärs aus Linares und Concepción zu. Die Autoren bezeichnen diese Kooperation, die für Entführungen, Folter, Mord und Verschwindenlassen von Oppositionellen im südlichen Chile verantwortlich war, als „Repressionsallianz“.
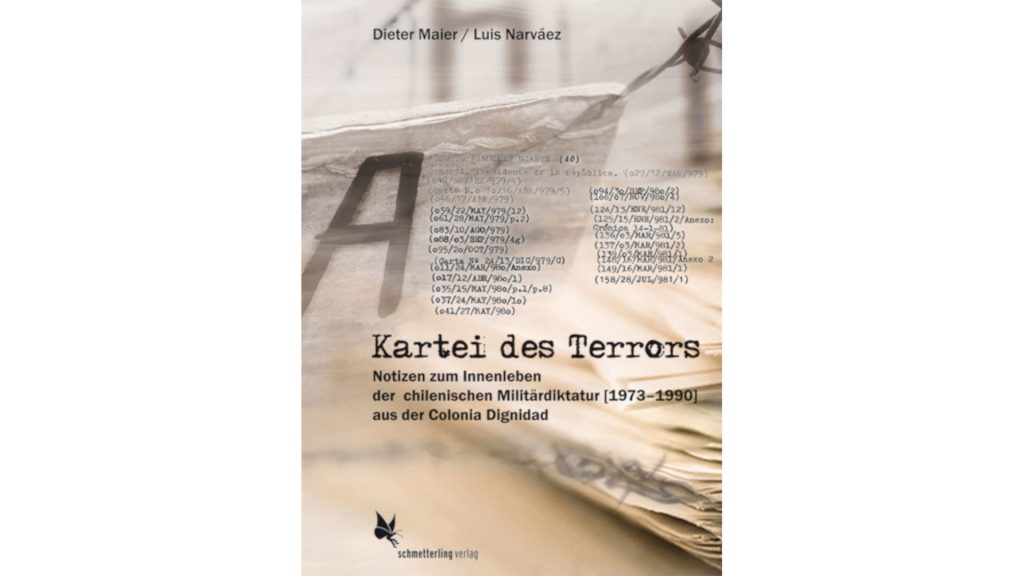
Mitunter ist die Fülle von Personen und politischen Gruppierungen sowie Abkürzungen und nicht immer klar zuzuordnenden Tarnkürzeln schwer nachzuvollziehen. Erklärungen zu Kürzeln und Decknamen finden sich über das Buch verstreut. Ein zusammenhängendes Verzeichnis sowie eine klarere Struktur der verschiedenen Kapitel wären beim Lesen sicherlich hilfreich. Aber es gelingt den Autoren sehr gut, die Geschichten einzelner Personen zu rekonstruieren. Ein Beispiel ist der 1933 in Mazedonien geborene und 2020 in Chile verstorbene Mile Mavrovski. Fernab der realen Situation wurde er aufgrund anti-slawischer Ressentiments als besonders gefährlicher „Russe“ mit Umsturzplänen stilisiert und 1974 elf Monate lang in der Colonia Dignidad festgehalten und gefoltert. In dieser Zeit galt er als „verschwunden“. Konkrete Geschichten wie diese zeichnen ein eindrückliches Bild verschiedener Dimensionen der Allianz zwischen der chilenischen Diktatur und der Colonia Dignidad.
So tragen beide Bücher aus ihren sehr unterschiedlichen Blickwinkeln wichtige Erkenntnisse zur Aufarbeitung der Verbrechen der Colonia Dignidad bei und sind als Appell an Regierungen und Justiz in Deutschland und Chile zu lesen, endlich konsequent und engagiert zu handeln. Jüngst hat die chilenische Regierung unter Gabriel Boric einen Aktionsplan zur Suche nach den Verschwundenen angekündigt, deren Angehörige seit fast 50 Jahren nach ihren Verwandten suchen. Auch Juan Rojas Vásquez, dessen Vater und älterer Bruder bis heute verschwunden sind, nachdem sie 1973 mutmaßlich in die Colonia Dignidad verschleppt wurden, fordert: „Wir haben ein Recht darauf zu wissen, wo und wann mein Vater und mein Bruder erschossen wurden und wo ihre Leichen sind.“ Es ist höchste Zeit.