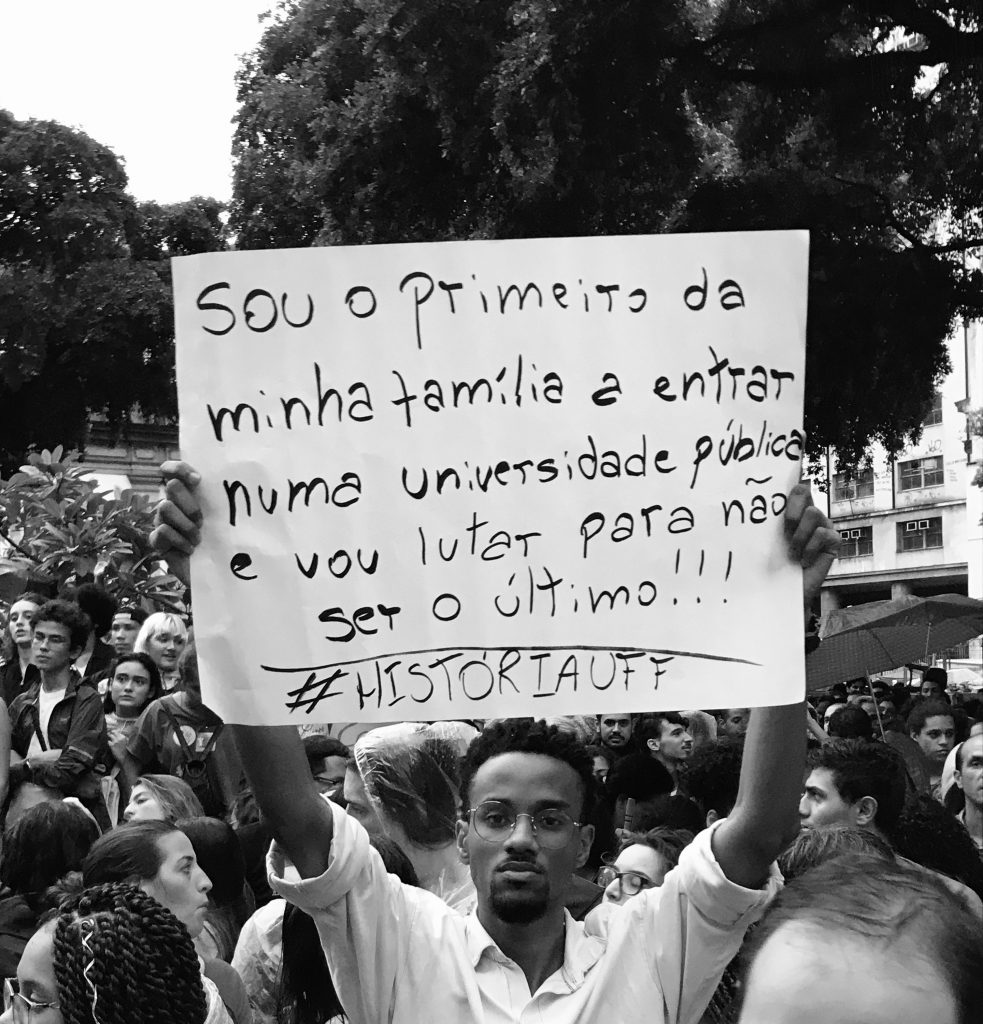Anfang 2021 erschien Begegnung verändert Gesellschaft, eine Sammlung von Aufsätzen zu Bildungsprozessen in Lateinamerika, die von der Pädagogik Paulo Freires (siehe Infokasten) inspiriert wurden. Der Band vereint 46 Beiträge zu Erfahrungen in ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen aus neun verschiedenen Ländern. Die Texte beziehen sich zum großen Teil auf pädagogische Prozesse in Kolumbien, Chile, Honduras, Guatemala, Peru und El Salvador, schließen aber auch Erfahrungen in Deutschland, Mosambik und der DR Kongo ein.
Die Grundlage der Zusammenarbeit der Autor*innen war ein mehr als zwanzigjähriger Austauschprozess zwischen Pädagog*innen aus Deutschland und Lateinamerika. Aus der Initiative des Berliner Paulo Freire Instituts bildeten sich in verschiedenen Ländern eigene Vereine und Netzwerke. Daher ist der Sammelband 2019 zunächst in Kolumbien unter dem Titel Desaprender para transformar („Ver-Lernen, um zu verändern“) auf Spanisch erschienen und wurde nun ins Deutsche übersetzt. Auch die Autor*innen standen miteinander in ständigem Austausch: Sie bildeten während der Textentstehung Tandems und legten in einem Workshop gemeinsam die grundlegende Ausrichtung der Publikation fest.
Entstanden ist so ein nicht nur für Bildungspraktiker*innen lesenswerter Einblick in die Aktualität der „befreienden Pädagogik“ Paulo Freires, die das Wissen und die Erfahrungen aller Beteiligten in den Mittelpunkt stellt. Die Lebensrealität der Lernenden ist die Grundlage für die Alphabetisierung und für jeden anderen Lernprozess. Dadurch entwickeln Lernende und Lehrende eine kritische Perspektive auf gesellschaftliche Machtverhältnisse – Bildung trägt so zu einer sozialen Veränderung für mehr Gerechtigkeit und Selbstbestimmung bei.
Wie nebenbei enthält der Band zahlreiche Informationen zu den sozialen Realitäten Lateinamerikas und immer wieder ermutigende Berichte, wie viel Hoffnung Bildungsprozesse in gewaltfreien Räumen auch in einem gewalttätigen Umfeld geben können. Die persönlichen Erfahrungen mit der Pädagogik Freires sind dabei der Ausgangspunkt aller Texte – eine Methode, die zum pädagogischen Konzept passt, in der Textproduktion aber ihre Grenzen hat. So fehlt zu verschiedenen Themen eine Einordnung in übergreifende Kontexte und Debatten.
In insgesamt sieben Kapiteln werden verschiedene Fragen zur gesellschaftlichen Relevanz und Methodik von Freires Pädagogik aufgeworfen. Im ersten Kapitel „Bildung und Transformation“ schlägt der kolumbianische Soziologe César Osorio Sánchez einleitend den Bogen von der Pädagogik Freires zu den Konzepten der educación popular („Bildung an der Basis“) und der Partizipativen Aktionsforschung, deren Grundlage ebenfalls der gemeinsame Wissensaufbau zur Veränderung gesellschaftlicher Macht- und Gewaltstrukturen ist. Sehr lesenswert ist auch der Beitrag der kolumbianischen Sozialanthropologin, Gemeindeaktivistin und Menschenrechtsverteidigerin María Miyela Riascos Riascos, die kollektive Lernprozesse in ländlichen und städtischen Regionen von Buenaventura beschreibt. So wurden große Erfolge in der sozialen Organisierung der afrokolumbianischen Gemeinden und deren politischer Teilhabe erzielt, obwohl sie durch die bewaffneten Konflikte immer wieder unterbrochen wurden.
Das zweite Kapitel „Kritische Bildungspraxis im Kontext verschiedener Kulturen“ widmet sich den besonderen Herausforderungen, die für Lernsituationen entstehen, wenn unterschiedliche kulturelle Kontexte aufeinandertreffen. So berichtet Basilia Victorina Macario Ixcó aus der K‘iche‘-sprachigen Maya-Gemeinschaft in Guatemala von Methoden der zweisprachigen Pädagogik. Diese bieten die Möglichkeit mit der „Kultur der Scham“ zu brechen, die aus den „vertikalen“ (klassischen) Unterrichtsmethoden entsteht und indigene „Frauen und Mädchen quasi unsichtbar“ macht.
Darum, die Kultur des Schweigens und die eigene Scham zu überwinden, geht es auch im dritten Kapitel „Bildung und Erinnerungsarbeit“. Die gemeinsamen Erfahrungen mit Diktatur, Gewalt und Menschenrechtsverletzungen waren seit dem ersten Kurs mit 20 Lehrkräften aus Chile, den das Paulo Freire Institut 1996 in Berlin durchführte, ein zentrales Thema. Daniel Gaede, der zehn Jahre für die pädagogische Arbeit der Gedenkstätte Buchenwald zuständig war, berichtet von einem Workshop und den Voraussetzungen für einen „respektvollen Dialog und wechselseitige Anerkennung“ über Gewalterfahrungen und den Umgang damit.
Das vierte Kapitel „Gender: Neue Bilder und neue Praxen“ zeigt, wie wegbereitend Freires Methodik für die aktuellen Diskussionen über Queerfeminismus und Diversität ist. Hier wird vor allem über Erfahrungen mit dem Theater der Unterdrückten nach Augusto Boal berichtet. Währenddessen beziehen sich die Autor*innen im fünften Kapitel auf das Konzept des Buen Vivir, des „guten Lebens“ im Einklang mit der Natur und Respekt vor ihren Gesetzen. Sie stellen die Praxis in indigenen Gemeinden (u.a. im kolumbianischen Cauca) und die Weiterentwicklung der Pädagogik Freies zu einer Pedagogía de la Tierra („Pädagogik des Landes“) dar.
Dass gerade die Entwicklung einer „kritischen Mathematik“ ein Schwerpunkt im sechsten Kapitel „Neue Wege des Lernens und Lehrens“ ist, überrascht zunächst. Verbindendes Thema sind alternative Ansätze in der Schul- und Hochschulbildung. Abgeschlossen wird der Band mit dem Kapitel „Freire und ich“, einer Reihe sehr persönlicher Betrachtungen zu den eigenen Erfahrungen mit der Freire-Pädagogik in Text- und Versform. So schließt sich der Bogen zur Einleitung von Ilse Schimpf-Herken, Mitherausgeberin und langjährige Direktorin des Paulo Freire Instituts in Berlin, deren Begegnung mit Freire 1971 in Mexiko ihr weiteres Leben und Arbeiten prägte.