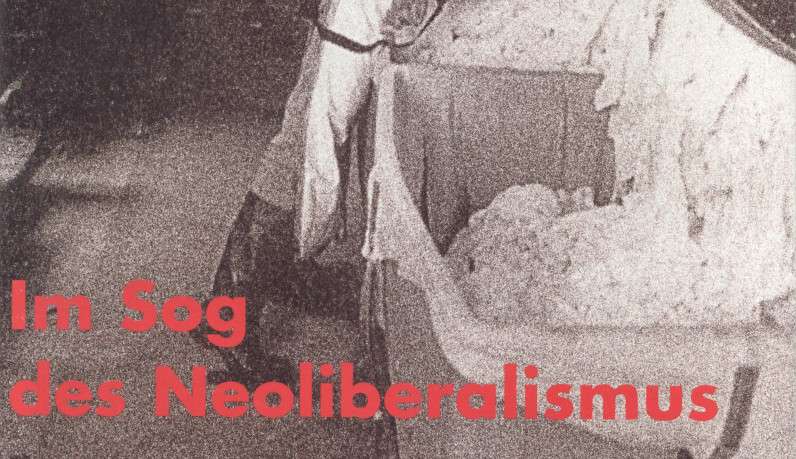Dieses Jahr haben die Arbeiter*innen der SUBTE, eines der ältesten U-Bahn-Netze der Welt, schon 22 Mal die Arbeit niedergelegt. Seit Jahren sind sie an asbestkontaminierten Arbeitsplätzen tätig. Infolgedessen sind beinahe neunzig SUBTE-Angestellte erkrankt und bisher drei verstorben. Die Gewerkschaft der U-Bahner*innen, die Asociación Gremial de Trabajadores del Metro y el Premetro (AGTSyP), hat eine Dekontaminierungsarbeit angestoßen, die noch 15 Jahre in Anspruch nehmen wird.
In den Jahren 2011 und 2012 gelangten, während der Amtszeit von Mauricio Macri als Bürgermeister von Buenos Aires, mit Asbest belastete, ausgemusterte U-Bahn-Waggons der Metro Madrid aus Spanien in die argentinische Hauptstadt. In Spanien ist Asbest zwar seit 2001 verboten, doch unter dem Namen Uralita noch allgegenwärtig. Dass die nach Südamerika exportierten U-Bahn-Waggons asbestverseucht waren, wundert also nicht. Angestellte des Unternehmens Metro hatten seit den 1990ern mit dem Material hantiert, ohne es zu wissen. Erste Funde des Materials in alten Flottenbeständen wurden geheim gehalten, bis im Jahr 2015 die ersten Arbeiter erkrankten. Manche verstarben und die Staatsanwaltschaft begann zu ermitteln. Als 2021 ein spanischer Metro-Arbeiter wegen seiner asbestbelasteten Lunge an Covid-19 starb, hatte man in Buenos Aires schon länger begriffen, was dies für die dortigen U-Bahn-Mechaniker*innen, -Fahrer*innen, Putzkräfte und Fahrkartenverkäufer*innen bedeutet. Ein subtiler Fall von Umweltkolonialismus. Nicht nur wegen des Madrider Exports wurde in kontaminierten Werkstätten − zum Beispiel im Taller Medalla Milagrosa (dt. Werkstatt der wunderbaren Medaille) der Linie E − und Tunneln gearbeitet. Manche Kolleg*innen waren darüber hinaus bereits an belasteten Waggons aus Japan tätig gewesen. Zudem haben Fahrer*innen in ihren Kabinen direkt über Asbestelementen gesessen.
Asbest ist ein Bau- und Dämmstoff, der seit Ende des 19. Jahrhunderts weltweit Verwendung fand, bevor er in Europa in den 1990er Jahren in Verruf geriet. Denn Asbest ist feuersicher, leicht, und wenn auch nicht „ewig haltbar“, so doch relativ langlebig. Asbestfasern aber sind in jeder Form extrem krebserregend. Es gibt keine Expositionsmenge, die nicht kritisch wäre; die Fasern sind lungengängig, was bedeutet, dass sie bis in die Lungenbläschen eindringen und vom Körper nicht ausgeschieden werden können. Jüngste Untersuchungen haben ergeben, dass sie im Körper migrieren und außer Lungenkrebs und dem unheilbaren, hoch aggressiven Mesotheliom des Rippenfells sowie weiteren schweren Lungenkrankheiten auch andere Formen von Krebs auslösen können, etwa an den Eierstöcken. All diese Krankheiten können erst Jahrzehnte, ja bis zu sechzig Jahre nach der Kontamination auftreten. Damit ist die Beweislage, wenn es um die Anerkennung von Opfern und um Entschädigungen wegen Berufskrankheit geht, sehr schwierig.
Das extrem krebserregnde Asbest hat schon meherere U-Bahner getötet
Im Kampf für eine asbestfreie Arbeitsumgebung und für die Anerkennung der asbestbedingten Beschwerden als Berufskrankheit haben die Arbeiter*innen gemeinsam mit der Gewerkschaft der U-Bahner*innen AGTSyP mobil gemacht. Dabei haben sie sich nicht nur Kenntnisse in Toxikologie und Medizin angeeignet, sondern sind auch entschlossen an die Öffentlichkeit gegangen. Mittlerweile findet ihr Kampf breite Beachtung in den Medien, mehrere erkrankte Arbeiter sind immer wieder interviewt worden. Sie haben ihr halbes Leben lang für SUBTE gearbeitet. Der Zusammenhang von Arbeitsbedingungen und Erkrankungen wird – wie so oft in vergleichbaren Fällen weltweit – von Vorgesetzten und in der Verwaltung abgestritten. So erzählt eine Sprecherin der AGTSyP von einem Kollegen, der nach Vorlage des Befundberichts beim Betriebsarzt von seinem direkten Vorgesetzten die Ansage bekam, seine Lungenärztin habe wohl nicht richtig studiert – im U-Bahn-Netz sei bessere Luft als im Park. Aus der Verkehrsbehörde Buenos Aires hieß es, die Anti-Asbest-Kampagne sei vorgeschoben, es werde eigentlich um Arbeitszeitverkürzungen gefeilscht. Genau diese aber legen Ärzt*innnen nahe, um die Asbest-Exposition zu reduzieren. Die Tatsache, dass viele Arbeiter*innen an einer Krankheit leiden, die betriebsverschuldet ist, macht darüber hinaus auch den Kampf um Frühverrentung nachvollziehbar. Schließlich ist die Belastung, nach einer tödlichen Diagnose weiter arbeiten zu müssen, physisch und psychisch kaum auszuhalten.

Erste Untersuchungen von SUBTE-Arbeiter*innen führten dazu, dass manche als Risikogruppe aufgenommen und medizinisch weiter beobachtet wurden, andere aber nicht. Einer der ersten Arbeiter mit Krebsdiagnose machte bekannt, dass sämtliche U-Bahn-Linien von Buenos Aires asbestkontaminiert sind. Also die ganze „Lunge“ des Verkehrssystems der Stadt. Der Arbeiter hat mit einer halben Lunge überlebt, Kollegen aus seiner Werkstatt Rancagua hingegen sind an ihrer Erkrankung gestorben. Familienangehörige streiten darum, dass die sehr aufwendigen Unter-*suchungen verrenteter Erkrankter gewährleistet werden. Sie mussten oft sogar selbst nachforschen, woher die Erkrankungen stammten. Denn argentinische Arbeiter*innen sind weder aufgeklärt noch zu Schutzmaßnahmen aufgefordert worden. Die U-Bahn-Arbeiter*innen kämpfen nun um würdige Arbeitszeiten und -bedingungen, verlangen aber vor allem „asbesto cero“, das heißt, keine Grenzwert-Beteuerungen von Betrieb und Behörden, sondern „Null Asbest“. Es sind noch 200 Tonnen Material vorhanden, 90 Tonnen bislang entfernt worden.
Die Kontamination betrifft auch die Fahrgäste
Wie viele andere Betroffene auf der Welt sprechen die U-Bahn-Arbeiter*innen aus Buenos Aires von der tickenden Zeitbombe in ihrem Körper. Sie machen mit ihren Streiks und Demonstrationen aber auch auf die Gefährdung der Fahrgäste aufmerksam sowie darauf, dass die Asbestfasern aus dem U-Bahn-System in die Stadtluft treten. In dieser sind sie sowieso in gewisser Menge vorhanden, aber in den U-Bahn-Betrieben gibt es keinen Ort, der nicht belastet wäre: Sogar in den Rolltreppen steckt das Material. Nun wird in Argentinien, zwanzig Jahre nach dem Asbestverbot, auch noch nach oben, ins Tageslicht geschaut: Dächer, Wassertanks, viele emblematische Gebäude der architektonischen Moderne Lateinamerikas dürfen theoretisch, genauso wie betroffene Bauwerke in Europa, nicht angerührt werden, sondern gehören verkapselt. Und da fällt auf, dass in den Arbeitsräumen der AGTSyP ein Plakat mit der legendären Comicfigur El Eternauta hängt (1957-1959). Mit einem Schutzanzug bekleidet läuft dieser durch ein von Außerirdischen eingenommenes Buenos Aires; durch die Luft schwirren toxische Flocken. Damit wieder zurück in den Untergrund: Erstaunlicherweise zeigt die SUBTE-Station Uruguay der Linie B ein Wandkeramikgemälde mit einer Szene aus der späteren Eternauta-Version von Alberto Breccia, weswegen Acoplando, die Zeitschrift der U-Bahn-Arbeiter*innen, einen Beitrag unter dem Titel Subternauta postete, in dem es um einen unsichtbaren Gegner geht, der die Luft kolonisiert.