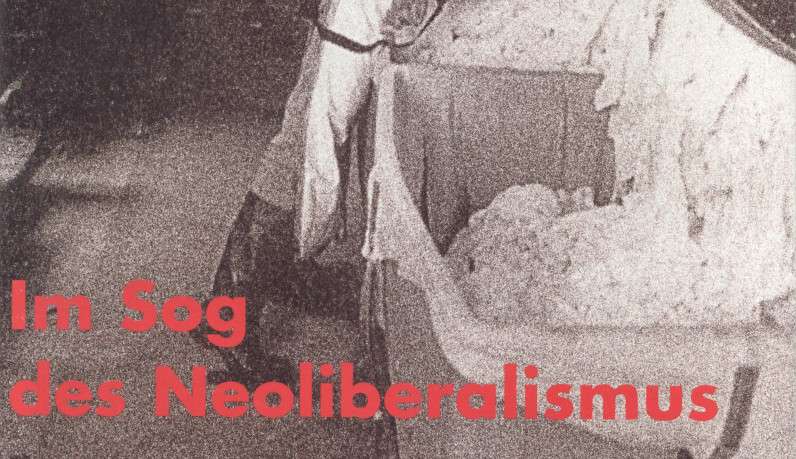
Ausschnitt aus einem LN-Cover von 2001 Titelthema: Gewerkschaften in Lateinamerika
Auch wenn der US-amerikanische Traum, eine gesamtamerikanische Freihandelszone (FTTA) durchzusetzen, in dieser Form nicht wahr geworden ist: Der neoliberale Freihandel ist 22 Jahre nach dem Vorschlag des damaligen US-Präsidenten George W. Bush dominierender denn je. Mittlerweile wird eine US-Hegemonie im Freihandel mit lateinamerikanischen Staaten (wie im Editorial 323 befürchtet) durch die EU, die noch in diesem Jahr die Ratifizierung eines Abkommen mit den Mercosur-Staaten anstrebt, streitig gemacht. Was die Zementierung eines neokolonialen und neoliberalen Handelsmodells angeht, stehen sich die USA und die EU allerdings in nichts nach.
Die Befürchtungen, die im Mai 2001 geäußert wurden, haben sich also trotzdem bewahrheitet:
Freihandelsabkommen stärken die Macht der Konzerne auf Kosten von Umwelt und Menschenrechten. Auch bei gravierenden Menschenrechtsverletzungen sind die entsprechenden Klauseln bereits abgeschlossener Abkommen der EU mit lateinamerikanischen Staaten bislang nicht aktiviert worden. Das ist derzeit im Fall von Peru zu beobachten, wo trotz tödlicher Repression von Protesten keinerlei Konsequenzen gezogen wurden.
Im Neoliberalismus genießen Konzerne Narrenfreiheit. Mehrere europäische Staaten haben bereits bilaterale Investitionsabkommen mit lateinamerikanischen Staaten wie Mexiko abgeschlossen, die Investoren ein Sonderklagerecht einräumen. So können diese den mexikanischen Staat vor internationalen Schiedsgerichten verklagen – beispielsweise für entgangene Gewinne infolge der Umsetzung von Umweltgesetzen. Opfer von Menschenrechtsverletzungen oder Umweltverbrechen haben indes keinen Zugang zu einem solchen Sonderklagerecht.
Heute lässt sich also festhalten, dass, entgegen der Bekräftigungen mehrerer lateinamerikanischer Staatschef*innen, Konzerne die alleinigen Gewinner dieser Form des Handels sind. Das zeigt sich besonders dramatisch in der Agrarindustrie: Agrobusiness und Chemiekonzerne machen horrende Profite, während die Existenzen von Kleinbäuer*innen und die Ernährungssouveränität lokaler Gemeinschaften massiv bedroht werden, Landkonflikte und -konzentration immer weiter zunehmen und sowohl die Biodiversitäts- als auch die Klimakrise angeheizt werden. Bereits im Zuge des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens NAFTA konnten derlei Folgen beobachtet werden. Aktuell gelten entsprechende Überlegungen als eine der primären Sorgen bezüglich des geplanten EU-Mercosur-Abkommens.
Trotzdem behaupten Staatschef*innen weiterhin, Freihandelsabkommen böten eine Gelegenheit zur Kooperation unter demokratischen Staaten und brächten mehr Wohlstand und Entwicklung für alle. Im Zeitalter des Greenwashings wird zudem beteuert, diese Abkommen respektierten die Nachhaltigkeitsziele und würden sogar aktiv zu deren Umsetzung beitragen. Angesichts der Realität, die vielerorts anders aussieht, lässt jedoch auch die Kritik aus der Zivilgesellschaft nicht nach.
Um mit der neokolonialen Ordnung, in der gerade ländliche, indigene und andere Gemeinschaften vor Ort keine Rechte haben, zu brechen, muss das internationale Handels- und Wirtschaftsmodell komplett umstrukturiert werden. Dafür müssen die vom Ausbeutungssystem im Rahmen des Freihandels direkt betroffenen Menschen in die Entscheidungen einbezogen werden.
Johanna Saggau ist LN-Redaktionsmitglied
Antonella Navarro ist LN-Redaktionsmitglied





