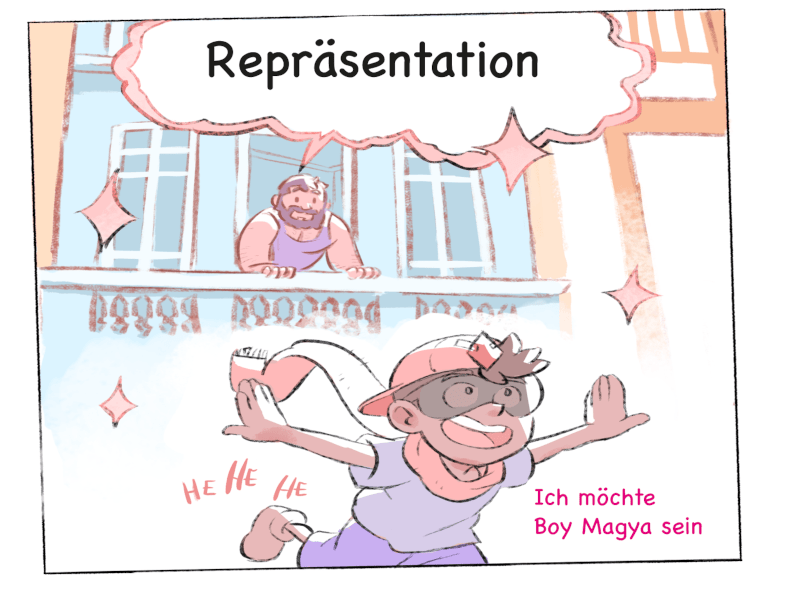„Sie wurden verbrannt, weil sie Lesben waren. Sie wurden verbrannt, weil sie arme Lesben waren. Sie wurden verbrannt, weil sie arme Lesben waren, die eine Gemeinschaft bildeten.“ So hieß es auf einer Demonstration der landesweiten lesbischen Vernetzung in Argentinien Mitte Mai. Am 5. Mai war im Stadtteil Barracas im Süden von Buenos Aires ein brutaler Brandanschlag gegen vier lesbische Frauen begangen worden. Drei Frauen starben. Menschenrechtsorganisationen und die LGBTIQ+-Bevölkerung in Argentinien haben keinen Zweifel daran, dass es sich um einen Lesbizid handelt. Die Regierung von Javier Milei stritt jedoch jeden Zusammenhang ab: „Mir gefällt es nicht, den Vorfall als Anschlag gegen ein bestimmtes Kollektiv zu definieren”, sagte Regierungssprecher Manuel Adorni während einer Pressekonferenz in der Woche nach dem Attentat.
Offen queerfeindlich positionierte sich auf X (ehemals Twitter) dagegen Nicolás Márquez, der rechtsextreme Autor einer Biografie Mileis: „Dann werd halt keine Lesbe, dann töten sie dich auch nicht. Ein guter Moment, Heterosexualität einzufordern.“ Er hatte schon vorher bei einem Radiointerview behauptet, der Staat würde Homosexualität fördern, um selbstzerstörerisches Verhalten zu belohnen. Genau solche Hassreden und Taten wie den Lesbizid in Barracas kann man nicht voneinander trennen.
Es zählt fraglos zur Aufgabe staatlicher Institutionen, queere Menschen zu schützen. Leider ist das auch in Deutschland keine Selbstverständlichkeit – die Rechte queerer Personen müssen immer wieder verteidigt werden. Ab November wird endlich das neue Selbstbestimmungsgesetz das diskriminierende Transsexuellengesetz von 1980 ersetzen. Viele Gruppen kritisieren jedoch, dass es sich dabei nur um einen Minimalkompromiss handelt und bei der Diskussion transfeindlichen Stimmen zu viel Raum gegeben wurde.
In Argentinien existierte ein ähnliches Gesetz bereits seit 2012. Jetzt werden die Fortschritte im Bereich Geschlechtergleichstellung und Antidiskriminierung von LGBTIQ+-Personen jedoch bedroht: Die gendergerechte Sprache wurde in der öffentlichen Verwaltung verboten, die Arbeit des Ministeriums für Frauen, Gender und sexuelle Vielfalt wurde eingestellt und weitere für die LGBTIQ+-Bevölkerung entwickelte Initiativen wurden abgeschafft. Der queerfeindliche Präsident Milei soll am 24. Juni in Hamburg den Preis der rechtslibertären Hayek-Gesellschaft erhalten. Bundeskanzler Olaf Scholz wird sich mit ihm treffen und ihn damit weiterhin als legitimen Arbeitspartner anerkennen, obwohl er nach dem Handbuch eines autoritären Führers handelt: Zuerst betreibt er die Rücknahme von Rechten einzelner Gruppen, um danach Rechte und Freiheiten möglichst noch weiter einzuschränken – und ihm selbst im Gegenzug weitestgehende Macht zu verschaffen.
Soweit ist es in Deutschland noch nicht, aber die Fassade der Progressivität bröckelt auch hier: Die EU-Agentur für Grundrechte stellte im Mai fest, dass queerfeindliche Gewalt in Deutschland in den vergangenen Jahren gestiegen ist. Gleichzeitig gewinnt eine rechte Partei wie die AfD, die ein konservatives, eingeschränktes Familienmodell fördert und eine eindeutige Bedrohung für das Leben von LGBTIQ+-Menschen im Land darstellt, einen immer größeren Einfluss auf den politischen Diskurs und legt bei Wahlen zu. So könnten Errungenschaften wie eine größere Selbstbestimmung von queeren Menschen, die Ehe für Alle oder die Abschaffung des Paragraphen 219 wieder in Gefahr geraten. Mit der Anerkennung von Rechten ist der Weg definitiv noch nicht zu Ende. Um ein gutes Leben für uns alle in der Vielfalt, in der wir existieren, zu ermöglichen, bedarf es dauerhafter Anstrengungen von so vielen wie möglich.