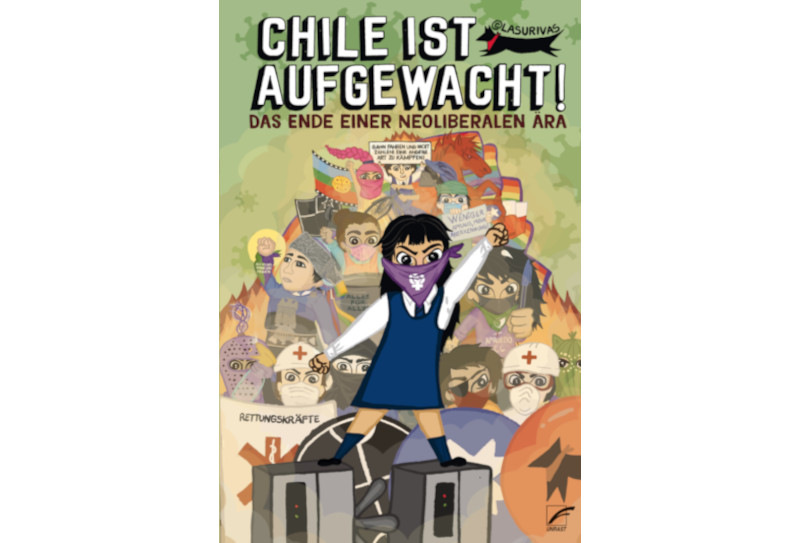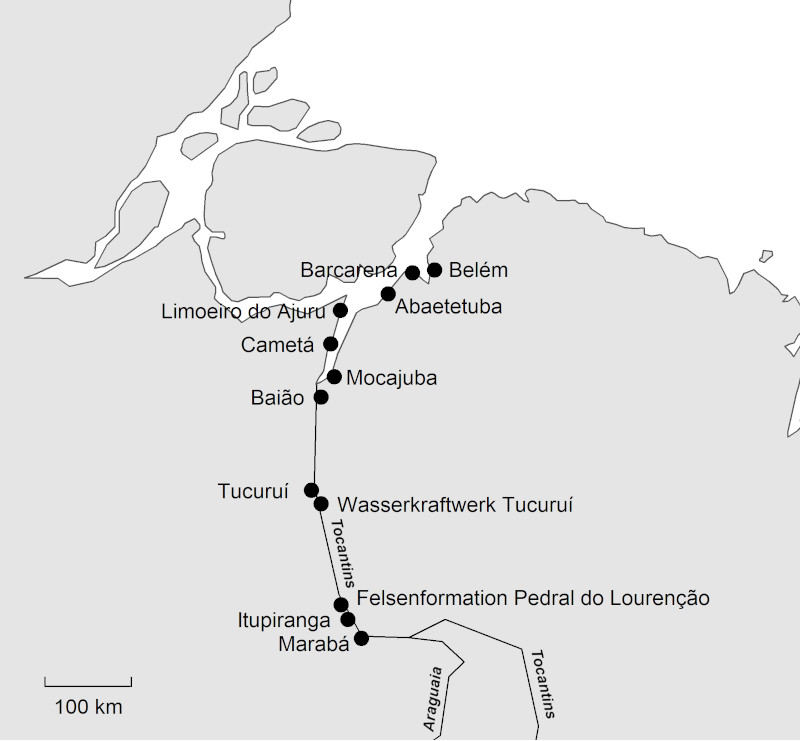Die nun verabschiedete Fassung weicht somit stark von dem ursprünglichen, von der Regierung im vergangenen Dezember eingereichten Entwurf ab. Dazu kommt das Steuerpaket, eine Regelung, mit der ein neuer Verwaltungszyklus eingeleitet werden soll. Mit der Verabschiedung der beiden Gesetze erhält Milei für ein Jahr Gesetzgebungsbefugnisse. Arbeiter*innen müssen wieder Einkommenssteuern zahlen, während die Steuersätze für Reiche gesenkt werden. Firmen in öffentlicher Hand sollen privatisiert und multinationalen Konzernen mehr Gewinn versprochen werden. Zu den 238 von ursprünglich 600 Artikeln gehört auch eine rückschrittliche Arbeitsreform. Gewerkschaften hatten versucht, diese auf juristischem Wege zu verhindern.
„Der Geist dieses Gesetzes hängt direkt mit einem Paradigmenwechsel zusammen. Dieser betrifft nicht nur ökonomische oder finanzpolitische Fragen, sondern umfasst neben politischen und sozialen besonders demokratische Dimensionen“, so die Soziologin Valentina Castro gegenüber LN. Für sie ist klar, dass die gesetzlichen Regelungen „eine Übertragung von Zuständigkeiten aus staatlicher Hand hin zum privaten Sektor“ bedeuten. „Dem Staat wird so die Möglichkeit genommen, auf Wirtschaft und Politik Einfluss zu nehmen. Dieses Machtmonopol wird stattdessen den wirtschaftlich Machthabenden übertragen“, so Castro weiter.
Damit das Gesetz verabschiedet werden konnte, musste die Regierung einige Artikel des in erster Lesung im Abgeordnetenhaus angenommenen Textes verändern. So ist nicht mehr geplant, die staatliche Fluggesellschaft Aerolíneas Argentinas, die Postgesellschaft Correo Argentino und die öffentlich-rechtlichen Medien zu privatisieren. Auch die geplante Rentenreform wurde gestrichen. Sie hätte ein Moratorium beendet, welches jenen zugutekommt, die im Rentenalter keine 30 Beitragsjahre vorweisen können. Ein Teil der Opposition wehrte sich gegen dieses Vorhaben, denn fast die Hälfte der Werktätigen in Argentinien ist informell beschäftigt.
Keine Anpassung ohne Repression
Dennoch sind genug rückschrittliche Inhalte des Gesetzes erhalten geblieben. Im Hinblick auf den Arbeitsmarkt ermöglicht die neue Verordnung Arbeitgeber*innen, bis zu drei Angestellte als Selbstständige zu beschäftigen. Diese fallen damit nicht mehr unter das Arbeitsvertragsgesetz und genießen weniger Arbeitsrechte als Festangestellte. Hinzu kommt, dass die Teilnahme an Blockaden oder Besetzungen Kündigungsgrund werden und das Streikrecht für Angestellte im öffentlichen Dienst stark eingeschränkt wird – Streiktage gehen künftig von der Arbeitszeit ab.
Besonders weitreichende Folgen dürften die Ausrufung eines einjährigen öffentlichen Ausnahmezustandes in Verwaltungs-, Wirtschafts-, Finanz- und Energiefragen sowie die Übertragung besonderer Befugnisse an Milei haben: Der Präsident hat nun in diesen Bereichen direkten Einfluss. Insgesamt acht staatliche Unternehmen sollen privatisiert werden, der Öl- und Gassektor wird dereguliert und soll nun nicht mehr vornehmlich auf die Versorgung, sondern auf den Export ausgelegt sein. Auch darf die Regierung nun Bauvorhaben in öffentlicher Hand neu verhandeln oder kündigen.
Einer der umstrittensten Punkte des Ley Bases sieht die Einführung eines Systems vor, das ausländische Investitionen in Höhe von mindestens 200 Millionen US-Dollar anlocken soll. Diese Reform wurde von der Opposition vehement bekämpft, weil sie die argentinische Industrie gefährdet. Gleichzeitig werden dem internationalen Finanzsektor nur geringe Beschränkungen auferlegt. Auf den Druck der Opposition hin wird sich das System auf die Bereiche Tourismus, Infrastruktur, Minen, Technik, Stahl, Energie, Öl und Gas beschränken.
„Diese Verordnung wird als das Herz des Ley Bases betrachtet, vor allem aufgrund der Gewinnübertragung an das internationale Finanzkapital. Es untergräbt die lokale Entwicklung und schadet kleinen und mittleren Firmen sowie solchen in öffentlicher Hand. Große Besorgnis erzeugen dabei die strukturellen Veränderungen und ihre möglichen Folgen in der argentinischen Produktionsleistung“, erklärt Castro. Denn die Reform gelte für 30 Jahre, es handelt sich somit nicht um konjunkturabhängige Maßnahmen. Auf Drängen der Opposition steht im verabschiedeten Text, dass die Investor*innen für mindestens 20 Prozent der Gesamtsumme lokale Lieferant*innen unter Vertrag nehmen sollen.
„Ein maßgeschneidertes Gesetz für die Mächtigen in Argentinien“
„Wir geben der Regierung von Präsident Milei die Mittel, um den Staat endlich und endgültig zu reformieren“, sagte der Chef der Regierungsfraktion La Libertad Avanza im Abgeordnetenhaus, Gabriel Bornoroni, in seiner Abschlussrede, wenige Minuten bevor das Gesetz verabschiedet wurde. „Dies ist ein maßgeschneidertes Gesetz für die Mächtigen in Argentinien“, erwiderte der Abgeordnete und Gewerkschaftsführer Hugo Yasky, Vorsitzender der größten Oppositionsfraktion, der peronistischen Unión por la Patria. Die Pressestelle des Präsidenten feierte „das erste Gesetz, das in Richtung des freien und wohlhabenden Landes geht, welches die Argentinier gewählt haben.“
Während im Abgeordnetenhaus noch verhandelt wurde, wurde draußen demonstriert. Bei Protesten am 13. Juni nahmen staatliche Sicherheitskräfte 33 Personen fest, bei Redaktionsschluss waren davon vier Personen weiterhin inhaftiert. Ihnen wurden Straftaten vorgeworfen, die mit bis zu 15 Jahren Haft geahndet werden können, darunter Landfriedensbruch, Aufruf zu Straftaten, gemeinschaftlich begangene Gewalttaten und Rebellion. Am gleichen Tag sprach die Regierung von Terrorismus und einem versuchten Staatsstreich – und schuf damit ein gefährliches und in der jüngeren politischen Geschichte beispielloses Narrativ.
Vier Protestierende noch immer in Haft
„Es war im wahrsten Sinne des Wortes ein Albtraum. Als sie mich zum ersten Mal schlugen, um mich festzunehmen, spürte ich die Verwirrung und das Adrenalin. Das ging einige Tage so weiter, im Gefängnis und später, als sie uns die Vorwürfe eröffnet haben“, erzählt der Musiker Santiago Adano, einer der Festgenommen, gegenüber LN. Es sei ein Gefühl, das sich erst dann zu verflüchtigen begonnen habe, als der Mangel an Beweisen deutlich wurde und die Gefahr, ins Gefängnis zurückzukehren, in die Ferne rückte.
Die Vorwürfe gegen die Freigelassenen wurden inzwischen fallengelassen. Die vier Personen, die weiterhin in Haft sind, wurden hingegen angeklagt – allerdings nicht mit den eigentlichen Vorwürfen, sondern wegen konkreterer Delikte wie etwa Steinwürfen oder Angriffen und Widerstand gegen die Staatsgewalt. „Viele Rechtsexpert*innen sind sich einig, dass für diese Vorwürfe keine Untersuchungshaft verhängt werden soll. Denn es besteht weder Verdunklungs- noch Fluchtgefahr. Sie sollten also frei sein, während der Prozess geführt wird“, erklärt Adano.
Währenddessen sind Menschenrechtsorganisationen und Anti-Repressionsgruppen aktiv, um der Forderung nach Freilassung der Gefangenen Gehör zu verschaffen. „Die Kriminalisierung des Protests verletzt nicht nur Grundrechte, sondern verhindert auch die öffentliche Beteiligung und die Ausübung demokratischer Rechte. Anstatt auf Repression und Kriminalisierung zurückzugreifen, hat der Staat die Pflicht, die Ausübung dieser Rechte zu erleichtern. Außerdem muss er garantieren, dass die Personen ihre Forderungen und Anliegen auf freie und sichere Art ausdrücken können“, mahnt auch die argentinische Vernetzung zur Verteidigung der Menschenrechte und Demokratie.