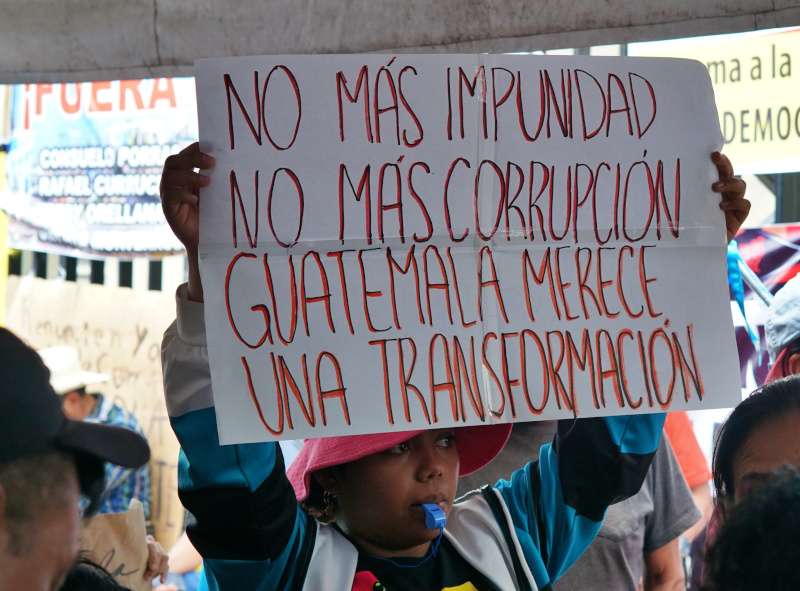Es sei ein „Ereignis von historischer Bedeutung“, erklärte der venezolanische Parlamentspräsident Jorge Rodríguez am 28. Februar. Kurz zuvor hatten Vertreter*innen zahlreicher politischer Parteien, Unternehmensverbände und weiterer gesellschaftlicher Gruppen nach mehrmaliger Verschiebung ein Dokument mit dem sperrigen Titel „Nationales Abkommen über die allgemeinen Grundsätze, den Zeitplan und die Ausweitung der Wahlgarantien für die Präsidentschaftswahl 2024“ unterzeichnet. Dieses geht auf einen mehrwöchigen Dialogprozess zurück, an dessen Ende eigentlich ein Wahltermin verkündet werden sollte. Anders als ursprünglich angedacht enthält das Dokument nun allerdings nicht den einen Vorschlag, sondern nennt 27 mögliche Termine zwischen April und Dezember.
Wir haben beschlossen, alle von den Akteuren des Dialogs vorgeschlagenen Daten zu berücksichtigen“, so Rodríguez. Sowohl den Termin, als auch das Reglement zu beschließen sei Aufgabe des Nationalen Wahlrates (CNE) – der wie alle anderen staatlichen Institutionen mit einer chavistischen Mehrheit besetzt ist. Möglicherweise um der Kritik den Wind aus den Segeln zu nehmen, wonach der regierende Chavismus zwar konsultiert, die Entscheidungen aber willkürlich alleine trifft, betont dieses Vorgehen also die laut Verfassung vorgesehene Unabhängigkeit der Gewalten.
Doch im Hintergrund läuft ein undurchsichtiger Prozess von Verhandlungen, Drohungen und offensichtlich auch unterschiedlichen Ansichten innerhalb der Regierung. Diese möchte die Wahl ohne großes Risiko gewinnen, strebt andererseits aber inner- und außerhalb Venezuelas eine breite Anerkennung der Ergebnisse an. Bisher bestehen erhebliche Zweifel, ob dies gelingen kann. Denn die prominentesten Oppositionspolitiker*innen dürfen nicht kandidieren. Der Regierung verschafft das möglicherweise den entscheidenden Vorteil, um die Wahl gegen eine gespaltene Opposition zu gewinnen, obwohl die Umfragewerte von Präsident Nicolás Maduro im unteren zweistelligen Bereich liegen.
Dabei sah es noch vor einem halben Jahr danach aus, als würden sich die Wogen nach den gescheiterten Umsturzversuchen der letzten Jahre glätten. Ein Abkommen, das die Regierung und das rechte Oppositionsbündnis Plataforma Unitaria Democrática im Oktober in Barbados unterzeichnet hatten, deutete auf transparente Wahlen 2024 hin. Es sieht vor, dass die Präsidentschaftswahl in der zweiten Hälfte dieses Jahres stattfinden und die politischen Parteien ihre Kandidaturen nach eigenen Regeln bestimmen sollen. Zudem soll es umfassende Wahlgarantien und eine glaubhafte Wahlbeobachtung geben.
Das Abkommen kam unter anderem deshalb zustande, weil die USA, die seit 2017 umfassende wirtschaftlichen Sanktionen gegen das Land verhängt hatten, seit Beginn des Ukraine-Krieges wieder ein Interesse an venezolanischem Erdöl haben. Unmittelbar nach der Unterzeichnung genehmigte die US-Regierung sowohl den Handel mit als auch Investitionen in Erdöl, Gas und Gold, solange sich die venezolanische Regierung an die vereinbarten Schritte hält. Im Gegenzug erhielt sie die Erlaubnis, Abschiebeflüge aus den USA nach Venezuela durchzuführen – ein aufgrund gestiegener Migrationszahlen für Präsident Joe Biden wichtiges Wahlkampfthema. Andere Themen, wie die juristischen Eingriffe in die Führung mehrerer rechter wie linker Parteien (darunter auch die Kommunistische Partei Venezuelas), thematisierte das Abkommen nicht. Dennoch handelt es sich um die weitreichendste Übereinkunft zwischen Regierung und Opposition seit dem Amtsantritt von Maduro 2013.
Trotzdem sehen viele das Abkommen als bereits überwiegend gescheitert an. Die Regierung selbst bezeichnet es mittlerweile als Vorstufe eines breiteren Dialogs, der im Februar angestoßen wurde.
Zwar gab es zunächst zaghafte Fortschritte bei der Umsetzung, so einen Gefangenentausch mit den USA. Das für die Opposition entscheidende Thema war und ist aber das Antrittsverbot für ihre Wunschkandidatin María Corina Machado. Sie zählt seit über 20 Jahren zum rechten Rand der Opposition, hat sich in den vergangenen Jahren offen für eine US-Militärintervention ausgesprochen und will Staatsunternehmen privatisieren. Am 22. Oktober gewann Machado eine Vorwahl der Opposition ohne ernstzunehmende Konkurrenz. Die Regierung tolerierte die Abstimmung zunächst, erkannte sie anschließend aber nicht an. Wegen angeblichen Betrugs ging die Justiz gegen die Organisator*innen der Vorwahl und das direkte Umfeld von Machado vor.
Im Abkommen von Barbados heißt es, dass alle Kandidat*innen, die „die rechtlichen Voraussetzungen erfüllen“, an den kommenden Wahlen teilnehmen dürften. Regierung und Opposition einigten sich daher Ende November auf ein Verfahren, um die Antrittsverbote jeweils auf Antrag vor dem Obersten Gericht (TSJ) prüfen zu lassen. Entgegen vorheriger Ankündigungen erschien Machado am 15. Dezember aber vor dem Obersten Gericht, das Ende Januar die Antrittsverbote für sie und den ebenfalls prominenten Oppositionspolitiker Henrique Capriles bestätigte. Die USA setzten als Reaktion darauf die Sanktionen im Goldsektor wieder ein und drohten damit, auch die im Erdölsektor zu erneuern, sollte es bis April keine Fortschritte zu transparenten Wahlen geben. Die venezolanische Regierung zog daraufhin die Erlaubnis für Abschiebeflüge zurück.
Ohne Wirkung blieb die Reaktion der US-Regierung nicht. Anfang Februar rief Parlamentspräsident Rodríguez alle Sektoren des Landes dazu auf, sich an einem breiten Dialog zu beteiligen, um einen konkreten Fahrplan für die Präsidentschaftswahl auszuarbeiten. Tatsächlich kam es in den folgenden Wochen zu zahlreichen Treffen mit moderaten Teilen der Opposition, die teilweise in dem alternativen Oppositionsbündnis Alianza Democrática organisiert sind und bereits zu früheren Zeitpunkten Parallelverhandlungen mit der Regierung geführt haben. Die größere Plataforma Unitaria Democrática, der die traditionelle rechte Opposition angehört, traf sich am 20. Februar mit der Regierung, unterzeichnete das Abkommen jedoch nicht. Die moderateren Akteur*innen betrachtet sie überwiegend als „gekauft“. Die Regierung hingegen betont, dass sie mit allen Teilen der Opposition rede. Dadurch versucht sie nicht zuletzt, die Anzahl der potenziellen Präsidentschaftskandidat*innen in die Höhe zu treiben.
Es ist unklar, was hinter den Kulissen passiert
Unklar ist, was hinter den Kulissen passiert. Laut Gerüchten drängen Teile innerhalb der Regierung auf einen zeitnahen Wahltermin, um die Chancen der Opposition auf eine gemeinsame Kandidatur zu verringern. Andere setzen hingegen auf einen späteren Termin, damit sich die Wirtschaft ein wenig erholen kann. Dafür allerdings müsste gewährleistet sein, dass die USA die Sanktionen im Erdölsektor nicht wieder verschärfen.
Zeitgleich zu den Gesprächen geht die Regierung zunehmend gegen Oppositionelle vor. Am 9.Februar wurde etwa die bekannte Menschenrechtsaktivistin Rocío San Miguel am Flughafen von Maiquetía nahe Caracas verhaftet. Auch fünf ihrer Angehörigen wurden vorübergehend festgenommen. Weil drei Tage lang keinerlei Informationen über ihren Verbleib nach außen drangen, berichteten Menschenrechtsaktivist*innen bald schon von einem Fall gewaltsamen Verschwindenlassens.
Die venezolanische Regierung sowie Generalstaatsanwalt Tarek William Saab widersprachen den Vorwürfen vehement. San Miguel, die auch die spanische Staatsbürgerschaft besitzt, sei einem Haftrichter vorgeführt und ihre Rechte jederzeit respektiert worden. Ihre Anwält*innen ließen allerdings verlauten, keinen Zugang zu ihrer Mandantin zu haben. Erst zehn Tage nach ihrer Verhaftung konnte San Miguel im Geheimdienstgefängnis El Helicoide von ihrer Tochter besucht werden. Die Anwältin und Menschenrechtsaktivistin leitet die Nichtregierungsorganisation Control Ciudadano und arbeitet vor allem zum Militär. Die Behörden werfen ihr vor, Teil einer mutmaßlichen Verschwörung zu sein. Demnach sollten Präsident Maduro und weitere staatliche Funktionäre ermordet werden. Im Zuge der Ermittlungen wurden seit Januar dutzende Personen verhaftet, darunter zahlreiche Militärs. San Miguel und ihr Umfeld bestreiten die Vorwürfe. Nachdem die Mission des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte ebenfalls von einem „möglichen Fall gewaltsamen Verschwindenlassens“ gesprochen hatte, kündigte die venezolanische Regierung die Schließung ihrer lokalen Büros an und gab den zwölf Mitarbeiter*innen 72 Stunden Zeit, das Land zu verlassen. Für das Wahljahr deutet all das auf zunehmende Konfrontation hin. Wie die Bedingungen für die Abstimmung letztlich aussehen werden, ist nach wie vor offen. Das neue Abkommen vom 28. Februar enthält keine konkreten Beschlüsse in Bezug auf Transparenz oder internationale Wahlbeobachtung. In der Frage der Antrittsverbote gibt es aus Sicht der Regierung keinerlei Diskussionsbedarf mehr. Die „Plataforma Unitaria Democrática“ hält dennoch bisher an Machado als Kandidatin fest. Tatsächlich befürchten aber nicht wenige, dass die Regierungsgegner*innen am Ende ohne aussichtsreiche Kandidatur dastehen könnten.
Die Opposition müsste daher die gemeinsame Aufstellung einer weniger prominenten Kandidatur planen. Mit dieser Strategie gewann sie bei den letzten Regionalwahlen 2021 den Gouverneursposten im für den Chavismus symbolisch wichtigen Bundesstaat Barinas. Im Falle eines Teilboykotts der Wahl würde Maduro ziemlich sicher wiedergewählt. Die oppositionelle und internationale Strategie, die Präsidentschaftswahlen zu delegitimieren und im Anschluss daran eine US-gestützte Parallelregierung einzusetzen, scheiterte bereits in den Jahren nach 2018. Machado lässt sich derweil nicht beirren. „Wir haben eine starke Einheit gebildet, alle politischen Parteien unterstützen mich öffentlich, und sogar von der chavistischen Basis treten Leute an mich heran“, erklärte sie auf einer Konferenz in den USA Ende Februar. Bisher wirkt das eher wie Wunschdenken.