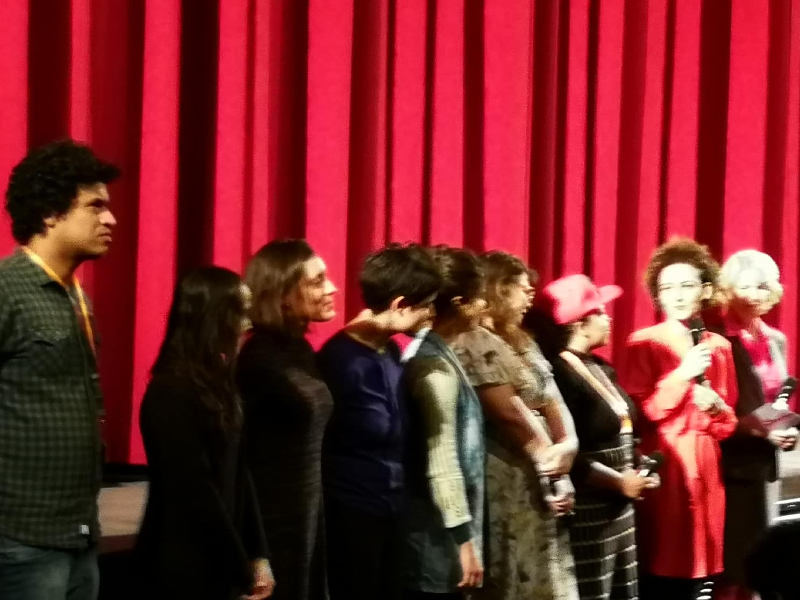Ein Windstoß. Ein Regenschauer. Das Rascheln des Grases. Ein Geräusch, tausendmal gehört und doch vielleicht noch nie so bewusst und intensiv, wie in diesem Moment. Dieser Eindruck stellt sich oft ein beim Sehen der exzellent gedrehten Dokumentation El Eco, die einer ländlichen Familiengemeinschaft in einem entlegenen Dorf auf der Hochebene von Puebla, Mexiko, folgt.

© Radiola Films
Der unbestrittene Star ist in El Eco der Ton – aktuell ein kleiner Trend im lateinamerikanischen Film. Schon der letztjährige Gewinner des Silbernen Bären, Robe of Gems, vertraute stark auf das Auditive, um das Geschehen auf der Leinwand fühl- und erfahrbar zu machen. Und auch in El Eco scheinen Donnergrollen, Tiergeräusche oder die leisen und lauten Gespräche der Bewohner*innen oft schärfer, präsenter als in der Realität zu sein. Dadurch verleiht die mexikanisch-salvadorianische Regisseurin Tatiana Huezo (u.a. Tempestad) auch scheinbar alltäglichen Dingen einen magischen Touch. Die virtuose (Hand-)Kamera von Ernesto Pardo steht dem in nichts nach: Wenn ein Junge einem Huhn hinterherjagt oder eine Schafherde über die Wiese trampelt, folgt sie exakt den Bewegungen und man fühlt sich als Zuschauer*in mitten im Geschehen. Dazu hat Huezo ein Gespür für Momente, Blicke und Bewegungen, die Unausgesprochenes transportieren und so ein tieferes Verständnis für Situationen eröffnen.
Diese kleinen Tricks und genauen Beobachtungen sind auch notwendig, um dem Film Spannung zu geben. Denn viel Ungewöhnliches passiert nicht in der Siedlung El Eco (das namensgebende Echo gibt es dort wirklich). Frauen und Kinder bewirtschaften die Höfe, pflegen Tiere und die greise Großmutter, während die Männer weit weg auf Baustellen Geld verdienen. Der zugrunde liegende Machismus wird direkt und indirekt spürbar: Eine Mutter hat ihre Schulausbildung für die Familie abgebrochen, der toughen Jugendlichen Montse wird die Teilnahme an Pferderennen verboten und auch einige sexistische Sprüche gibt es zu hören. So wird ein Junge von seinem Vater am Abräumen des Tisches gehindert, denn dafür seien „die Frauen da“. Die Männer würden schon genug hart arbeiten müssen. Trotz allem gelingt es Tatiana Huezo aber auch, Momente einzufangen, in denen die Frauen und Mädchen versuchen, die patriarchalen Strukturen aufzubrechen und zu verändern.
Die Abgeschiedenheit von El Eco bietet den Kindern und Jugendlichen zwar eine geborgene Welt mit Naturerfahrungen, Freundschaft und unbeschwertem Spiel in Sicherheit, die nicht allen ihren Altersgenoss*innen in Mexiko vergönnt ist. Unter dem präzisen Blick, den der Film auf sie legt, wird aber auch schmerzlich deutlich, dass sich nicht alle ihre Träume und Wünsche in El Eco verwirklichen lassen werden.
Tatiana Huezo zeigt mit El Eco erneut, warum sie momentan als eine der talentiertesten Dokumentarfilmer*innen Lateinamerikas gilt. Der Film ist eine beeindruckende Beobachtung der harten und entbehrungsreichen Lebensrealität in der mexikanischen Peripherie, der sie durch die Kunst des Filmemachens aber einen besonderen Zauber verleiht. Einziges kleines Manko: Am Ende wirken einige Alltagsszenen etwas repetitiv. Ein paar Minuten weniger hätten dem Film deshalb wahrscheinlich eher genutzt als geschadet.
LN-Bewertung: 4/5 Lamas