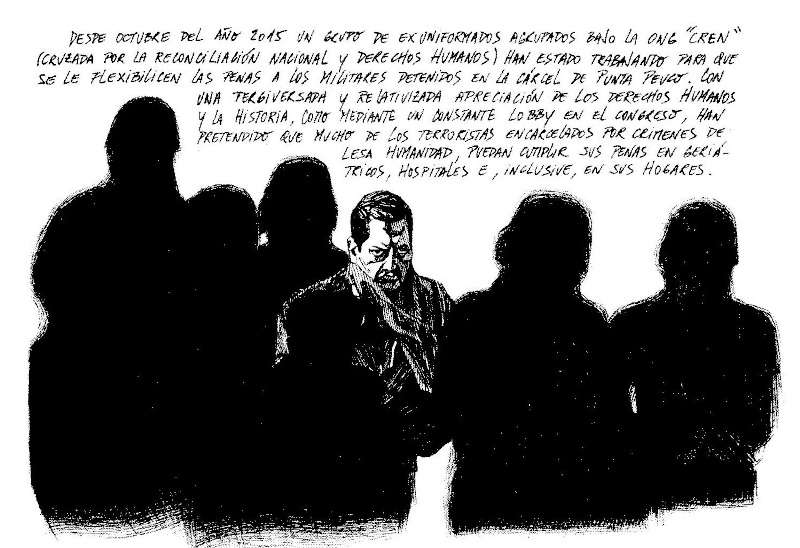Nach dem gewaltsamen Militärputsch gegen die sozialistische Regierung unter Salvador Allende am 11. September 1973 verkündete die Junta unter General Augusto Pinochet, Chile auf den Weg der Demokratie zurückführen zu wollen. Tatsächlich verschleppten und folterten chilenische Sicherheitskräfte zwischen 1973 und 1990 mehr als 40.000 vermeintliche Oppositionelle, so die Schätzung der Wahrheitskommission. Während die Mehrheit der Chilen*innen in der Diktatur zu ihrem Alltag zurückkehrte, unterstützte ein Kreis aus säkularen und klerikalen Linken die politisch Verfolgten.
„Als Anwälte arbeiteten wir an den Gerichten unter anderem Namen und mit verhülltem Gesicht“, erinnert sich Álvaro Varela, ein Mitarbeiter des im Oktober 1973 gegründeten Friedenskomitees. „Was uns ein relatives Gefühl der Sicherheit gab, war, dass wir die Kirche vertraten und große internationale Unterstützung erfuhren.“ Unter dem Schutz des Kardinals Raúl Silva Henríquez unterstützte Varela mit knapp 150 Kolleg*innen Menschen, die arbeitslos oder verhaftet worden waren. Erst im Laufe der Monate verstanden die Mitarbeiter*innen das, was sie taten, zunehmend als Arbeit für universelle Menschenrechte.
Doch nicht nur in Chile regte sich Widerstand gegen die antikommunistische Repression. Weltweit gründeten sich Solidaritätskomitees, die Fluchtwege für chilenische Exilierte organisierten und die Lage in Chile genau verfolgten. Auch die Lateinamerika Nachrichten (LN), damals noch Chile-Nachrichten, verfolgten jeden Schritt der Junta gegen die chilenische Arbeiter*innenklasse. So einschneidend war der Putsch für die antiimperialistische Linke in Deutschland, dass Lehrkräfte und Schüler*innen angehalten wurden, die Lage in Chile im Unterricht zu thematisieren und Texte für Gewerkschaftszeitungen zu verfassen – so beschreiben die Chile-Nachrichten das „Lehrstück Chile“ im April 1974.
Menschenrechtsarbeit unter dem Schutz der Kirche
Solidaritätsbewegte und Mitarbeiter*innen des Friedenskomitees verband das Gefühl, inmitten eines politischen und sozialen Chaos Nothilfe zu leisten. Schon nach wenigen Wochen waren die Büros des Komitees in Santiago überlaufen. Besonders die Berichte über die Foltermethoden der Sicherheitskräfte seien für Außenstehende schwer zu glauben gewesen, erinnert sich die Sozialarbeiterin Sepúlveda: „Aber wir wussten, dass es wahr war.“ Die damals 26-Jährige arbeitete zunächst in der Erstaufnahme der Zeug*innenaussagen, die als Fallakten dokumentiert und erst im Laufe der Jahre systematisiert wurden. Auch Varela erinnert sich an das Gefühl der Überwältigung, als er die Akten erstmals durchging: „Es war unvorstellbar, dass Menschen anderen Menschen so etwas antun können. Mir wurde klar: Alles, was ich bis dahin wusste, war nichts im Vergleich zu dem, was wirklich los war.“
Berichte über Folter und illegale Verhaftungen gelangten in den ersten Monaten vor allem durch Hörensagen nach Deutschland. Gleichzeitig geisterten in den Anfangsmonaten erschreckende Zahlen durch die international immer besser vernetzte Solidaritätsbewegung. So sprach die Frau des getöteten Präsidenten Allende, Hortensia Bussi, vor der Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen im Februar 1974 von 15.000 bis 80.000 getöteten politischen Oppositionellen. Diese weit übertriebene Schätzung gab ausgerechnet der chilenischen Delegation Aufwind, die nun behaupteten konnte, Berichte über Menschenrechtsverletzungen in Chile seien Teil einer internationalen marxistischen Kampagne.
„Die Angehörigen haben uns vor der Hilflosigkeit bewahrt“
„Der Kardinal sagte uns, die Kirche mache keine Fehler, weil sie unfehlbar sei“, erinnert sich der Strafrechtsanwalt Héctor Contreras. Also durften auch wir keine Fehler machen. Denn auch mit nur einem falschen Fall hätten sie gesagt, dass alles eine Lüge ist.“ Auch Contreras wurde mit der Arbeit im Vikariat der Solidarität, der Nachfolgeorganisation des Friedenskomitees, zum Experten für staatliche Repression. Auf der Suche nach den gewaltsam Verschwundenen wurde er während der Diktatur selbst zum Ermittler und Leichengräber. Ihm schien es trotz der Komplizenschaft von Polizei, Gerichten und der Gerichtsmedizin unmöglich, die Suche einzustellen. „Wenn man sagte, das Gerichtsverfahren sei eingestellt worden, fragten die Angehörigen gleich: ‚Und was wirst du jetzt machen?‘ Und willst du dann sagen ‚Nichts‘?“, erklärt Contreras. „Wir haben nichts unversucht gelassen“, erzählt auch María Luisa Sepúlveda. „Wir haben Beschwerden bei den Vereinten Nationen eingereicht, an Gerichten geklagt, Strafanzeigen gestellt … Mit anderen Worten: Die Angehörigen haben uns vor der Hilflosigkeit bewahrt.“
Im April 1974, sechs Monate nach dem Putsch, entschieden sich die Mitglieder des Friedenskomitees, ihre bis dahin weitgehend im Stillen geleistete Arbeit erstmals öffentlich zu machen. Folter im Land zu denunzieren war angesichts der zentralisierten Presse kaum möglich und zudem hochgradig gefährlich. „Unsere einzige Möglichkeit war es, die internationale Öffentlichkeit zu informieren und zu hoffen, dass diese Informationen nach Chile zurückschwappen würden“, so Varela über die Entscheidung, eine Dokumentation von Zeugenaussagen an die mexikanische Zeitung Excélsior durchsickern zu lassen.
Der Bericht, der viele hundert Fälle staatlicher Folter dokumentierte, traf in den Solidaritätsbewegungen für Chile auf offene Ohren. Auch die Chile-Nachrichten berichteten im September 1974 über den im Dokument bezeugten massiven Einsatz von Elektroschocks und Verstümmelungen; von Frauen, die in Haft geschwängert wurden und über „den Fall eines 16-jährigen Jungen, der 15 Tage in einer Kiste eingeschlossen war, die ein Loch hatte, durch welches Essen hereingereicht wurde“. Es waren diese verstörenden Bilder, die durch das Komitee dokumentiert und durch die international vernetzte Solidaritäts- und Menschenrechtsbewegung bis ins hinterletzte Klassenzimmer verbreitet wurden. Diese zunehmend kritische Öffentlichkeit machte Chile im Laufe der 70er Jahre zum Pariastaat und veranlassten frühere Verbündete der Junta wie die US-amerikanische Regierung dazu, Finanzhilfen zeitweilig einzustellen.
Doch nachdem die Informationen an die internationale Öffentlichkeit gelangt waren, erhöhte sich der Druck auf die Mitarbeiter*innen. Der Vorwurf der regimefreundlichen Presse, der Kardinal unterstützte eine Struktur, die durch Marxist*innen vereinnahmt war, säte Misstrauen innerhalb der am Komitee beteiligten Kirchen. „Ich glaube, die Kirchen waren uns dankbar, dass wir uns um die Leute kümmerten“, so Sepúlveda. „Aber gleichzeitig verdächtigten sie uns, der Vorgängerregierung politisch nahezustehen.” Einige Kirchen stellten ihre Unterstützung des Komitees in der Folgezeit ein. Schließlich gab der Kardinal dem Druck Pinochets nach und schloss Ende 1975 die ökumenische Einrichtung, allerdings nur, um sie kurze Zeit später unter dem alleinigen Schutz der katholischen Kirche als Vikariat der Solidarität wiederzueröffnen.
Fortan waren die Mitarbeiter*innen darauf bedacht, öffentlich Distanz zur Solidaritäts- und Menschenrechtsbewegung zu halten. „Es wäre nicht gut gewesen, es zusammen mit der OAS (Organisation Amerikanischer Staaten, Anm. d. Red.) und den Vereinten Nationen zu machen“, erinnert sich Sepúlveda an eine interne Diskussion im Jahr 1978. Als sie erstmals Hinweisen von sterblichen Überresten gewaltsam Verschwundener in einem Ofen der Gemeinde Isla del Maipo nachgingen, hatte das Vikariat hochrangige Vertreter*innen internationaler Menschenrechtskommissionen zu Gast in Santiago. Vor ihnen hielten sie den Fund geheim. „Man hätte gedacht, dass wir es für sie inszeniert hätten”, so Sepúlveda: „Und so vertrauten wir auf uns selbst.“
Zeit schließt nicht alle Wunden
Heute hat Chile eine der weltweit höchsten Quoten an verurteilten Menschenrechtsverbrecher*innen. Dennoch suchen die Angehörigen weiter nach den sterblichen Überresten der gewaltsam Verschwundenen. „Bis heute verfolgt das Militär eine Politik des systematischen Schweigens zu ihren Taten“, so Contreras. Sepúlveda ist der Überzeugung, dass die Zentralisation aller Informationen heute die dringlichste Aufgabe des Staates ist. „Momentan hat jede Einrichtung ihre eigenen Informationen: das Programm für Menschenrechte, die Gerichtsmedizin, die Akten aus den Militärgerichten“, so Sepúlveda. „Es darf nicht den Angehörigen überlassen werden, all die Informationen zusammenzusuchen.“
Auch Contreras blickt heute kritisch auf den ins Stocken geratenen Aufarbeitungsprozess: „Es sind viele weg, die uns früher unterstützt haben, auch weil die Lage nicht mehr so dramatisch scheint. Doch es wurde auch angenommen, dass es keinen Krieg mehr zwischen Großmächten geben könne und plötzlich taucht die Ukraine auf. Das, was sich vermeintlich mit der Zeit schließt, ist eben nicht abgeschlossen.“