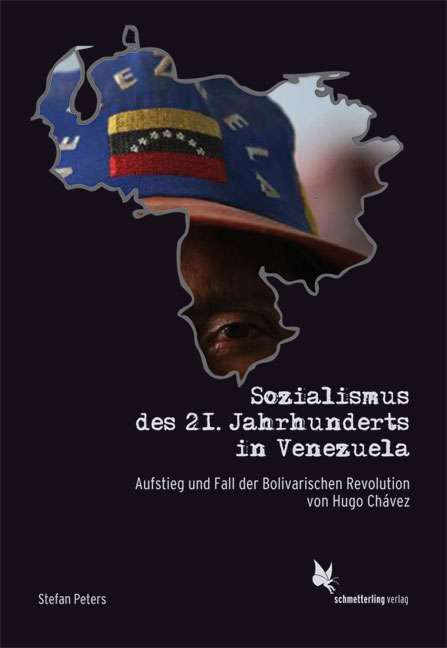
Am Beginn des 21. Jahrhunderts ruhten die Hoffnungen auf Veränderungen
wieder einmal auf Lateinamerika. Die dortige Linkswende markierte das
«Ende des Endes der Geschichte» und in Venezuela wurde unter Präsident
Hugo Chávez der Sozialismus wieder salonfähig. Mit
dem Rückenwind kräftig steigender Rohstoffpreise gelangen der
Bolivarischen Revolution von Chávez nicht nur vielbeachtete soziale
Entwicklungserfolge, sondern auch die Wirtschaft erreichte hohe
Wachstumsraten. Der karibische Sozialismus schien sich positiv von den
gescheiterten Modellen des «real existierenden Sozialismus» abzuheben.
Doch bald wurden die Erfolgsmeldungen spärlicher und Nachrichten von
Verschwendung, Korruption sowie zunehmenden autoritären Tendenzen
untergruben den Modellcharakter. Spätestens mit dem Tod des comandante
im März 2013 und dem Einbruch der Erdölpreise
begann der Niedergang der Bolivarischen Revolution. Allerdings bleiben
viele bisherige Analysen an der Oberfläche, beschreiben oft nur
genüsslich das Missmanagement der Regierung und scheitern an einem
besseren Verständnis der Besonderheiten der Erdölgesellschaft
Venezuelas.
Das Buch verbindet die Analyse der Bolivarischen Revolution in Venezuela
mit Einblicken in die Funktionsweise von erdölbasierten
Rentengesellschaften. Es bietet Einblicke in die Praxis des Sozialismus
des 21. Jahrhunderts, nimmt eine kritische Würdigung der Erfolge des
Chavismus vor und analysiert die Gründe des Scheiterns der Bolivarischen
Revolution.
Auf dieser Grundlage wird die Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen revolutionärer
Veränderungen in rohstoffreichen Ländern des Globalen Südens diskutiert,
bevor die Zukunftsszenarien für Venezuela ausgeleuchtet werden.
Eine Rezension des Buches erschien in LN 537.
Stefan Peters // Sozialismus des 21. Jahrhunderts in Venezuela. Aufsteig und Fall der Bolivarischen Revolution von Hugo Chávez // Schmetterling Verlag // 2019


