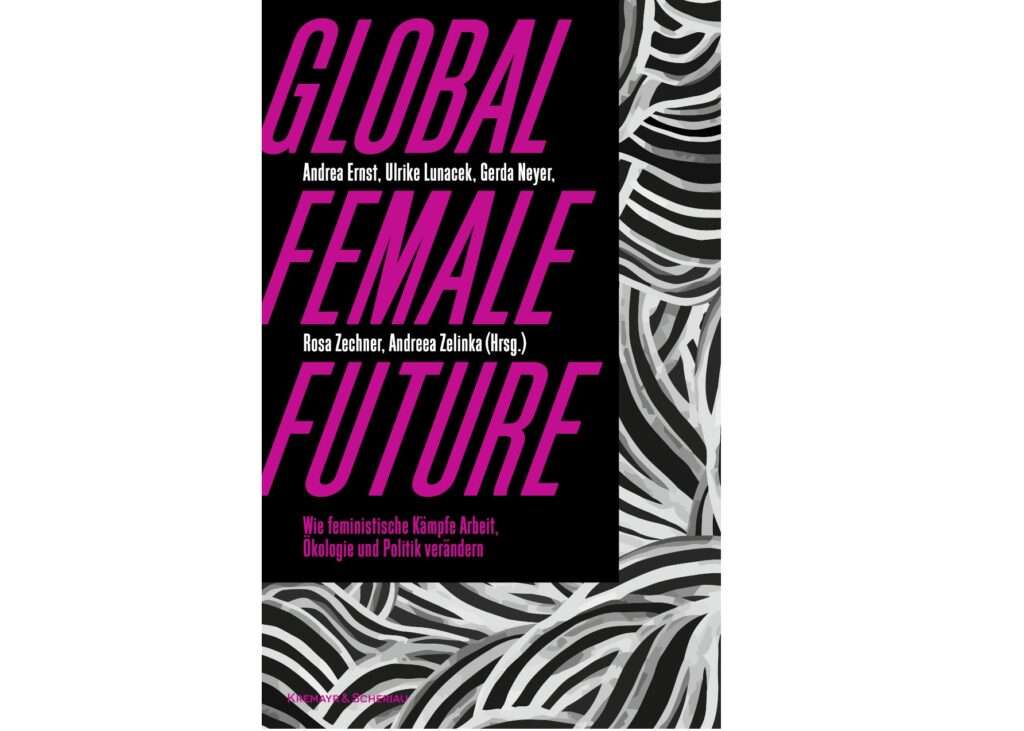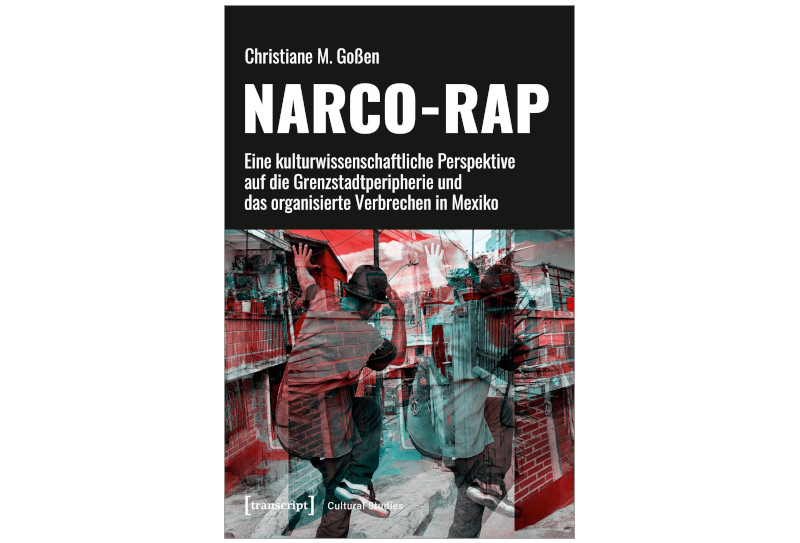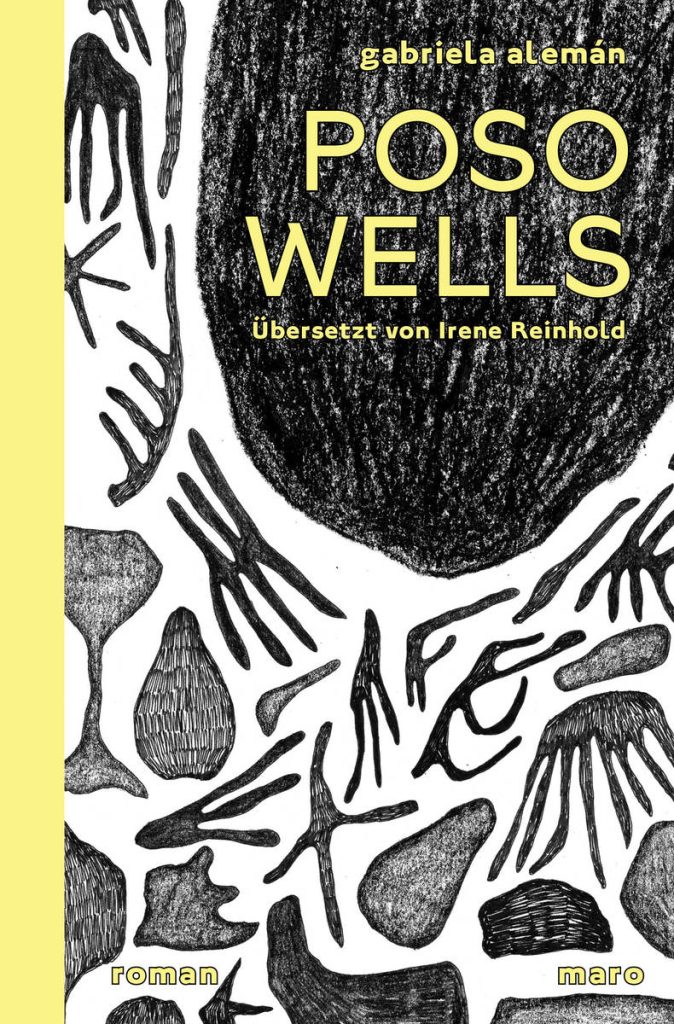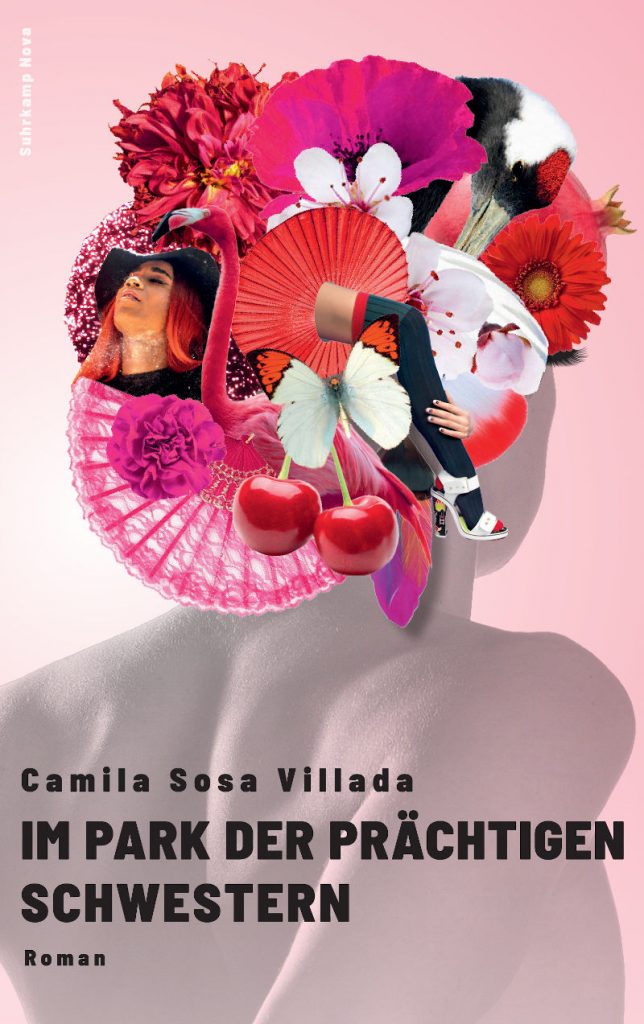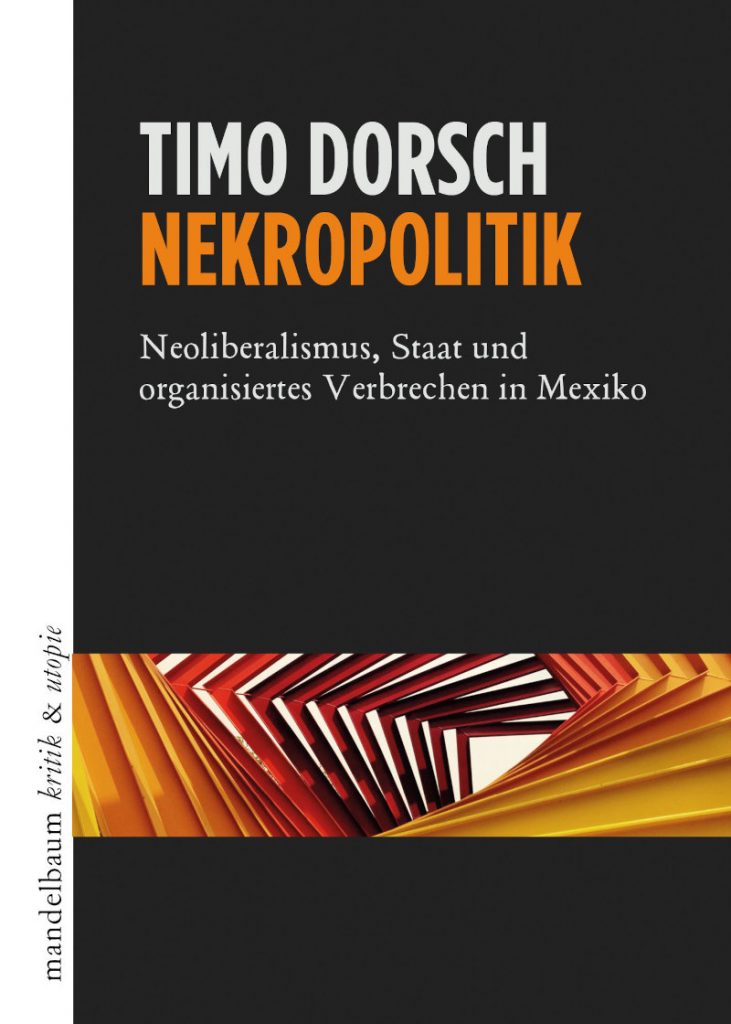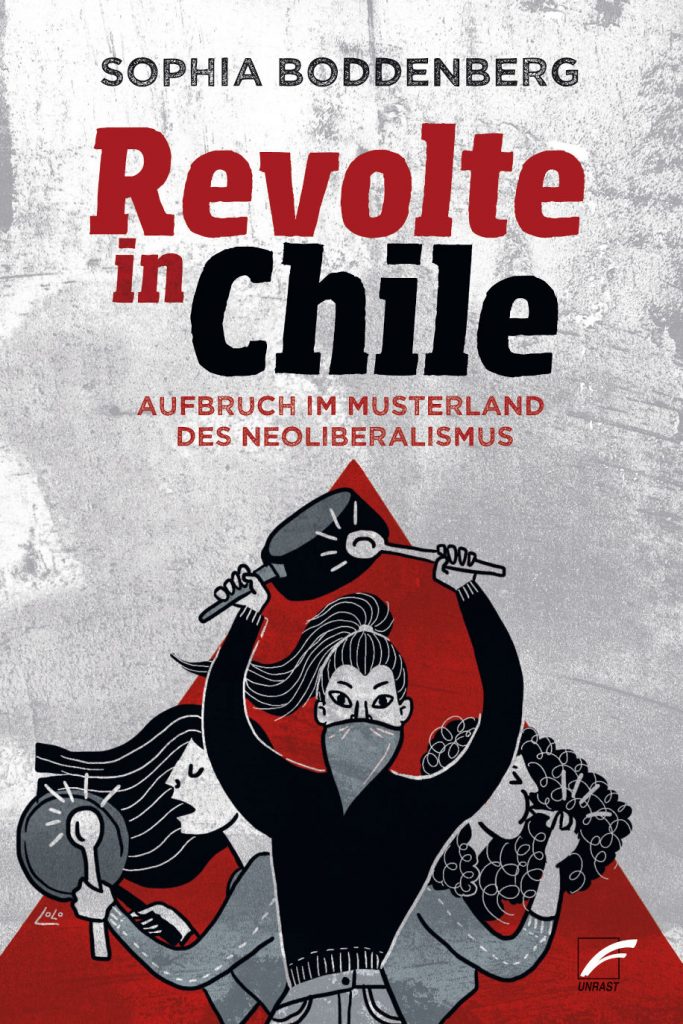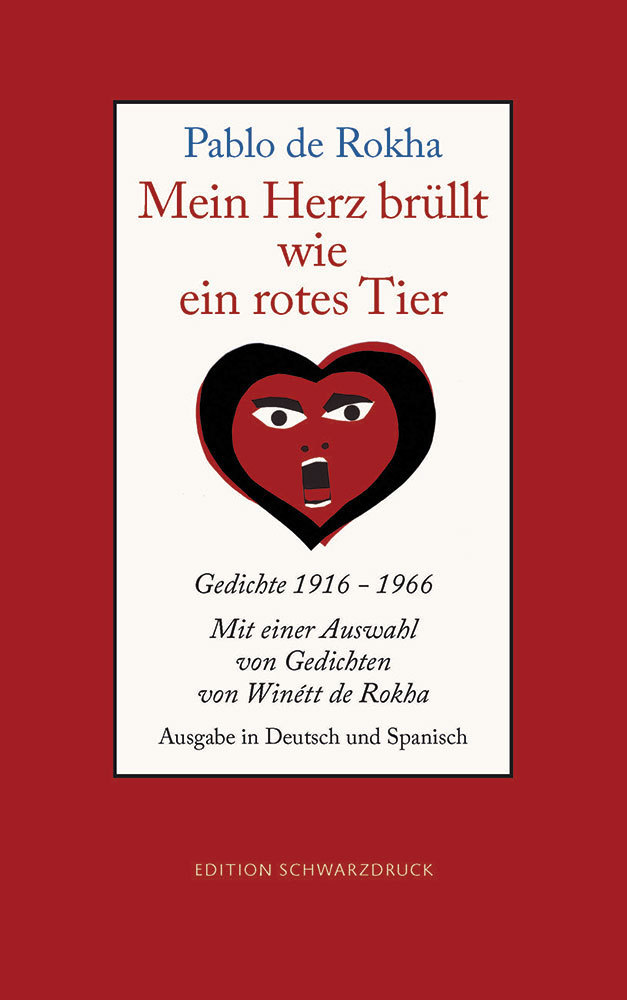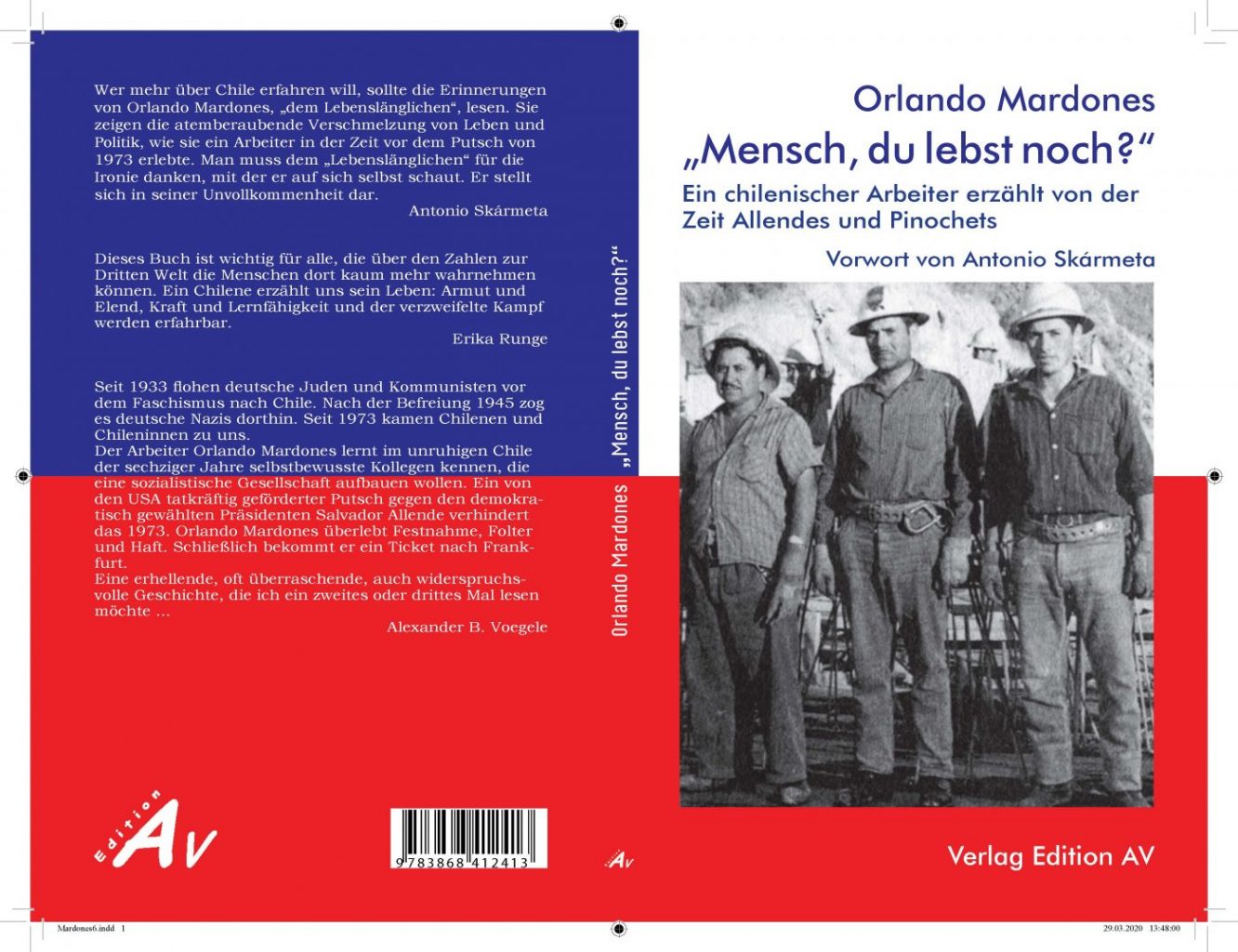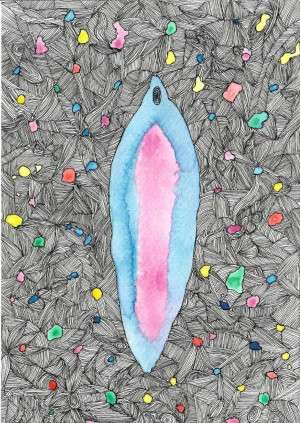
VEN A VIVIR
TODAS LAS POETAS CONMIGO
Hay un romance esdrújulo
de la bruja monja
dedicado a su virreina
donde le pasa la mirada
por toda la cuerpa.
Qué calor hace.
Estoy segura de que
la argentina suicida
solo dijo una vez
“ven a vivir conmigo”
y fue a puras mujeres.
Quiero creer que
los hongos de Marosa
son los pezones
de alguna íntima.
Amiga, siéntate a comer.
Cuando Tatiana dibujó en arcilla una sirena.
fue tu boca de guayaba la que habló.
Yo digo esto con aceite de coco,
sin barroco,
sin morir,
porque, Susana, tienes 26 años
y los ojos de felina,
el cabello de colores.
Cuando éramos niñas,
grafiteabamos nuestros respectivos cuartos,
tú patinabas en tu colonia,
pero yo atrapaba los insectos en la mía;
nunca nos vimos,
solo imagino ahora tus dientes de leche,
¿imaginas la ira de mi adolescencia?,
Tardé 7 años en huir.
tú también te fuiste sola:
el miedo es una tableta sucia,
un enjambre de pelos mojados en la coladera,
un escarabajo.
No importa.
Ven a vivir todas las poetas conmigo,
tendremos todas las fotografías que existen en la munda,
todos los chuchupastes que arden en la papaya
y nos corroen el odio de machos,
siempre embriagadas tú y yo y las amigas
nadando como seres en una materia fungi,
gritaremos tanto rehilete juntas
que nuestras rosas, risas, se harán lengua.
KOMM UND LEBE
ALLE DICHTERINNEN MIT MIR
Es gibt eine esdrújula Romanze
von der Hexennonne
gewidmet ihrer Vizekönigin
wo der Blick
über ihren gesamten Körper* wandert.
Wie heiß es ist.
Ich bin sicher, dass
die suizidale Argentinierin
nur einmal gesagt hatte
“komm und lebe mit mir”
und nur zu Frauen.
Ich möchte glauben, dass
Marosas Pilze die Nippel sind
einer Vertrauten.
Freundin, setz dich und iss.
Als Tatiana auf Ton eine Meerjungfrau zeichnete,
war es dein Guavenmund, der sprach.
Ich sage dies mit Kokosnussöl,
ohne Barock,
ohne zu sterben,
denn, Susana, du bist 26 Jahre alt
und hast Katzenaugen,
die Haare bunt.
Als wir Mädchen waren,
haben wir unsere jeweiligen Zimmer bekritzelt,
du fuhrst in deinem Viertel Rollschuhe,
aber ich habe Insekten in meinem gefangen;
wir haben uns nie gesehen,
ich stelle mir jetzt nur deine Milchzähne vor,
kannst du dir die Wut meiner Jugend vorstellen?
Ich habe 7 Jahre gebraucht, um zu fliehen.
Auch du bist allein gegangen:
Die Angst ist eine schmutzige Pille,
ein Knoten nasser Haare im Abfluss,
ein Käfer.
Es spielt keine Rolle.
Komm und lebe alle Dichterinnen mit mir,
wir werden alle Fotos haben, die es auf der Welt* gibt,
all die chuchupaste-Wurzeln, die in der Pflaume brennen
und macho-Hass zerfrisst uns,
immer berauscht, du und ich und die Freundinnen,
schwimmen wie Wesen in einem Pilzgewebe,
wir werden so viele Pfeile zusammen schreien,
dass unsere Rosen, unser Gelächter, zu Sprache werden.