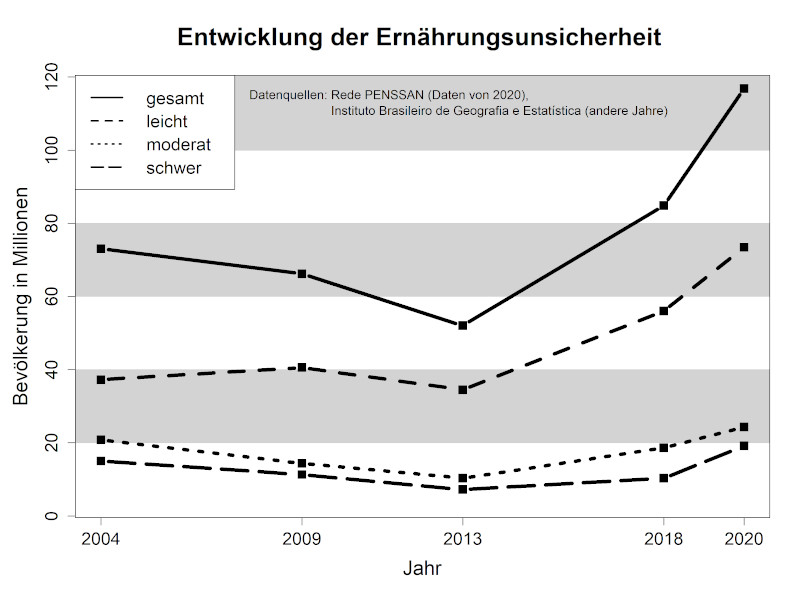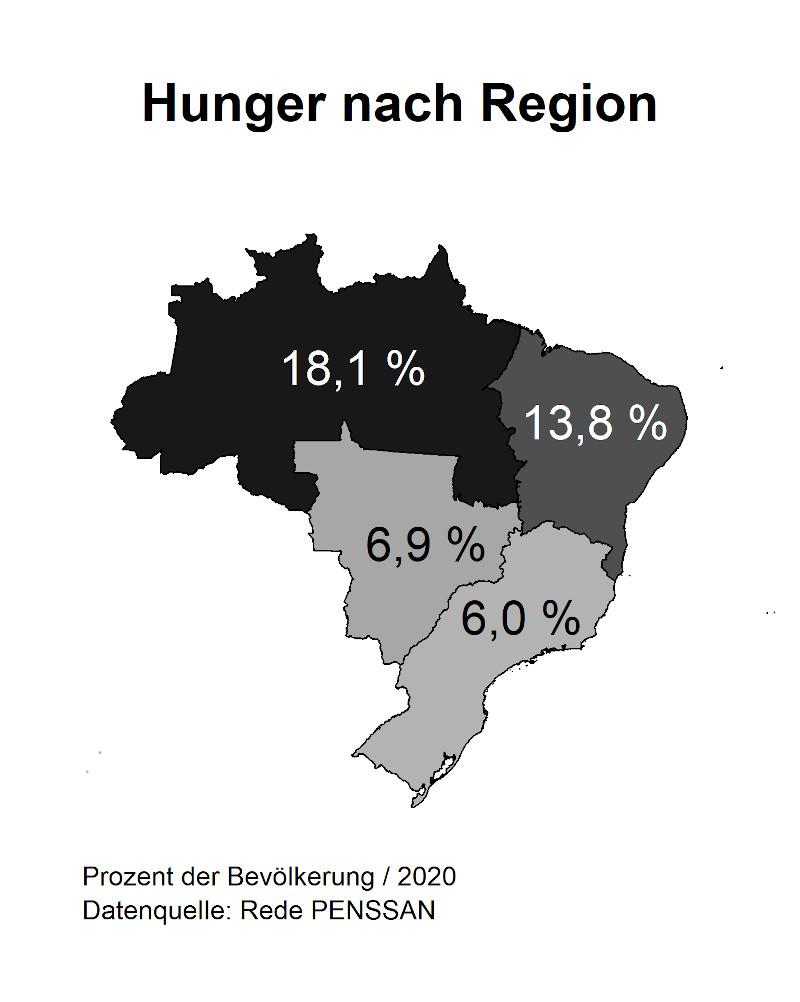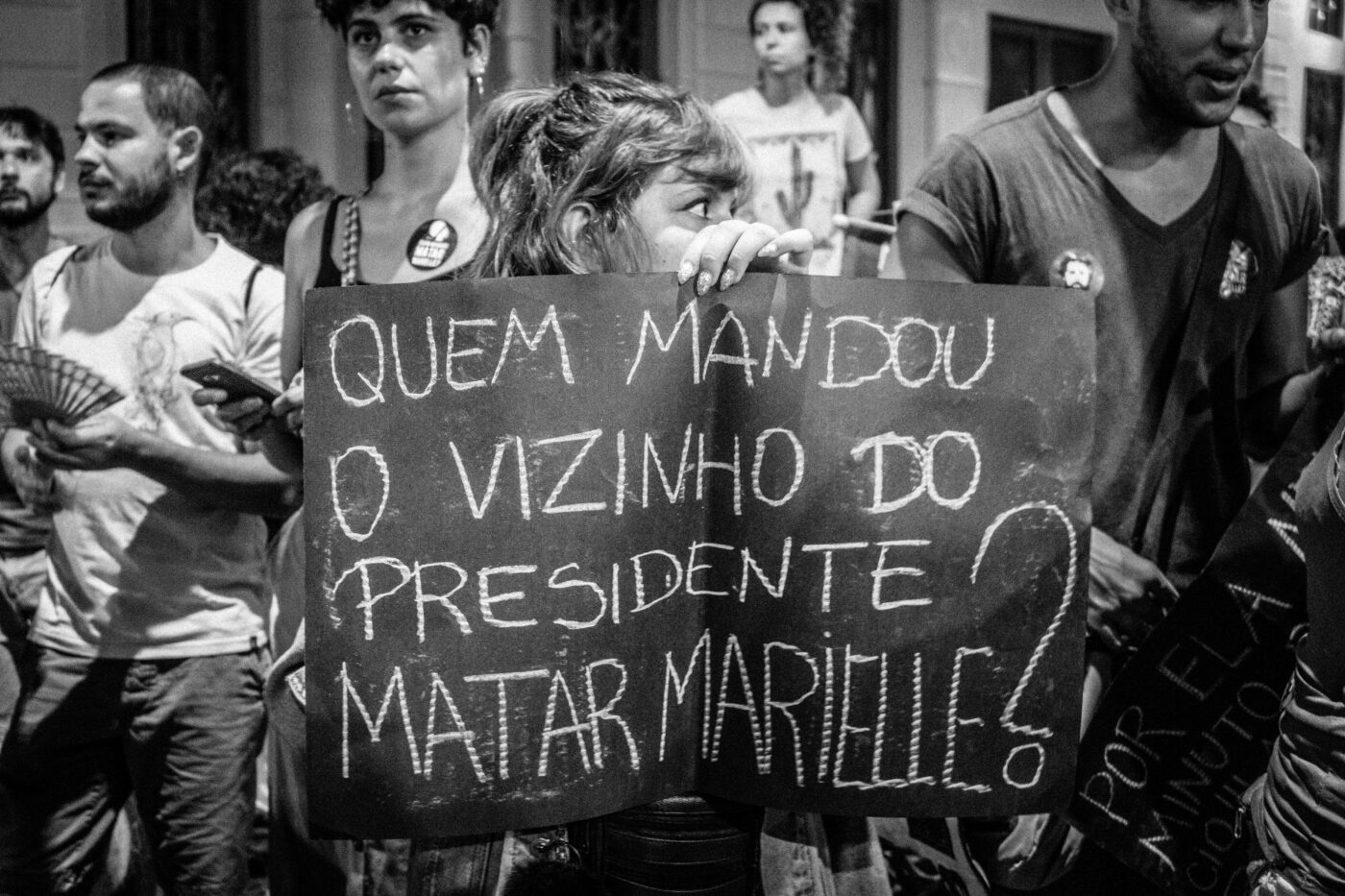Para leer en español, haga clic aquí.

Wie ist es euch seit dem Amtsantritt von Milei ergangen, merkt ihr in der Suppenküche einen Unterschied?
Catalina Fixman: Ja, leider bemerke ich, dass die Zahl der wohnungslosen Menschen seitdem gestiegen ist. Was mir zuallererst aufgefallen ist: Viele Menschen können kein Dach über dem Kopf mehr bezahlen, weil sie keine staatliche Unterstützung mehr bekommen. Dazu kommt noch die Lebensmittelkrise wegen der plötzlichen Preissteigerungen.
Joaquín Puga: Vor Kurzem, als wir gerade auf der Plaza Miserere (zentraler Platz in Buenos Aires, Anm. d. Red.) Essen ausgaben, kamen ein paar Rentnerinnen zu uns, die dort ihre Hunde Gassi führten. Sie fragten uns, ob wir nicht auch eine Portion für sie hätten. Das sind Leute, die ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben. Jetzt bekommen sie eine sehr prekäre Rente, die nicht einmal bis zum Monatsende reicht.
Geht die Regierung diese Probleme an?
JP: Es interessiert sie überhaupt nicht! Das Problem gibt es nicht nur auf Landesebene. Hier in Buenos Aires gibt es einen neuen Bürgermeister, Jorge Macri. Er steht für eine Anti-Wohnungslosenpolitik, er sieht sie als etwas, das die Stadt verunstaltet. Ich sehe es so: Sowohl die Regierung von Buenos Aires als auch die Regierung von Milei machen Politik für die Mittelschicht. Auf Landesebene gibt es jetzt bestimmte Maßnahmen, die den Geldbeutel der Mittelschicht schützen sollen. Zum Beispiel Hilfen für Menschen, die Privatschulen oder private Gesundheitsdienste bezahlen. Währenddessen gehen die staatliche Gesundheitsversorgung und Bildung den Bach herunter! Und die ganzen wohnungslosen Menschen sind einfach nur ein Hindernis, das sie aus dem Weg räumen müssen. Jüngst hat Diego Kravetz, der Sicherheitschef von Buenos Aires, wirklich gemeine Dinge gesagt: alle Wohnungslosen seien gefährlich und hätten Vorstrafen.
CF: Ja, diese Entmenschlichung, die die Menschen sowieso schon erleben, nimmt zu. Viele, die jetzt neu unter dieser Krise leiden, schließen sich völlig ein und entwickeln Hass- oder sogar Gewaltfantasien gegen andere. Für Menschen in verletzlichen Situationen hätte der argentinische Staat schon vorher viel tun müssen, aber nun, nach den ganzen Entlassungen, noch viel mehr. Aber alle öffentlichen Institutionen werden gerade ausgehöhlt. Die Aussichten sind überhaupt nicht gut.
Führt all das nicht für Gruppen wie euch zu einer extremen Überlastung?
JP: Schon. Ich lebe seit 2020 in Buenos Aires und immer hat es wohnungslose Menschen gegeben. Wir als Fahrrad-Verteilgruppe sind früher mit 30 Portionen losgefahren, manchmal haben wir nicht einmal alles verteilt. Jetzt fahren wir mit 50 Portionen los und auf der Hälfte der Strecke ist alles alle.
CF: Das ist tatsächlich ein Thema für uns: Es gibt leider klare Grenzen für das, was wir ausrichten können, denn irgendwann ist das Essen alle. Außerdem verteilen wir ja nur donnerstags und sonntags. Andere Dienste und Essen an anderen Tagen können wir nicht bieten. Gleichzeitig merke ich aber, dass wir in den vergangenen Monaten stark gewachsen sind. Ich glaube, es gibt jetzt mehr Bewusstsein dafür. Wir müssen also weiterhin alles geben und darauf vertrauen, dass dieses Kollektiv vielleicht nicht das große Ganze in Ordnung bringt, aber zumindest etwas sehr Wichtiges tut.
Wie finanziert ihr die Suppenküche?
CF: Amigues war schon immer eine autonome Küche, wird also weder vom Staat noch von einer politischen Gruppierung unterstützt. Wir finanzieren uns nur über Spenden, sowohl monatliche als auch punktuelle. Immer wieder starten wir Kampagnen, um Geld zu sammeln oder bitten direkt um Lebensmittel. Außerdem werden wir zu vielen Veranstaltungen eingeladen, bei denen wir ein Gericht anbieten und Spenden dafür sammeln. Wir verkaufen Sticker und alle möglichen Merchandise-Artikel, denn es gibt mehrere Künstler*innen im Kollektiv, die ihre Werke auf Spendenbasis verkaufen. Da wir ja Miete und das Essen zahlen müssen und ständig neue Ausgaben dazukommen, sind wir dauerhaft auf der Suche nach Spenden._
JP: Zum Glück ist unsere finanzielle Lage aktuell stabil. In einer stressigen gesellschaftlichen Situation gibt es eine Menge Menschen, denen klar wird, dass sie etwas beitragen können und sie tun es. Zum Beispiel, indem sie uns Geld geben oder ihre Zeit schenken und freiwillig mitarbeiten.
In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Demonstrationen gegen die Regierung. Macht euch das Hoffnung?
JP: Es gibt derzeit sehr viele Demonstrationen, zum Beispiel am 23. April die Großdemo für die staatlichen Unis, denen gerade die Budgets gekürzt wurden. Was man damit erreichen kann, weiß ich wirklich nicht. Ich weiß nicht, wann die Regierung sagen muss: „Es gleitet uns aus der Hand, wir müssen einen Schritt zurückmachen.“ Ich glaube ja, dass sie nur für die Mittelschicht regieren, also wird dieser Moment auch erst kommen, wenn die Mittelschicht ihre Interessen in Gefahr sieht.
CF: Mir macht es schon Hoffnung, dass viele Kollektive und Nachbarschaftsversammlungen gerade wachsen. So entsteht eine Organisierung parallel zum Staatlichen und ein Widerstand dagegen, dass die Realität für Viele so schlimm ist. Ich hoffe, dass das weiterwächst. Wir dürfen nicht aufgeben und nicht normalisieren, was passiert. Das müssen wir in andere Länder tragen und sowohl lokal und regional als auch international eine Debatte ermöglichen. Denn klar, jede internationale Solidarität hilft uns. Zum Beispiel gab es auch eine große Spende, die in Berlin bei einer Veranstaltung zusammengekommen ist. Je nach Land gibt es große Ungleichheiten in Sachen Macht und Zugang: Eure Währung ist für uns zum Beispiel viel mehr wert. Und so führen auch kleine Beiträge mit geringem Aufwand hier am Ende zu einem großen Effekt.