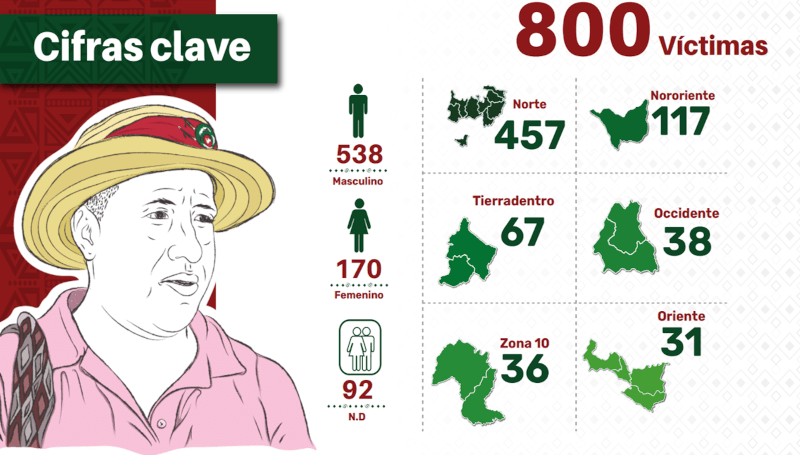Para leer en español, haga clic aquí.

Wir treffen uns einen Tag nach dem brutalen Anschlag auf vier Lesben – Pamela, Roxana, Andrea und Sofía – im Stadtteil Barracas von Buenos Aires. Wie lässt sich dieser Anschlag in der gegenwärtigen politischen Situation erklären?
Dieser spezifische Fall zeigt, wie die Hassreden der Regierung von Milei später konkrete praktische Auswirkungen haben. Wir halten es für wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese Reden nicht erst von dieser Regierung stammen. Sie brodelten schon länger unter der allgemeinen Oberfläche, aber jetzt gibt es eine Legitimation von höchster institutioneller Ebene, diese expliziten Grausamkeiten auch auszuüben. Und das ist definitiv gefährlich. Die derzeitige Regierung ist erklärtermaßen antifeministisch und gegen dissidente Körper. Letzte Woche hat einer von Mileis Biografen gesagt, dass Homosexualität von linken Parteien finanziert sei.
Aber wir leisten auch Widerstand: Gestern gab es eine Versammlung von etwa 400 Lesben aus verschiedenen Teilen des Landes, um zu besprechen, was zu tun ist. Die Situation ist sehr kompliziert, aber sie hat gerade erst begonnen. Unsere Leben implodieren. Jeden Tag gibt es Nachrichten aus dem nahen Umfeld, die uns umhauen. Die Krise der mentalen Gesundheit, in der wir uns aktuell wiederfinden, wirft viele Fragen auf, etwa wie wir gegen diesen Krieg ankämpfen können, der nicht nur kulturell und ökonomisch, sondern auch emotional geführt wird.
Aber mit diesen Hassreden hat Milei doch Wahlkampf gemacht. Wie erklärt ihr euch, dass ihn so viele Menschen gewählt haben?
Es gibt nicht eine einzige Antwort, sondern viele Gründe. Wir beobachten eine Veränderung in den Subjektivierungsprozessen, die sich nach der Pandemie verstärkt haben. Dabei gehen historische, geteilte Erfahrungen verloren, die dazu geführt haben, dass wir heute stehen, wo wir stehen. Zum Beispiel, dass wir ein Land sind, das Prozesse der Bildung und des Kampfes um eine historische Erinnerung hat oder hatte. Wir dachten, dies sei eine feste Säule der Gesellschaft, aber uns wurde klar, dass sie sehr fragil ist.
Als Teil einer Selbstkritik glauben wir, dass dies mit einer Omnipotenz der Menschenrechtsbewegungen und der linken Bewegungen zu tun hat, die einige Diskussionen bereits für erledigt hielten, anstatt sie zu radikalisieren. Ökonomisch hat der Kirchnerismus einen großen Teil der Bevölkerung über Konsum integriert – mit dem ganzen neoliberalen Ballast. Letztlich war es aber kein „wir konsumieren alle“ als Modus einer Umverteilung von Reichtum, denn es gab gleichzeitig viele Menschen in sehr prekären Situationen, denen es schlecht ging. Die Kluft hat sich weiter vergrößert. Jetzt ist es offensichtlich schlimmer. Die Mittelschicht hat noch nie derartige Verluste erlebt.
Bevor wir zu dieser Selbstkritik kommen: Könnt ihr uns mehr über YoNoFui erzählen?
YoNoFui entstand im Jahr 2002 aus einem Poesieworkshop, den María Medrano, eine unserer Genoss*innen, im Gefängnis von Ezeiza gegeben hat. Dort sind wir auf die Schwierigkeiten gestoßen, die jemand hat, der*die die Freiheit wiedererlangt. Es gab keine öffentliche Politik für die Zeit nach der Inhaftierung. Also begannen wir, uns zu treffen und Workshops an verschiedenen Orten zu veranstalten. Das Kollektiv wurde größer, es vergingen mehr als 20 Jahre. Heute sind wir ein Kollektiv mit verschiedenen Bereichen. In unserem Gemeinschaftshaus befindet sich die Kooperative mit verschiedenen Produktionseinheiten: Textil, Buchbinderei und Siebdruck. Dann gibt es noch die neuste Produktionseinheit für Ästhetik und Körperpflege mit dem Namen „Bell, jede Schönheit ist Politik“, die sich in unseren anderen Räumlichkeiten im Stadtteil Palermo befindet. Hier im Gemeinschaftshaus in Flores hast du die Anti-Knast-Bibliothek. Wir machen auch Bücher, wir haben einen Verlag. Unser Kollektiv ist ja aus einem Poesieworkshop hervorgegangen – es gibt also etwas an der Sprache, das uns stetig herausfordert zu hinterfragen.
Ein weiterer Bereich des Kollektivs ist der Segundeo. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Hier auf der Straße sagt man primerear, um sich vor jemanden zu stellen, als ob man konkurrieren würde – ohne, dass dir der*die andere etwas ausmacht. Stattdessen meint segundear zusammen gehen. Es ist sozusagen das Gegenteil von primerear. Segundeo zeigt auch die Art, wie wir uns im Laufe der Zeit umbenannt haben: Am Anfang haben wir „soziale Unterstützung“ gesagt, dann „Begleitung“ und heute macht der Begriff Segundeo für uns mehr Sinn, denn Segundeo ist eine Praktik der Gegenseitigkeit, zu zweit, des gemeinsamen Werdens darin, es ist eine ganz bestimmte Haltung, die wir sehr schätzen.
Was heißt das in der konkreten Praxis?
Segundeo hat mehrere Instanzen. Im juristischen Segundeo haben wir aktuell Genoss*innen, die aus ihrer Zeit im Gefängnis viel juristische Erfahrung haben, und vier antikarzerale und abolitionistische (Strömungen, die sich für die Überwindung von Institutionen staatlicher Gewalt wie Gefängnissen einsetzen, Anm. d. Red.) Anwält*innen. Gemeinsam verfolgen wir die Fälle der Genoss*innen. Wir haben auch Ansätze der kollektiven Mediation. Wir sind ein Kollektiv und auch hier gibt es Konflikte. Mit dem Segundeo versuchen wir dafür Lösungen zu finden, die weder strafend noch sanktionierend sind. Einen anderen Segundeo nennen wir „Autonomie und Selbstverwaltung des Alltagslebens“: staatliche Beihilfen beantragen, einen Lebenslauf erstellen, Orte zum Wohnen suchen und das Alltagsgeschäft des Gemeinschaftshauses verwalten. Nach der Pandemie haben wir gesehen, dass es einen großen Bedarf an Raum für psychische Gesundheit gab. Deshalb haben wir auch noch den Segundeo für mentale Gesundheit eröffnet. Hier haben wir Raum für Gruppen- und individuelle Betreuung. Wir arbeiten ausgehend von einer Idee, die sich vielleicht gegen die hegemoniale Vorstellung richtet, die Gesundheit nur im Sinne von individuellem Wohlbefinden und Glück versteht.
Obwohl wir seit sehr vielen Jahren Erfahrungen mit Kunst- und Handwerksworkshops sammeln, haben wir erst dieses Jahr unsere Schule für Kunst, Handwerk und politisches Experimentieren eröffnet. Wir sind sehr verliebt in dieses pädagogische und politische Projekt, weil wir unseren Raum für die Community öffnen und etwas sehr Lebendiges entsteht, ein Zufluchtsort in einem so komplexen Moment. Es sind 70 Personen eingeschrieben und fast alle sind queer.
Ihr habt die Selbstkritik in diesen Zeiten schon angesprochen. Vielleicht etwas allgemeiner: Mit welchen Problemen seid ihr heute konfrontiert?
Wir sind der Meinung, dass wir immer noch nicht genügend berücksichtigen, welche Auswirkungen das Gefängnis auf jegliche Bindungen in unserem täglichen Leben hat. Nicht nur, ob du im Gefängnis warst oder nicht. Da gibt es etwas, das gesellschaftlich geleugnet wird, etwas in den praktischen und alltäglichen Auswirkungen unseres Umgangs miteinander, das als ständige Bedrohung mit uns lebt wie ein Gerücht, das nicht verstummt.
Eine weitere Herausforderung, der wir uns zu stellen versuchen, ist die Notwendigkeit, eine Sprache zur Abschaffung der Gefängnisse aus südamerikanischer Perspektive oder aus dem Globalen Süden zu schaffen. Denn alle Vorstellungen, die wir haben, kommen aus dem Globalen Norden mit der Entstehung der kritischen Kriminologie oder Angela Davis. Das ist alles brillant und hilfreich, aber wir wollen auch in einem regionalen Kontext denken: Was ist hier ein Gefängnis? Was ist hier Bestrafung? Welche ist hier die Ökonomie der Bestrafung? Wie denkt man Gerechtigkeit? Die Konzepte aus dem Globalen Norden kommen wie eine verschlossene Kiste bei uns an. Also haben wir angefangen, ein Mapping von alternativen Gerechtigkeiten anzulegen, zum Beispiel indigene Gerechtigkeiten oder die Art, wie wir im Alltag Konflikte lösen, die auch Teil einer anderen Art von Gerechtigkeit ist. Das Gleiche gilt auch für innerhalb des Gefängnisses: Was bedeutet es, Gerechtigkeit innerhalb des Gefängnisses herzustellen? Was bedeutet es, Gemeinschaft innerhalb des Gefängnisses aufzubauen? In einer Welt, die zur Hyperindividualisierung neigt, kann der Aufbau von Gemeinschaft ein Weg sein, Gerechtigkeit zu schaffen.
Und gleichzeitig ist es jetzt sehr schwierig. Jetzt haben wir zum Beispiel das Problem, dass sie mit einer Justizreform das Alter der Strafmündigkeit auf 12 Jahre senken wollen. Aber was machst du da? Plötzlich vertrittst du eine konservative Position und sagst: „Nein, halt! Lasst uns nicht auf die 12, lasst uns auf die 18 zurückgehen.” Aber auch das funktioniert für uns nicht. In einem Punkt ist es zwar weniger schlimm, aber als Kollektiv sind wir nicht einverstanden mit diesem strafenden System. Vielleicht wäre jetzt ein guter Moment, uns zu fragen: Was wird kriminalisiert?
Wie arbeitet ihr in dieser Situation mit anderen, vielleicht transfeministischen oder auch anarchistischen Bewegungen zusammen?
Im Allgemeinen sind wir wenige Kollektive aus unabhängigen Aktivist*innen, die keine Parteifahnen hinter sich haben. Und wir halten diesen autonomen Raum aufrecht. Uns erscheint es sehr wichtig aus der Autonomie heraus zu sprechen. Eine Autonomie, die immer in wechselseitiger Abhängigkeit steht. Dieses Jahr haben wir für den 8. März zusammen mit transfeministischen und queeren Aktivist*innen den Mostri-Block gebildet. Das hat uns sehr begeistert, denn die Idee dieses Blocks war es, über die Diskussion um Identität hinauszugehen. Mostri kann jemand sein, der*die im Knast war, Mostri kann eine Person mit Behinderung sein, Mostri können wir antipunitivistischen Kollektive sein, Mostri kann die queere Community sein. Und dann begannen wir uns mit travesti-trans, schwulen, lesbischen Kollektiven, dem gesamten LGBT-Kollektiv und anderen Mostri-Aktivist*innen zu versammeln. Im Alltag kooperieren wir mit dem Kollektiv der Sexarbeiterinnen und mit No Tan Distintes („Nicht so verschieden”), ein Kollektiv, das mit Menschen auf der Straße arbeitet. Aber mit manchen Feminismen ist es kompliziert, vor allem wenn sie sehr frauenzentriert, akademisch und punitivistisch sind. Als antipunitivistisches Kollektiv zur Abschaffung von Strafen beharren wir darauf, dass das Gefängnis keine Lösung ist. Deshalb sagt eine Genossin, Eva Reinoso, immer: „Wir sind unbequem für den Feminismus, aber die Betten in den Gefängniszellen sind viel unbequemer.”
Und mit anarchistischen Bewegungen gibt es eine Nähe zu bestimmten Ideen, sofern wir Anarchismus als Praxis gegen Autorität verstehen. Außerdem stehen die Bündnisse in einer historischen Tradition: Die Anfänge der Kriminalisierung sexuell dissidenter Menschen und Sexarbeiterinnen fallen mit der Kriminalisierung von anarchistischen und kommunistischen Bewegungen zusammen.
Vielleicht hilft das auch die Beziehungen innerhalb des Kollektivs, aber auch nach außen zu stärken. Wie blickt ihr auf die nächsten Wochen?
Uff, schwierig. Wir glauben, dass die nächsten Wochen immer komplexer werden, aber gleichzeitig ist es auch wichtig, dass wir uns weiter verbünden. Mit der Erfahrung des Macrismo, der nicht mal ein Zehntel so schlimm, aber dennoch schrecklich war, können wir vielleicht eine Haltung weder der Hoffnung noch des Optimismus haben. Denn das war auch ein großer Moment der Alternativen: Wir waren so erstickt, so unterdrückt, so unfähig gemacht zu leben, dass wir Leben schaffen mussten. Und die einzige Möglichkeit war, sich zusammenzuschließen und zu mobilisieren. Das Gleiche tun wir jetzt. Aber die Aussicht ist ziemlich entmutigend und eine große Herausforderung. Es ist sehr traurig und schmerzhaft. Gleichzeitig war zum Beispiel der Mostri-Block auf der Demo vom 8M ein Fest und hat uns eine Lebendigkeit wiedergegeben. Deshalb beharren wir, ohne Hoffnung und ohne Optimismus, auf die Traditionen des Kampfes in unseren Territorien, die sehr mächtig sind und die in uns wohnen.