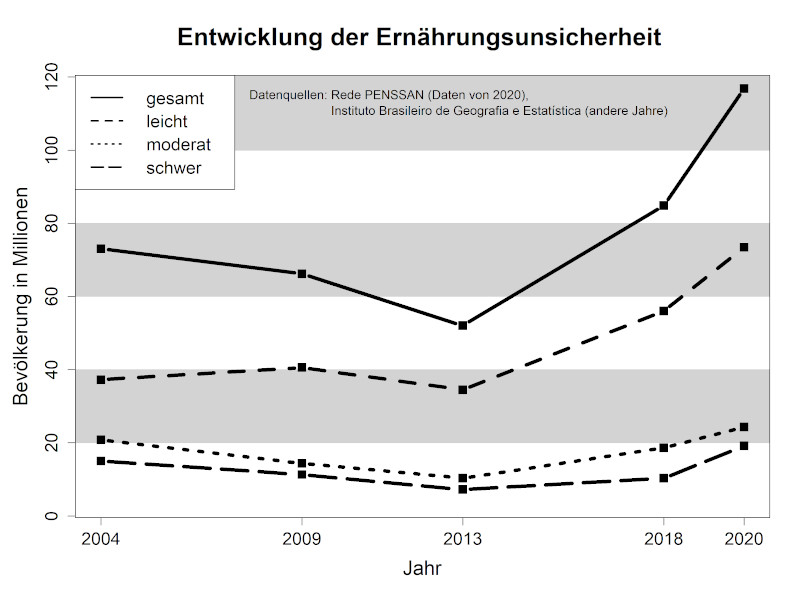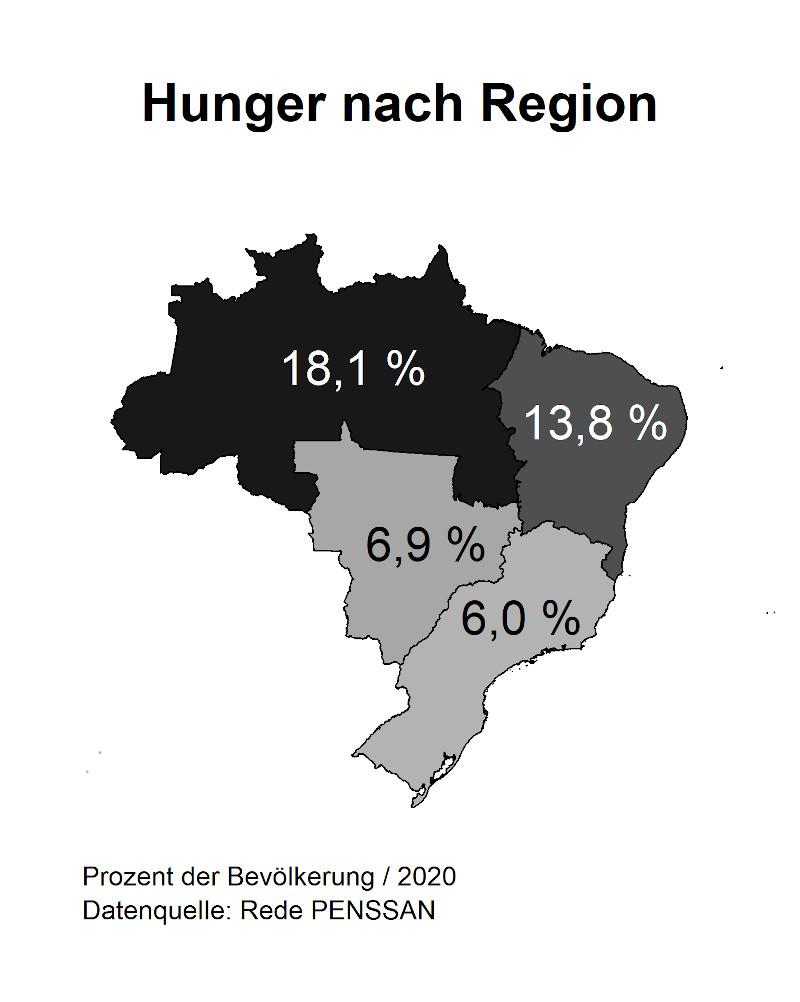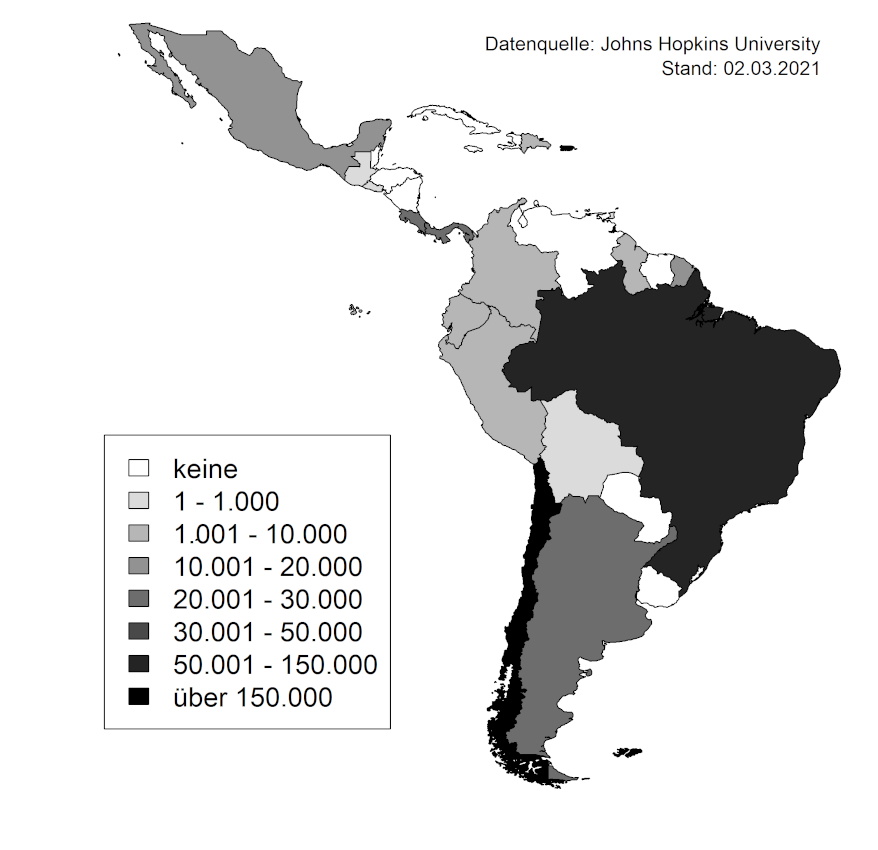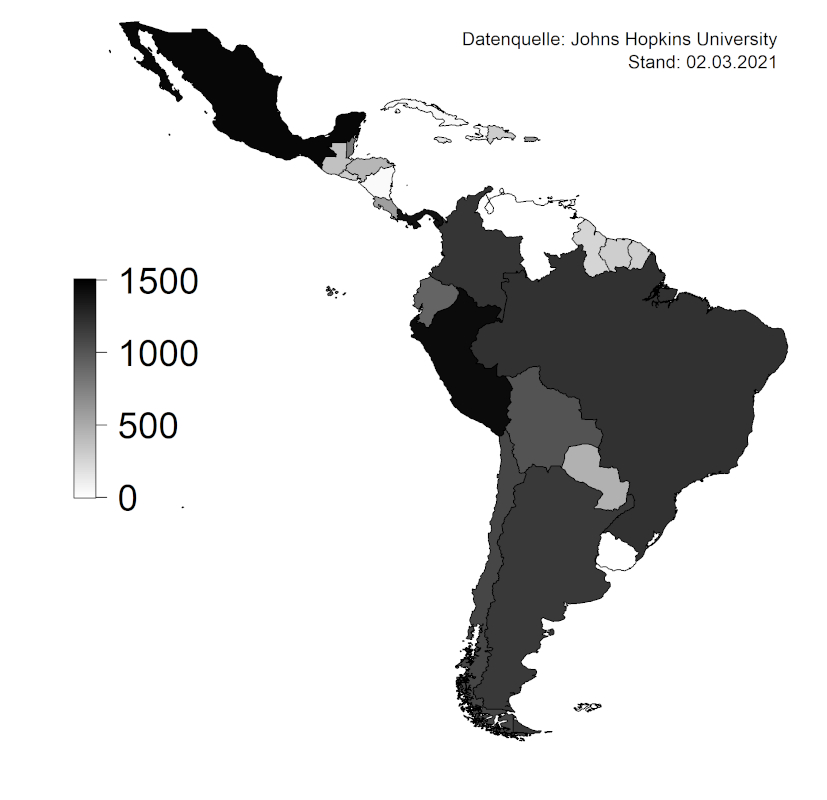Meilenstein der Bewegungen Das Ja zu einer neuen Verfassung schmückte 2020 die Wände von Santiago de Chile (Foto: Ute Löhning)
Im Oktober 2019 gingen aus Santiago de Chile die Bilder des neu benannten „Platzes der Würde“ um die Welt. Abend für Abend versammelten sich Tausende von Menschen, um zu protestieren. Nicht nur gegen die Fahrpreiserhöhungen, die das Fass zum Überlaufen gebracht hatten. Sondern um ein Ende der unwürdigen Lebensbedingungen zu fordern, denen eine neoliberale Verfassung und konservative oder vorgeblich progressive Regierungen sie unterwarfen. Sie zeigten Präsenz, sie zeigten unglaublichen Mut und sie sangen all die Lieder, die schon das Projekt der Hoffnung unter Salvador Allende begleitet hatten. Plötzlich, nach fast 30 Jahren neoliberaler Verfassung und ökonomischer Ausbeutung, schienen die Menschen endgültig genug zu haben von den Verhältnissen. Und so groß war der Wunsch nach Veränderung, dass sie sich durchsetzten gegen eine Regierung, die nur für ein „mehr desselben“ angetreten war und versuchte, dies mit unerbittlicher Härte zu verteidigen. „El pueblo unido jamas será vencido“ – der Kampfruf einer längst vergangenen Zeit hallte durch das Santiago von 2019 und erzwang die Wahl zu einem verfassunggebenden Konvent.
Nicht nur in Chile brach Ende 2019 eine Zeit der gesellschaftlichen Veränderung an: Kolumbien erlebte eine noch nie dagewesene Mobilisierung. Gewerkschaften, Studierende, Oppositionelle, feministische Bewegungen und indigene Verbände riefen zu einem Generalstreik auf, nachdem die Regierung Steuer-, Arbeits- und Rentenreformen zugunsten der Unternehmen und Superreichen angekündigt hatte. Hunderttausende nahmen am Paro Nacional teil. In Bolivien nutzte die Rechte die umstrittenen Präsidentschaftswahlen für einen Putsch, der zu heftigen Auseinandersetzungen auf der Straße und massiver Repression führte. Landesweite Proteste in Ecuador setzten eine Rücknahme der von Präsident Lenín Moreno angekündigten Streichung der Subventionen für Treibstoffe durch. Und in Argentinien trafen sich 250.000 Feminist*innen zum größten jemals organisierten nationalen Frauentreffen – Auftakt für eine Bewegung und Demonstrationen, die noch sehr viel größer werden sollten.
Es war eine aufregende Zeit der Mobilisierungen von unten, in so schneller Folge, dass kaum Zeit für eine Analyse blieb: Sollte nach dem Ende der meisten (gemäßigt) linken Regierungen und der Welle der Machtübernahmen durch Konservative eine neue Phase der Revolte und sozialen Proteste angebrochen sein?
Die Pandemie hat die Proteste gebremst, aber nie zum Erliegen gebracht
In Argentinien erreichte die feministische Bewegung das selbst gesteckte Ziel: Am 30. Dezember 2020 wurde endlich das gesetzliche Recht auf eine legale, freie und kostenlose Abtreibung durchgesetzt. Doch die Legalisierung der Abtreibung war zu diesem Zeitpunkt längst nur noch ein Baustein in der erfolgreich gemeinsam konstruierten feministischen Agenda. Diese hinterfragte immer stärker, was genau den „Kern dessen, was eine Frau als Bürgerin für den Staat bedeutet“, ausmacht, wie es die Aktivistin Marta Dillón formulierte. #EsLey und die Mobilisierungsfähigkeit der argentinischen Feminist*innen wurden zum Meilenstein mit Ausstrahlungskraft in ganz Lateinamerika (siehe LN 560).
Chile befindet sich heute auf dem Weg zu einer neuen Verfassung – eine Kernforderung der Demonstrierenden, die sich versprachen, nicht eher zu ruhen, „bis die Würde zur Selbstverständlichkeit wird“. Der im Mai 2021 gewählte Konvent hat die inhaltliche Arbeit begonnen, die wahrscheinlich mit der jahrzehntelangen neoliberalen Durchdringung der chilenischen Gesellschaft Schluss machen wird – ein Erfolg der Revolte, der soziale Bewegungen in ganz Lateinamerika und darüber hinaus inspiriert (Seite 8).
Es gibt also Anlässe genug, sich intensiver mit den sozialen Protesten der vergangenen Jahre in Lateinamerika zu beschäftigen, mit ihren Erfolgen, Niederlagen und den aufregenden, neu entwickelten Protestformen. Inwieweit diese vielschichtige Mobilisierung von unten in der Lage ist, tatsächliche gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen, ist nicht entschieden. Auch die Ziele der sozialen Proteste sind und waren vielfältig: Geht es vor allem um einen Staat, der tatsächlich Daseinsfürsorge betreibt? Oder geht es heute sehr viel weniger als früher darum, die „richtige“ Regierung ins Amt zu wählen, sondern selbst Mitsprache und Verantwortung zu erhalten – über die repräsentative Demokratie hinaus, die allzu oft nicht die Interessen der Bevölkerung im Blick hat, wie die Pandora Papers ein weiteres Mal gezeigt haben?
Wir nehmen aber in diesem Dossier nicht nur die erfolgreichen Bewegungen in den Blick. In Nicaragua kam es bereits 2018 zu riesigen Demonstrationen. Die Kugeln der Polizei, die nach ersten Mobilisierungen gegen die Kürzung der Renten mit unverhältnismäßiger, brutaler Gewalt gegen friedlich Demonstrierende vorging, wurden zur Initialzündung für einen landesweiten Aufstand. Die Bevölkerung errichtete Hunderte von Straßensperren und unzählige Barrikaden im ganzen Land, die die Wirtschaftsaktivitäten empfindlich störten. Entsprechend unerbittlich schlugen die Sicherheitskräfte zurück. Die Bilanz heute: Hunderte von Toten, Verhaftungen, Gefängnis, Folter, Zehntausende im Exil, die Gegenkandidat*innen Ortegas für die Wahl im November 2021 verhaftet (Seite 38).
In Brasilien gab es vor der Präsidentschaftswahl 2018 große Demonstrationen gegen den Kandidaten Jair Bolsonaro, auch die feministischen Bewegungen mobilisierten sehr erfolgreich mit #EleNão. Seit dem Beginn der Pandemie wurde der Protest jedoch fast ausschließlich online organisiert – eine große Herausforderung für die verschiedenen Feminist*innen, die gerade erst zu einer neuen Vernetzung gefunden hatten. Inzwischen sind die Proteste auf die Straße zurückgekehrt, doch erreichen sie nicht annähernd die kritische Masse, die notwendig wäre, um den rechtsradikalen Präsidenten aus dem Amt zu treiben. Zwei feministische Aktivistinnen ziehen auf Seite 22 eine Bilanz der Bewegung.
Auffällig ist bei allen Protesten die Mobilisierungsfähigkeit der Akteur*innen. Neben den feministischen sind es vor allem die indigenen Bewegungen, die Widerstand gegen alle Formen der Ausbeutung formulieren und eine angemessener Teilhabe aller Gemeinschaften in plurinationalen Staaten fordern. Nach dem Putsch in Bolivien war es vor allem die indigene Bevölkerung, die unter dem Banner der Wiphala die De-Facto-Regierung dazu zwang, die Wahlen im Oktober 2020 durchzuführen und nicht weiter zu verzögern. Trotz aller politischen Defizite der MAS als Partei zeigt dies die Stärke und das Selbstbewusstsein der indigenen Bewegungen (Seite 14).
Die Proteste beziehen sich auf- und lernen voneinander
Der zunehmende indigene Widerstand ist angesichts der 500-jährigen Geschichte von Ausbeutung und systematischer Unterdrückung umso eindrucksvoller. Besondersn in Guatemala zeigt sich, dass traumatische Ereignisse, wie ein Putsch oder Genozid, zu einer anhaltenden Zersplitterung der indigenen Bewegungen führen, die die Organisations- und Widerstandsprozesse verlangsamen (Seite 26).
Aber nicht nur die wachsende Bedeutung von feministischen und indigenen Bewegungen haben die aktuellen sozialen Proteste gemeinsam, sie beziehen sich auch aufeinander, lernen voneinander, übernehmen erfolgreiche Protestformen aus anderen Ländern. Die Vernetzung und die Protestformen werden dabei immer digitaler, nicht nur wegen der Pandemie. Selbst neueste Technologien, wie der Einsatz von Drohnen am Rand der Proteste in Mexiko, erhalten Einzug in die Protestkultur (Seite 53). Gleichzeitig gibt es immer mehr künstlerische Protestaktionen und Live-Musik während der Demonstrationen (Seite 56). Die feministische Performance der chilenischen Gruppe Las Tesis ging um die Welt.
Dasselbe gilt aber auch für die verschiedenen Formen der Repression, denen der „Aufruhr auf der Straße“ ausgesetzt ist. So ist es kein Zufall, dass sowohl in Chile wie auch in Kolumbien eine große Anzahl von Demonstrierenden Augenverletzungen erlitten, dahinter stecken die gleichen Polizeitaktiken. Die Protestierenden wehren sich mit neuen Formen des Widerstands wie der primera línea, der „ersten Reihe“, die sich schützend zwischen Polizei und Demonstration stellt. Mehr dazu in zwei Beiträgen zu Repression und Protestformen in Chile und Kolumbien (Seite 42 und Seite 46).
Am Ende dieses Dossiers haben wir mehr Fragen als Antworten gewonnen. Ein Ende des „Aufruhrs auf der Straße“ scheint nicht in Sicht. El Salvador, das sich seit Präsident Bukeles Amtsantritt ebenfalls in Richtung Diktatur bewegt, erlebte im September 2021 die größten Proteste seit Jahrzehnten, als sich verschiedenste gesellschaftliche Gruppen gegen die Demontage der Demokratie und die Einführung des Bitcoins als Zahlungsmittel zur Wehr setzten (Seite 32).
Der Erfolg der sozialen Mobilisierung von unten ist ungewiss. In vielen Ländern scheint der Ausgang der gesellschaftlichen Auseinandersetzung offen, selbst in Chile, wo die Revolte bisher die weitreichendsten Erfolge errungen hat. „Laborando el comienzo de una historia sin saber el fin“ – „Den Anfang der Geschichte erarbeiten, ohne den Ausgang zu kennen“ – heißt es dazu treffend auf dem Wandbild des Titelbildes dieses Dossiers. Oder, wie es Marielle Franco, die Ikone der brasilianischen Frauenbewegung ausdrückte: „Wir müssen so handeln, als sei die Revolution möglich.“