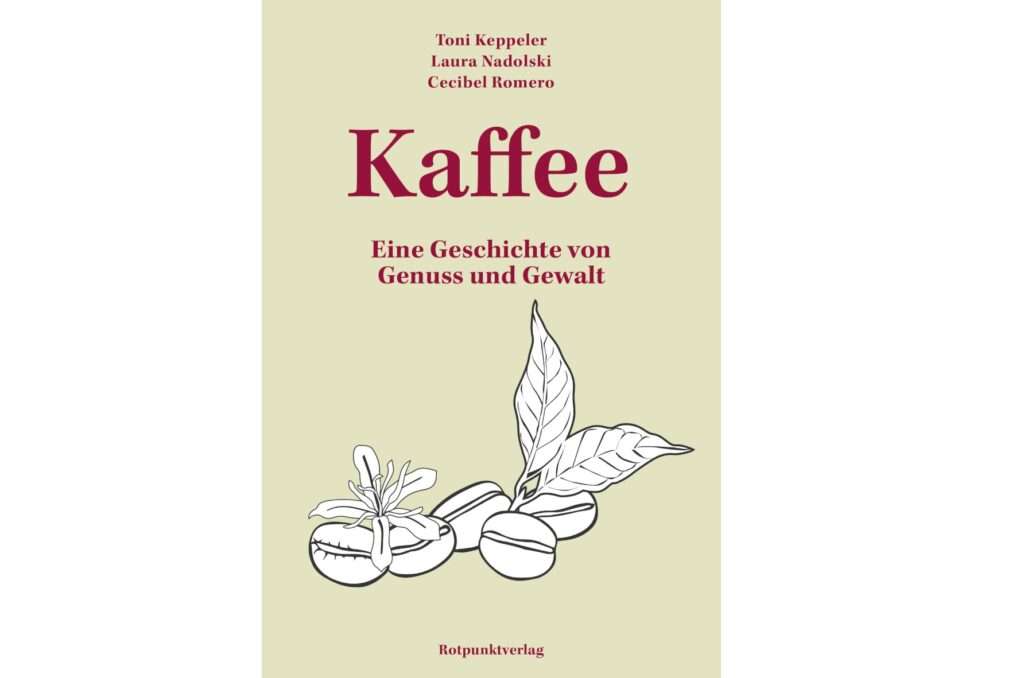Erst Anfang Mai hat Ecuadors Präsident Daniel Noboa als Antwort auf die herrschende Gewaltkrise im Land einen neuen Ausnahmezustand in mehreren Provinzen erklärt. Auch in Haiti, Argentinien, Honduras und Chile gelten unter Regierungen unterschiedlicher politischer Couleur derzeit Notstandsregelungen, zumindest in Landesteilen. Unrühmlicher Vorreiter dieser neuen Welle von Ausnahmezuständen in Lateinamerika ist der salvadorianische Präsident Nayib Bukele.
Es begann Ende März 2022 mit dem blutigsten Wochenende, das es in El Salvador je zu Friedenszeiten gegeben hat: In nur drei Tagen ermordeten Gangmitglieder mindestens 87 Menschen. Daraufhin ersuchte Präsident Bukele den von seiner Partei Nuevas Ideas kontrollierten Kongress um die Verhängung extremer Maßnahmen, die laut Verfassung lediglich für Fälle von Krieg, Katastrophen und schweren Störungen der öffentlichen Ordnung vorgesehen sind. Der Ausnahmezustand sollte eigentlich nur für dreißig Tage gelten, ist jetzt aber bereits seit über zwei Jahren in Kraft. Bukeles Massengefängnisse sind inzwischen weltweit bekannt. Seit 2022 haben die staatlichen Sicherheitskräfte nach offiziellen Angaben über 75.000 Menschen verhaftet. Mindestens 239 Menschen sind in den überfüllten Gefängnissen gestorben, viele davon ohne jemals vor Gericht gestellt worden zu sein und mit klaren Folterspuren am Körper.
Während ein großer Teil der Bevölkerung Bukele als starken Mann und autoritären Anführer feiert, vermarktet sein Kommunikationsteam den Rückgang der Kriminalität weltweit als „Modell Bukele“. In Ecuador bereits mit Erfolg – weitere Länder könnten nachziehen. Die Folgen einer „Bukele-Welle“ wären fatal, denn Ausnahmezustände sind für punktuelle Krisenüberwindung gedacht. Wenn jedoch ein nicht enden wollender Ausnahmezustand wie in El Salvador von einer autoritären Regierung zur Sicherung und Ausweitung ihrer Macht eingesetzt wird, sind die Folgen für die Rechtsstaatlichkeit und die Menschenrechte der Bürger*innen gravierend.
An dieser Entwicklung ist der Wirtschaftsimperialismus Deutschlands und anderer Länder des globalen Nordens mitverantwortlich: Er befördert die weltweite Durchsetzung kapitalistischer, neoliberaler Strukturen durch Freihandelsabkommen und die Stabilisierung des extraktivistischen Wirtschaftsmodells. Europäische, transnationale Unternehmen setzen ihre Marktmacht hier wie dort ein, um Druck auszuüben und auf Politik in ihrem Interesse hinzuwirken. So wird die in Lateinamerika ohnehin hohe Ungleichheit weiter verstärkt, die folgende Chancenlosigkeit führt zu mehr Kriminalität und entsprechenden Sicherheitsproblemen. Diese dienen dann als Rechtfertigung für den Ausnahmezustand, den autoritäre Regierungen wiederum als Vorwand nutzen, um weitere neoliberale und antidemokratische Reformen voranzutreiben – eine verhängnisvolle Abwärtsspirale.
Beim Thema Ausnahmezustand sollten auch hierzulande Alarmglocken klingeln: Auch in Deutschland wurde in den 1930er Jahren schon einmal durch einen permanenten Ausnahmezustand eine Demokratie abgeschafft. Heute werden Demokratien in ganz Europa immer fragiler, rechtspopulistische und faschistische Parteien vernetzen sich weltweit – darunter die AfD. Sie wollen demokratische Institutionen aushöhlen und autoritäre Regime errichten. Die Linke ist dem gegenüber gefragt, sich selbst stärker zu vernetzen und alternative Strategien gegen die Ursprünge der eskalierenden Gewalt anzubieten. Die wenigen Gemeinden El Salvadors, in denen Ganggewalt konsequent abgewehrt werden konnte, weisen einen besonders ausgeprägten sozialen Zusammenhalt auf. Neben dem grundlegenden Kampf gegen Ungleichheit muss also ein weiterer Fokus darauf liegen, soziale Strukturen zu stärken.