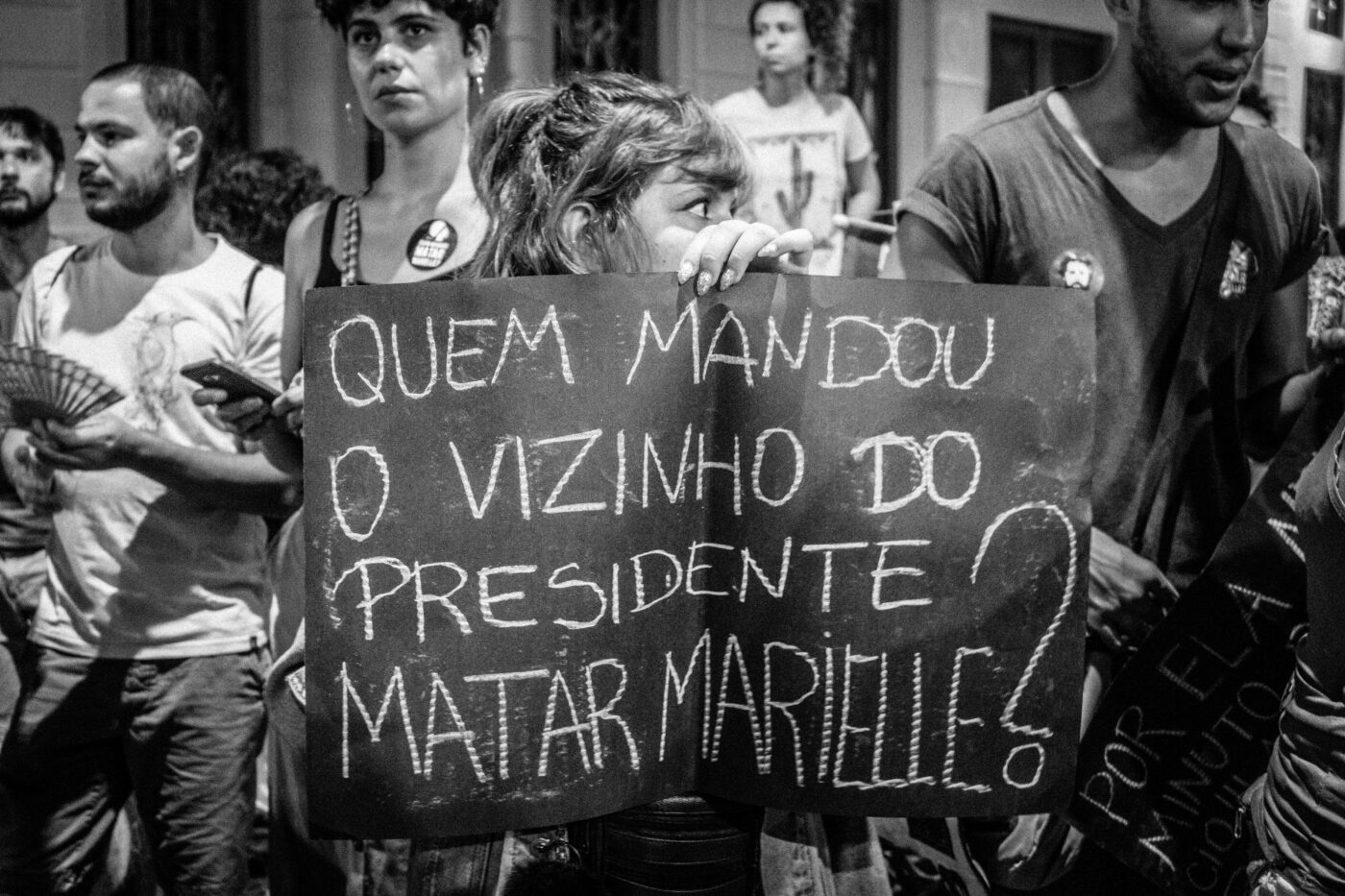In den frühen Morgenstunden des 18. Oktober 2023 erlebte Pater José Filiberto Velázquez Florencio einen bewaffneten Angriff, während er mit seinem Auto durch die Stadt El Nuevo Caracol im mexikanischen Bundesstaat Guerrero fuhr. Der Mordversuch an Pater Velázquez Florencio ging von mutmaßlichen Mitgliedern eines Drogenkartells aus. Zuvor hatte er mehrmals sowohl gegenüber staatlichen Institutionen als auch öffentlich auf die kriminelle Präsenz in seiner Stadt in Guerrero aufmerksam gemacht. Pater Velázquez Florencio ist der Leiter der Organisation Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello (Zentrum für die Rechte von Gewaltopfern Minerva Bello). Diese zivilgesellschaftliche Organisation setzt sich seit 2018 für die Verteidigung der Rechte von Menschen ein, die im Bundesstaat Guerrero Opfer von Gewalt geworden sind. Dazu zählen beispielsweise die Familienmitglieder von den 43 seit 2014 verschwundenen Studenten aus Ayotzinapa.
Doch die kriminelle Präsenz in der Region ist nicht neu. Vor über einem Jahrzehnt kamen die kanadischen Bergbauunternehmen Torex Gold und Equinox Gold nach Guerrero, um Gold abzubauen. Ihre Ankunft machte die Gegend attraktiv für Drogenkartelle, die sich Einnahmen durch Erpressung der lokalen Bevölkerung erhofften. Die Angriffe durch kriminelle Gruppen haben sich seit November 2022 erheblich vermehrt, als territoriale Streitigkeiten zwischen rivalisierenden Gruppen wie dem Kartell Jalisco Nueva Generación, Los Tlacos und der Familia Michoacana begannen.
Das Neue dabei ist die Art, wie diese Gruppen Chaos und Angst unter der Bevölkerung verbreiten. Seit November 2022 setzen sie modifizierte Drohnen ein, um die Gemeinden anzugreifen. Diese Drohnen werden mit Sprengstoff, Nägeln und Pellets bestückt. Aus der Ferne werden sie dann gesteuert und als Waffe verwendet. Bis jetzt gab es in Guerrero mehrere solche Angriffe und sie führten bisher zu zwei getöteten Personen und Sachschäden. Pater José Filiberto berichtet, dass diese Drohnen aufgrund der bergigen Landschaft von El Nuevo Caracol eingesetzt wurden: „Es handelt sich um eine Region voller Berge und Hügel, in der es durch den sehr breiten Fluss Balsas eine natürliche Barriere gibt. Weil die Bewohner*innen die Straßen gesperrt haben, reagierten die kriminellen Gruppen mit Schüssen von den Hügeln aus sowie mit dem Abfeuern von Bomben durch Drohnen. Durch die vielen Berge und Hügel gibt es nämlich erhebliche Schwierigkeiten, diese Orte mit Bodentruppen und Fahrzeugen zu erreichen.“
Drohnen mit Sprengstoff, Nägeln und Pellets sollen Angst verbreiten
Die Gewalt hat vor allem drei sichtbare Auswirkungen auf die Stadt. Erstens führte sie zur Vertreibung von 600 Personen, die Schutz in benachbarten Städten suchten. Zweitens leben die verbliebenen Bewohner*innen in Angst und unter ständigem Stress. Weil medizinisches Personal und Lehrer*innen flüchteten, kam es drittens zum Mangel an öffentlichen Dienstleistungen wie Bildung und Gesundheit. Als Reaktion auf die anhaltende Gewalt durch die Drogenkartelle haben sich Menschen aus mindestens 30 umliegenden betroffenen Städten in Bürgerwehren organisiert und eine Allianz von 67 Gemeinden gegründet, die von den lokalen und föderalen Behörden Schutz fordern.
Die aktive Zivilgesellschaft wird durch die Politik geschwächt
Die staatliche Reaktion auf die Situation der Unsicherheit in Mexiko wurde von den Bürgerwehren stark kritisiert. Die Regierung hat Ausrüstung zur Konfiszierung von Drohnen und Sprengstoffen erworben und eine rechtliche Initiative zur Erhöhung der Haftstrafen für den Einsatz von Drohnen bei illegalen Aktivitäten vorangetrieben. Trotzdem bleibt Pater José Filiberto skeptisch hinsichtlich der Wirksamkeit dieser Maßnahmen. Er befürchtet, dass die Hauptstadt von Guerrero eine „Zeitbombe“ sei: „Dort finden derzeit Hinrichtungen statt. Gestern haben sie einen zerstückelten Körper vor die Tore der Nationalgarde in Chilpancingo geworfen. Ich denke, es wird weiterhin sehr besorgniserregende Nachrichten über Gewalt in dieser Region geben. Besonders jetzt, da der Wahlkampf für die anstehende Präsidentschaftswahl näher rückt, werden politische Verbrechen zur Alltäglichkeit.“
Er stellt weiterhin fest, dass die Rolle der zivilgesellschaftlichen Organisationen von der Regierung missachtet und unterbewertet wird: „Wir leben in einer Zeit, in der das Recht, sich selbst zu verteidigen, zu einem politischen Angriff gegen die Machthaber*innen wird. Als Menschenrechtsorganisationen, Journalist*innen oder aktive Zivilgesellschaft sind wir geschwächt. Der Staat will das Monopol über die Verteidigung der Menschenrechte behalten. Dabei verachtet er die echte Menschenrechtsarbeit, die abseits der politischen Parteien geleistet wird. Das setzt uns Risiken aus. Es macht uns verwundbarer.“
Es ist weder das erste Mal, dass ein Aktivist ins Visier krimineller Gruppen gerät, noch, dass sich die Zivilbevölkerung in einer Bürgerwehr organisiert. Das ist schon früher geschehen, vor allem in Michoacán, ein weiterer Bundesstaat, der von Drogenkartellen bedroht wird. Genau wie in der Vergangenheit war die Reaktion der Regierung unzureichend, um die Bewohner*innen zu schützen und die Macht der Drogenkartelle zu schwächen. Stattdessen ist eine Zusammenarbeit zwischen den staatlichen Behörden und der Zivilgesellschaft notwendig, um Sicherheit und Frieden zu fördern. Diese zwei Elemente werden in Mexiko dringender denn je benötigt.