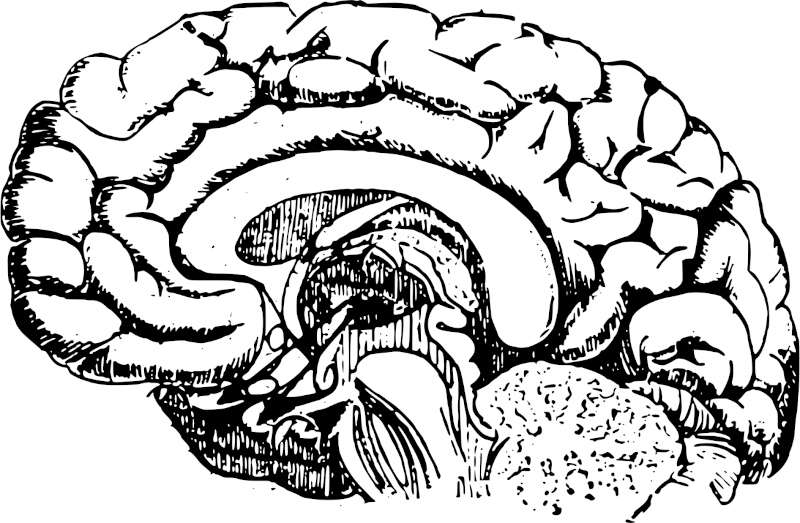„Als wir die Organisation der PHA5 übernommen haben, war unser Land noch ein anderes“, sagte die argentinische Mitorganisatorin Carmen Báez zur Eröffnung. Argentinien hatte erst letzten Sommer die Ausrichtung der Versammlung kurzfristig übernommen. Die „Motorsäge“ Milei und die politische Situation in Argentinien insgesamt waren in Mar del Plata allgegenwärtig – Marina, eine Basisgesundheitsarbeiterin (sp.: Promotora de Salud) aus den marginalisierten Vierteln von Buenos Aires, erfuhr während ihres Vortrages zum Thema Poder Popular (dt. in etwa „Basismacht“) im Gesundheitswesen von der Verhaftung ihrer Genoss*innen bei einer Demo gegen Entlassungen im öffentlichen Dienst.
Die Gesundheitssysteme entfernen sich jedoch nicht nur in Argentinien immer weiter vom Ziel einer universellen, öffentlichen Gesundheitsversorgung, von „Gesundheit für alle”. Das ist das übergeordnete Ziel des People’s Health Movement (PHM). Um es zu erreichen, fordert die Abschlusserklärung des Treffens unter anderem einen ökologischen Umbau, Klimagerechtigkeit, die progressive Besteuerung von Einkommen, Kapital, Erbschaften und Konzernen, kurz: eine neue internationale Weltwirtschaftsordnung. Indigene Bewegungen aus Süd- und Mesoamerika verbanden dies mit der Forderung nach Dekolonialisierung des Wissens um Gesundheit hin zum integralen Verständnis des buen vivir (Prinzip des guten Lebens).
Die fünfte Versammlung ist die zweite in Lateinamerika seit Gründung des PHM. Seine Voreschichte beginnt bereits im Jahr 1978. Damals waren Gesundheitsminister*innen aus 134 Ländern zu einer von der WHO und UNICEF organisierten Konferenz zum Thema Primäre Gesundheitspflege (engl.: Primary Health Care) im damals sowjetischen Alma-Ata zusammengekommen. Primäre Gesundheitspflege ist ein umfassendes Konzept von Krankheitsverhütung bis Rehabilitation. Die Konferenz verkündete das globale Ziel von „Gesundheit für alle bis zum Jahr 2000“. Die Erklärung von Alma-Ata machte deutlich, dass zum Erreichen dieses Ziels die Errichtung einer neuen internationalen Weltwirtschaftsordnung notwendig sein würde, wie sie die Generalversammlung der Vereinten Nationen zuvor schon 1974 gefordert hatte. Mit der neoliberalen Revolution von Reagan und Thatcher seit den 1980er Jahren war die anschließende Entwicklung jedoch in die entgegengesetzte Richtung verlaufen: Neoliberale Wirtschaft wurde globalisiert, Gesundheitswesen im Globalen Süden privatisiert und die Ungleichheiten in der Verwirklichung des Rechtes auf Gesundheit nahmen immer weiter zu. Das PHM entstand als Antwort auf diese Situation. Am 8. Dezember 2000 trafen sich 1453 Delegierte aus 92 Ländern in Savar (Bangladesch) zur ersten People’s Health Assembly. Seitdem haben in Cuenca, Ecuador (2005), Cape Town, Südafrika (2012) und wieder in Savar (2018) weitere Treffen stattgefunden.

Beim dem fünften Treffen in Mar del Plata verdeutlichten die Dreieckstücher der argentinischen Frauen die starke Präsenz feministischer Themen: Geschlechtergerechtigkeit im Gesundheitswesen, Kampagnen zur Verbesserung des Zugangs zu sexuellen und reproduktiven Gesundheitsdiensten, Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Frauen im Gesundheitssektor und Abbau patriarchaler Modelle. Femizide seien Ausdruck einer weltweiten Krise öffentlicher Gesundheit, so Marta Montero, die Mutter von Lucía Pérez Montero, einer 16-jährigen Argentinierin, die 2016 Opfer eines Femizids geworden war. Diskriminierung und Gewalt gegen Frauen in Gesundheitseinrichtungen sind auch in anderen Ländern Lateinamerikas verbreitet. Selbst das Recht auf Abtreibung, in den letzten Jahren vielerorts erstritten, ist noch nicht für alle Personen mit Uterus Realität, insbesondere nicht für arme, indigene und Schwarze Personen. Frauen- und LGBTIQ*-Rechte waren ein Querschnittsthema aller Kämpfe der PHA5.
Überschattet wurde die Konferenz von der dramatischen Lage in Gaza und im Sudan. Aktivist*innen aus Gaza waren aufgrund der Bedingungen dort und der Verweigerung von Visa durch die argentinische Regierung nicht persönlich anwesend. Online zugeschaltet konnten sie dennoch über die unsäglichen Opfer und Zerstörungen im palästinensischen Gesundheitswesen sowie über den Einsatz von Hunger als Waffe gegen die Zivilbevölkerung berichten. Die Versammlung machte deutlich, dass Frieden, Souveränität und Demilitarisierung entscheidende Voraussetzungen für die Verwirklichung des Rechtes auf Gesundheit für alle sind. In diesem Sinne stand auch die Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand in Gaza.
Kolumbien als Beispiel neoliberaler Gesundheitsreformen
Die gegenwärtige Lage der Gesundheitssysteme in Lateinamerika war Gegenstand von Arbeitsgruppen der PHA5. Kolumbien ist ein Beispiel extremer neoliberaler Reformen. Durch das Gesetz Nr. 100 von 1993 war das Gesundheitssystem in eine Vielzahl meist profitorientierter privater Krankenversicherungen und Dienstleister zersplittert worden. Im Bereich der Krankenversicherungen hatte die Reform eine Zweiklassenmedizin mit beitragszahlenden und staatlich subventionierten Versicherten geschaffen, wobei letzteren nur ein eingeschränktes Paket medizinischer Leistungen zur Verfügung steht. In der Folge sind ärmere Patient*innen von einer angemessenen Gesundheitsversorgung ausgeschlossen und im Krankheitsfall oft zu katastrophalen Barzahlungen gezwungen. Der Versuch einer Gesundheitsreform des linken Präsidenten Gustavo Petro hin zu einem universellen Gesundheitssystem ist bislang an den Widerständen der Kapitalinteressen gescheitert. Auch in Brasilien stößt der Versuch Lula da Silvas und seiner Gesundheitsministerin Nidia Trinidade, das öffentliche Gesundheitssystem zu revitalisieren, auf heftigen Widerstand. Einziger Ausweg scheint in beiden Ländern die breite Mobilisierung der Bevölkerung.
Eine wichtige Analyse des Treffens in Mar Del Plata: Weltweit sind Gesundheitssysteme von einer immer stärkeren Finanzialisierung und Privatisierung geprägt. Was Finanzialisierung bedeutet, machte Nicoletta Dentico auf der Versammlung deutlich: „Gesundheitsziele wurden den Werten von Aktionären, Marktschwankungen und finanziellen Misserfolgen unterworfen. … Die Kräfte der Finanzialisierung sind sehr stark, strategisch, gut organisiert und proaktiv.“ Nicoletta kommt von der Gesellschaft für Internationale Entwicklung (SID) in Rom. Private First (dt.: Privatinteressen zuerst), sagt sie, ist zum vorrangigen Prinzip von Regierungen, internationalen Organisationen und Entwicklungsbanken geworden. Dabei gibt es immer mehr wissenschaftliche Belege dafür, dass auf der Beteiligung des privaten Sektors basierende Gesundheitssysteme nicht dazu beitragen, einen universellen Zugang zur Gesundheitsversorgung zu erreichen. Dazu zählen auch öffentlich-private Partnerschaften (PPP) oder die Tätigkeiten wohltätiger privater Stiftungen wie die Bill & Melinda Gates Foundation, die von Superreichen gegründet werden, um Steuern zu vermeiden und dann durch Wohltätigkeit indirekt politische Prioritäten setzen (dies wird auch als Philanthrokapitalismus bezeichnet).
Fran Baum, australische Co-Autorin des Entwurfs des Calls to Action (Aufruf zum Handeln), der zum Abschluss von PHA5 verabschiedet wurde, sieht in der Privatisierung des Gesundheitssystems einen Beitrag zur allgemeinen Entfremdung des Menschen im Kapitalismus, wie sie schon Marx beschrieben hatte. Sie warnte auch vor dem Übergang von Neoliberalismus und staatlicher Austeritätspolitik zu einem neuen Faschismus, wie er sich jetzt mit Javier Milei in Argentinien zeige.
Der Call to Action greift die Forderung nach einer neuen internationalen Weltwirtschaftsordnung als Bedingung für Gesundheit für alle wieder auf, die schon die Alma Ata Deklaration von 1978 erhoben hatte. Das schließt die Forderung nach einem ökologischen Umbau, der progressiven Besteuerung von Einkommen, Kapital, Erbschaften und Konzernen sowie einer Transformation hin zu universellen Gesundheitssystemen ein. Denn, so sagte der Kolumbianer Román Vega, globaler Koordinator des PHM, gegenüber der brasilianischen Plattform Outra Saúde: „Der extraktive, transnationale Kapitalismus […] blockiert durch unterschiedliche Verfahren und Strategien das Erreichen von Gesundheit für alle.“