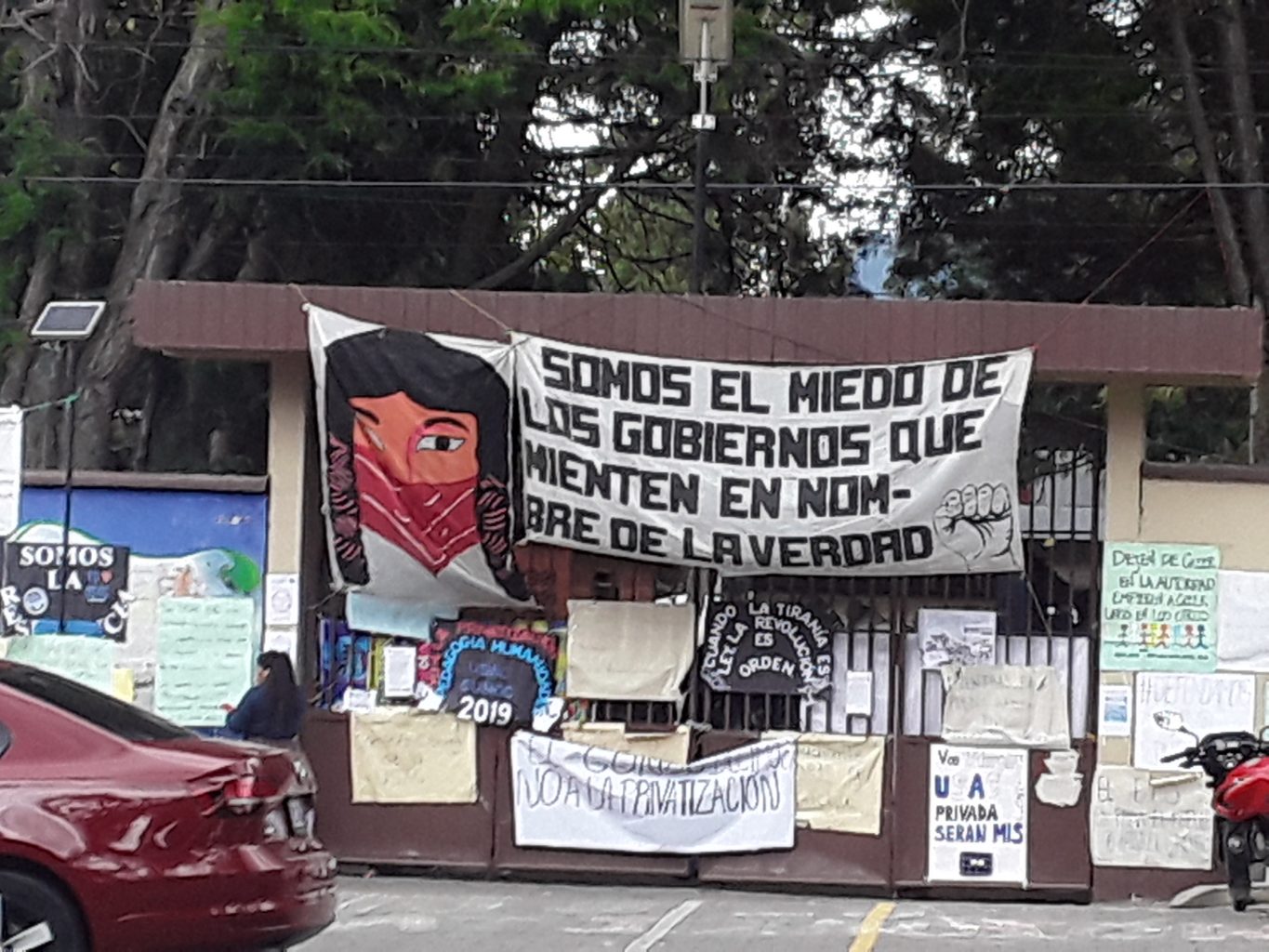Internationaler Nürnberger Menschenrechtspreis Rodrigo Mundaca (Mitte) mit seiner Auszeichnung (Foto: Giulia Lannicelli)
Internationaler Nürnberger Menschenrechtspreis Rodrigo Mundaca (Mitte) mit seiner Auszeichnung (Foto: Giulia Lannicelli)
Der Nürnberger Menschenrechtspreis wird alle zwei Jahre an Menschen verliehen, die sich trotz hoher Risiken für die Wahrung der Menschenrechte engagieren. Der diesjährige Preisträger Rodrigo Mundaca kämpft in der chilenischen Region Petorca nördlich der Hauptstadt Santiago für den freien Zugang zu Wasser. Mundaca ist Sprecher der Organisation Modatima, der Bewegung zur Verteidigung des Zugangs zu Wasser, der Erde und des Umweltschutzes. Modatima wurde 2010 gegründet und verfolgt das Ziel, die Rechte der lokalen Bevölkerung – Landwirt*innen, Arbeiter*innen und Einwohner*innen – zu verteidigen und Wasserkonflikte sichtbar zu machen. In der Region Petorca bauen agroindustrielle Unternehmen Avocados und Zitrusfrüchte für den Export an (ausführliche Reportage siehe LN 527). Nach Angaben von Modatima ist die lokale Bevölkerung seit den 1990er Jahren davon betroffen, dass sich die Unternehmen, in Absprache mit Politiker*innen, der regionalen Wasserressourcen bemächtigen.
Die Jury weist darauf hin, dass der Kampf um Wasser in Chile kriminalisiert und Mundaca in seiner freien Meinungsäußerung eingeschränkt, strafrechtlich verfolgt und verurteilt werde. „In den Jahren 2012 bis 2014 stand er 24 Mal vor Gericht”, erläutert die Jury in ihrer Begründung. Zudem erfahre Mundaca permanent Einschüchterungen und Drohungen und müsse in ständiger Angst, verhaftet zu werden, leben und arbeiten. Die Hoffnung der Jury sei, dass der Preis Mundaca den notwendigen Schutz verleiht, um seinen Einsatz ohne diese großen Gefahren fortzusetzen.
Der Kampf um Wasser wird in Chile kriminalisiert
Einige Tage nach der Preisverleihung erklärt Mundaca in Berlin, welche Gesetze seiner Meinung nach ausschlaggebend für die Privatisierung des Wassers in Chile sind. So führte eine Verordnung im Forstrecht in den ersten Jahren der Pinochet-Diktatur dazu, dass eine Fläche von über zwei Millionen Hektar der Siedlungsgebiete der Mapuche drei Unternehmensgruppen überlassen wurde. „Der Ursprung für die Zwangsvertreibung von Mapuche-Gemeinschaften liegt in ebendiesem Dekret”, stellt Mundaca fest. Eines der drei Unternehmen existiert heute nicht mehr, die anderen beiden sind die Firmengruppen Matte und Angelini. Mundaca ergänzt, dass der Ursprung des ungleich verteilten Reichtums im Land auf der Aneignung von Grundstücken und Naturgütern basiere. Die stehe auch in Beziehung zum Wassergesetz, dem Código de Aguas, das 1981 – ebenfalls während der Diktatur – erlassen wurde. Doch auch noch in den Jahren nach der Diktatur, als die Concertación de Partidos por la Democracia, ein Bündnis von Mitte-Links-Parteien, Chile regierte, wurde etwa die Privatisierung der Abwasserentsorgung aus sanitären Anlagen beschlossen.
Ohne eine Änderung der Verfassung habe die chilenische Bevölkerung demnach keine Chance, ihr Recht auf Wasser wiederzuerlangen, so der Wasseraktivist Mundaca. Artikel 19 der Verfassung von 1980 schreibt Privatpersonen, die Wasserrechte besitzen nämlich das Eigentum an diesen zu. „Bis heute ist die Privatisierung des Wassers durch die Verfassung abgesichert“, so Mundaca. Sowohl für eine Abschaffung der besagten Verordnung im Forstrecht als auch für eine Abschaffung des Wassergesetzes benötige es eine Verfassungsänderung. Der Kongress in Chile könne beschließen, dass Wasser nicht mehr als Privateigentum geltend gemacht werden kann. „Aber dafür bräuchte es ein qualifiziertes Quorum von drei Fünftel. Und die dafür nötigen Stimmen gibt es nicht“, erläutert der Agraringenieur.
Sieben Minister aus Piñeras Kabinett sind selbst Eigentümer von Wasserrechten
Zudem hat Präsident Sebastián Piñera schon während seiner ersten Wahlkampagne versprochen, Rechtssicherheit dafür zu schaffen, dass das Privateigentum an Wasser und die Verordnung zum Forstrecht unberührt bleiben. Nun regiert er gemäß dieser Aussage. Die Erkenntnis, dass sieben Minister aus Piñeras Kabinett selbst Eigentümer von Wasserrechten sind, ist auch Mundacas Arbeit zu verdanken. In einem Artikel von Anfang Oktober berichtete BBC Chile, dass der chilenische Agrarminister Antonio Walker Minderheitsgesellschafter von drei Unternehmen ist, die über Wasserrechte verfügen. In Bezug auf den Umfang der Nutzungsrechte wird er mit den Worten zitiert: „Vielleicht sind es 400 Liter Wasser pro Sekunde“.
An das Berliner Publikum gerichtet, sagte Mundaca, die Menschen in Europa „wissen nicht, dass 71 Prozent der Wassernutzungsrechte, die auf die Bereitstellung von Strom aus Wasserkraftweken abzielen, im Besitz der italienischen Firma ENEL sind; die Italiener sind Eigentümer der Flüsse im Land.” Erst vor wenigen Wochen hat die chilenische Regierung den Fluss Renaico zur Versteigerung freigegeben, der Grenzfluss zwischen den Regionen Bío-Bío und Araucanía. Mundacas Wissen nach seien es vor allem transnationale Unternehmen mit Sitz in Europa, die sich die Flüsse Chiles aneignen und die natürlichen Ressourcen durch exzessive wirtschaftliche Nutzung immer weiter verringern. Und das in einer Zeit, in der die Regierung mehrere Regionen zu Wassernotlagegebieten (zonas de emergencia hídrica por sequía) erklärt hat und der Klimawandel und die Trockenheit nicht mehr aus dem aktuellen Diskurs wegzudenken sind. Erst im September war Valparaíso aufgrund der vor Ort herrschenden Dürre zum Wasserkatastrophengebiet erklärt worden.
Die Jury des Internationalen Nürnberger Menschenrechtspreises appellierte in ihrer Begründung auch an die Verpflichtung Chiles zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen. Konkret gehe es hierbei um das sechste Entwicklungsziel in der Agenda 2030: die Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle zu gewährleisten. Dafür kämpfen Organisationen und Aktivist*innen wie Rodrigo Mundaca angesichts der politischen Untätigkeit, die bislang nur den Interessen von Großunternehmer*innen zuspielt. Umso wichtiger also, dass die Nürnberger Jury diese Arbeit mit dem Internationalen Menschenrechtspreis würdigt.