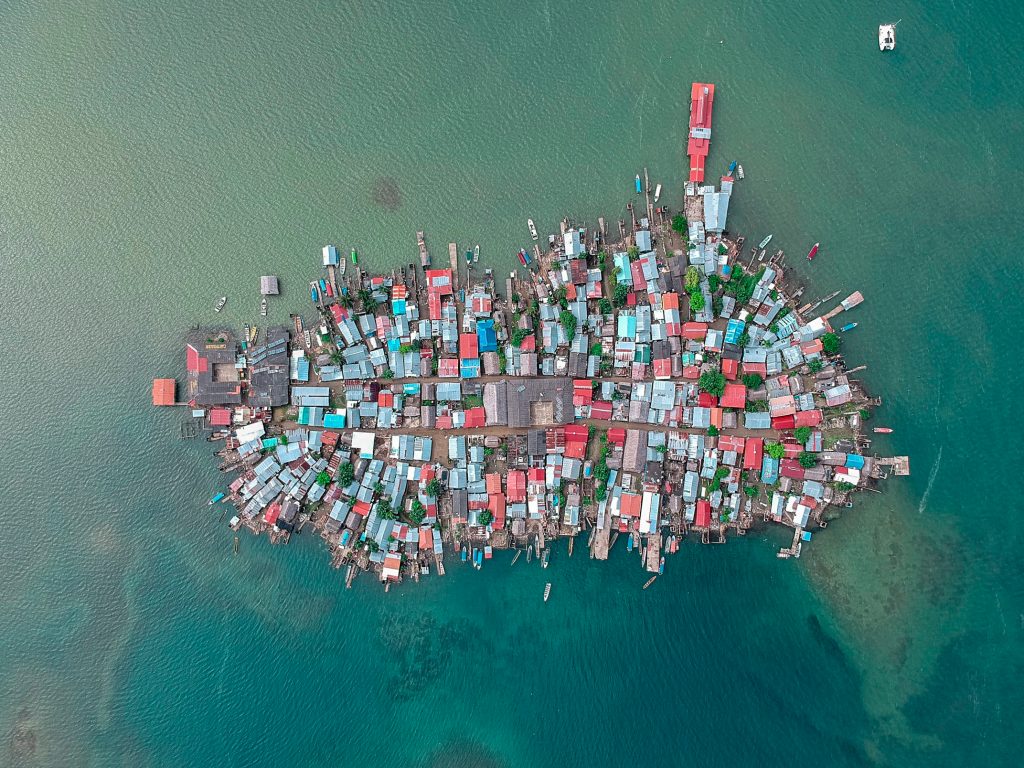Kannst du uns beschreiben, wie sich die Dürre auf dein Land und deinen Betrieb ausgewirkt hat?
Mitte Oktober vergangenen Jahres ist der letzte Regen gefallen und damit hat die Dürre auch schon begonnen. Es wurde immer wärmer und gleichzeitig hat ein ungewöhnlich starker Wind geweht. Der Sommer hat hier sozusagen schon einen Monat früher angefangen und uns auch einen Monat später verlassen als gewohnt. Die Dürre hat hier sehr starke Auswirkungen gehabt, weil ohne Wasser kein Gras und kein Sorghum (Hirseart, Anm. d. Red.) wächst, was den Kühen normalerweise als Futter dient. Dazu kommt noch, dass die Erde hier sehr lehmig ist und der Boden durch die Trockenheit viele große Rissen bekam.
Da sie die Risse in der Erde nicht sehen konnten, haben sich die Tiere nachts die Beine gebrochen. Die gewohnte Vegetation ist langsam verschwunden. Irgendwann hatten wir kein Wasser mehr, da die Reserven schon Anfang Januar aufgebraucht waren. Wir konnten beobachten, dass sogar wilde Tiere unserem Hof sehr nah kamen, da sie nirgendwo sonst Wasser gefunden haben. Insgesamt sind viele Tiere gestorben. Wir selbst haben fast die Hälfte unserer Nutztiere über die Dürreperiode hinweg verloren.
Wie hat sich dein Arbeitsalltag durch die Auswirkungen der extremen Dürre verändert?
Mein Arbeitsalltag hat sich schon stark verändert, weil man zum Beispiel den Tieren alle zwei Stunden Wasser aus unserem Brunnen geben musste. Zudem mussten wir uns ständig auf die Suche nach neuen Weidemöglichkeiten begeben, da um uns herum die Wiesen schnell abgeweidet waren. Diese Aufgaben haben viel Zeit gekostet und es war auch sehr stressig, immer wieder daran zu denken, damit sie nicht in Vergessenheit gerieten. Hinzu kam dann noch die extreme Hitze. Hier war es häufig über 35 Grad warm. Zum Glück hatte ich meinen kleinen Gemüsegarten. Auch wenn dort nicht alle Pflanzen überlebt haben, war er wie eine kleine Oase, aus der ich zum Beispiel meine Hühner füttern und ein bisschen Einkommen generieren konnte.
Wie fühlt es sich an, so eine extreme Wettersituation als Landwirt bewältigen zu müssen?
Es ist hoffnungslos und hoffnungsvoll zugleich. Während ich durch die schwere Zeit der Dürre gegangen bin, war es trostlos anzusehen, wie die ganzen Tiere gestorben sind. Festzustellen, dass immer noch kein Regen kommt und damit auch kein Gras nachwächst. Und es gibt gleichzeitig Hoffnung, weil du auch durch Dürrezeiten kommst. Du merkst, dass du eine wirklich komplizierte Situation überlebt hast und alles getan hast, um da durchzukommen.
Wie nimmst du die gesellschaftliche Debatte in Argentinien zu der anhaltenden Dürre wahr? Werden strukturelle Ursachen diskutiert?
Ehrlich gesagt wird hier nicht viel darüber diskutiert. Die großen Medieninstitute in Argentinien berichten nicht darüber, was wirklich passiert. Und wenn sie berichten, geben sie dem Thema nicht die Aufmerksamkeit, die es verdient. Oder sie richten nicht den Fokus darauf, wo es wichtig wäre: Zum Beispiel auf die Aktivitäten von Geschäftsleuten, die hier große Landflächen kaufen, anschließend die Vegetation abbrennen lassen, um das Land dann zu besseren Konditionen verkaufen zu können. Oder die Forstwirtschaft, die die wenigen verbliebenen Wälder auch weiterhin noch zerstört. In den Medien hört man dann etwa „Oh nein es gab einen Waldbrand, wie unglücklich“. Es erreicht niemanden wirklich, der ganze Diskurs ist mehr oder weniger heuchlerisch. Das ist das, was es an breiter gesellschaftlicher Debatte gibt.. Es wird ehrlich gesagt nicht darüber geredet, was wirklich wichtig ist. Darüber, dass es wichtig wäre, Bäume zu pflanzen. Ganz ohne wirtschaftliche Absichten, sondern nur mit dem einfachen Ziel, dass Bäume die Temperatur regulieren und Tieren ein Habitat bieten. Damit an Orten, an denen mittlerweile nur noch gerodet wird, eine Umwelt entsteht, in der das Leben überhaupt wieder gedeihen kann.
Hast du dich während der Dürreperioden mit anderen Produzent*innen ausgetauscht oder organisiert?
Offen gesagt habe ich von Vernetzungen in dieser Zeit überhaupt nichts mitbekommen. Ich habe mich mit Menschen aus der Nachbarschaft vernetzt, um ein paar Lebensmittel abzugeben. Oder wir haben uns gegenseitig Hilfe angeboten bei Aufgaben, die angefallen sind. Aber es gibt kein größeres funktionierendes Netz und es ist richtig schwer, wenn man nicht auf so etwas zurückgreifen kann, sondern alles allein bewältigen muss.
Was muss sich aus deiner Sicht ändern, damit kleine ökologische Betriebe wie deiner trotz extremer Wetterlagen erhalten bleiben und nicht in die Prekarität gedrückt werden?
Hilfe aus dem Ausland! Wirklich! Es gibt keine funktionierenden staatlichen Hilfesysteme und das ist eine Katastrophe an Orten wie diesen. Ich könnte natürlich sagen, dass wir Produzent*innen in einem Unterstützungsnetzwerk organisiert sein müssten, in dem wir uns gegenseitig helfen und der Staat uns einen Grundbedarf garantieren müsste. Damit wir aus der Prekarität herauskommen können. Aber das wird leider nicht passieren. Das sind alles schöne Gedanken. Aber es ist sehr kompliziert, dies alles umzusetzen und zu erwirken. Deshalb brauchen wir momentan Unterstützung von außen. Es muss auch nicht unbedingt Geld sein, was wir uns als Unterstützung wünschen. Ich freue mich auch über jede Person, die für eine Zeit auf meinem Hof mithelfen möchte.