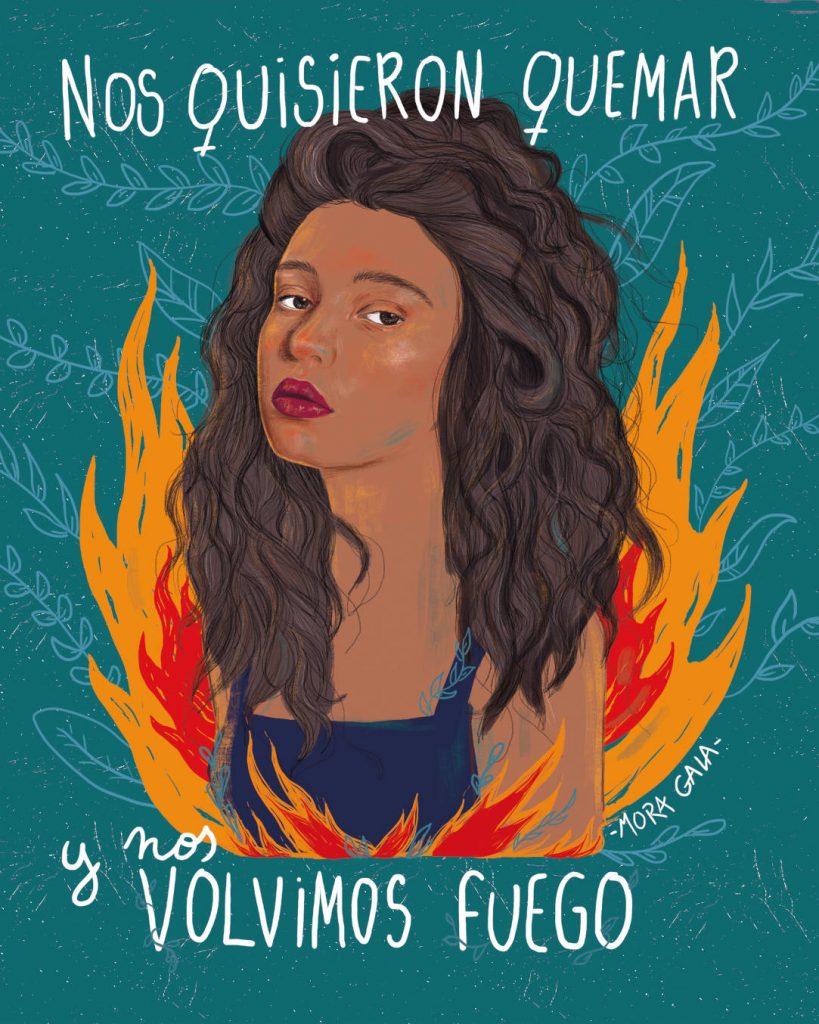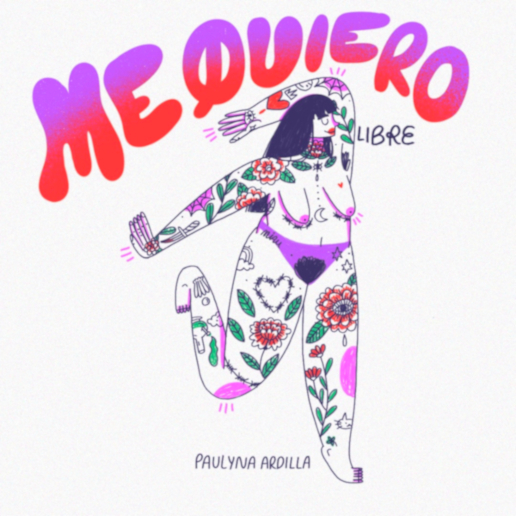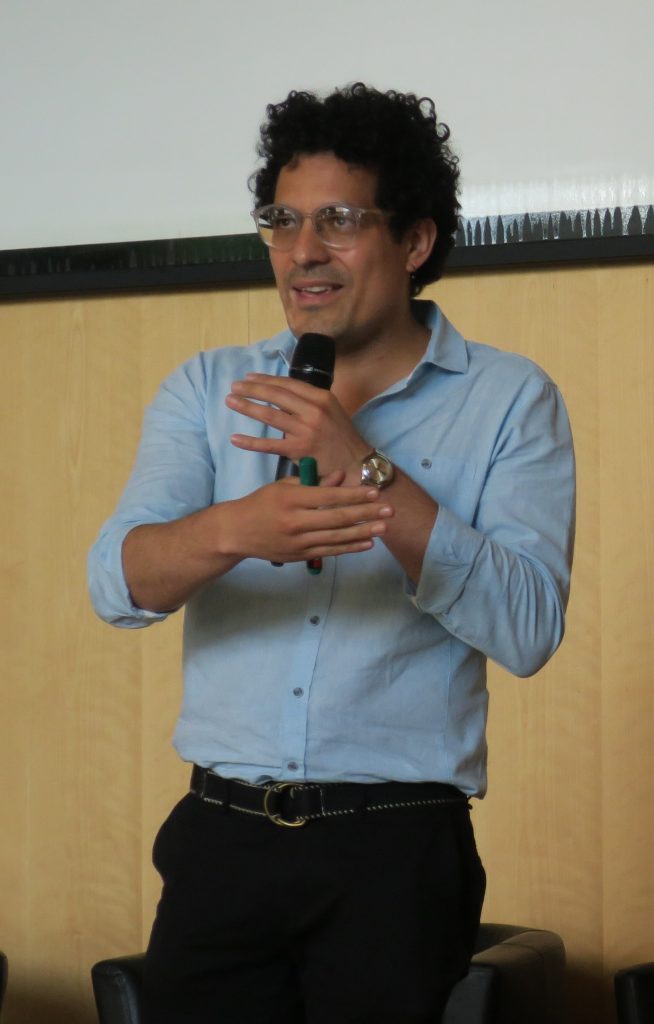Zusammen schaffen wir es, Illustration: Emmalynn González, @eg_atelier
El Salvador ist das Land mit der höchsten Feminizidrate weltweit, obwohl es über eine umfassende Gesetzgebung für den Umgang mit sexualisierter Gewalt verfügt. Im Jahr 2012 trat das Sondergesetz für ein gewaltfreies Leben für Frauen (LEIV) in Kraft, das erstmals Feminizide und andere Formen geschlechtsspezifischer Gewalt kriminalisierte. Allerdings ist dieses nicht im Strafgesetzbuch verankert. Theoretisch sollte diese Gesetzgebung dazu dienen, Gewalt gegen Frauen zu verhindern und zu bestrafen.
Dekret 520 des LEIV zielt darauf ab, das Recht der Frauen auf ein gewaltfreies Leben zu begründen, anzuerkennen und zu garantieren. Um ihr Recht auf Leben, körperliche und moralische Unversehrtheit zu schützen, verfügt die Generalstaatsanwaltschaft der Republik El Salvador (FGR) über sechs spezialisierte Betreuungseinheiten für Frauen, die Justiz hat sechs Sondergerichte und eine Kammer für ein Leben ohne Gewalt und Diskriminierung für Frauen.
2019 wurden offiziell 230 Feminizide in El Salvador gezählt, was im Verhältnis zu den 386 Frauenmorden, die 2018 registriert wurden, einem Rückgang von 40 Prozent entspricht. Bis Mitte August 2020 zählte die Beobachtungsstelle für Gewalt gegen Frauen (ORMUSA) 71 Feminizide. Somit wurden in den letzten acht Jahren mehr als 3.000 Frauen in El Salvador ermordet, weil sie Frauen waren. Doch bis Ende 2019 hat die Justiz nur 259 Verurteilungen wegen Feminizids ausgesprochen. Die geringe Zahl der Verurteilungen spricht nach Ansicht von Expert*innen für eine Leugnung des Phänomens seitens der Behörden. All das in einem Land, in dem machistische Strukturen an der Tagesordnung sind und in dem mehr als die Hälfte der Fälle ungestraft bleibt. Seit 2016 gab es einen allmählichen Rückgang der Feminizide, was jedoch nicht verhinderte, dass El Salvador laut der Beobachtungsstelle für Geschlechtergleichstellung (ECLAC) im Jahr 2019 zum gewalttätigsten Land für Frauen in Lateinamerika wurde. Trotz der Tatsache, dass das LEIV die Justizbehörden verpflichtet, Feminizide streng zu bestrafen, hat die Staatsanwaltschaft jedoch nur in einem Drittel der Fälle Verurteilungen erreicht. In den meisten Fällen stehen die Morde statistisch nicht in direktem Zusammenhang mit geschlechtsspezifischer Gewalt. El Salvador erhebt keine Statistik der Tötungsdelikte aufgrund des Geschlechts, der Geschlechtsidentität oder der sexuellen Orientierung.