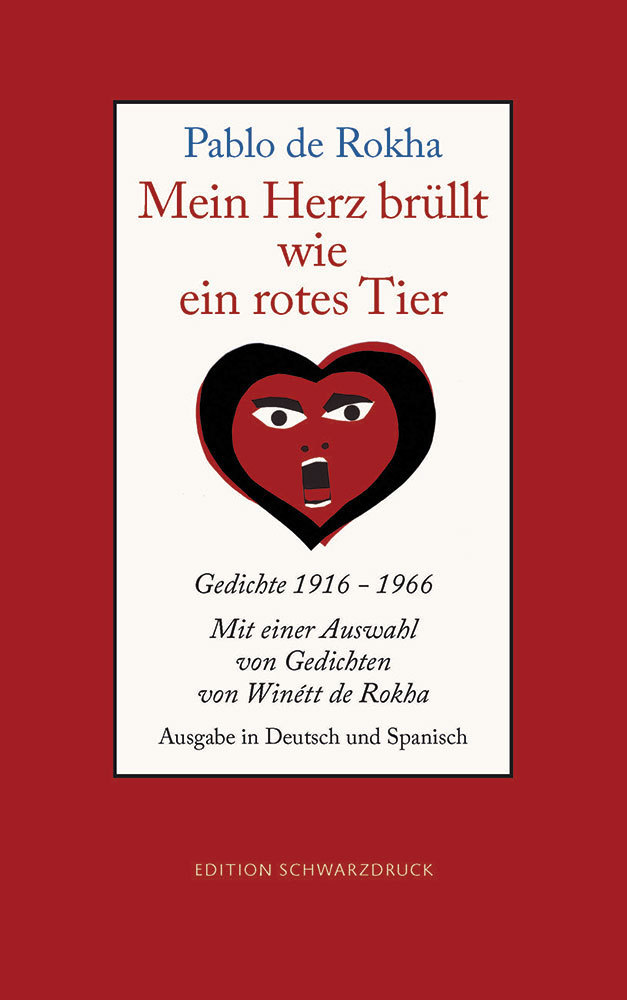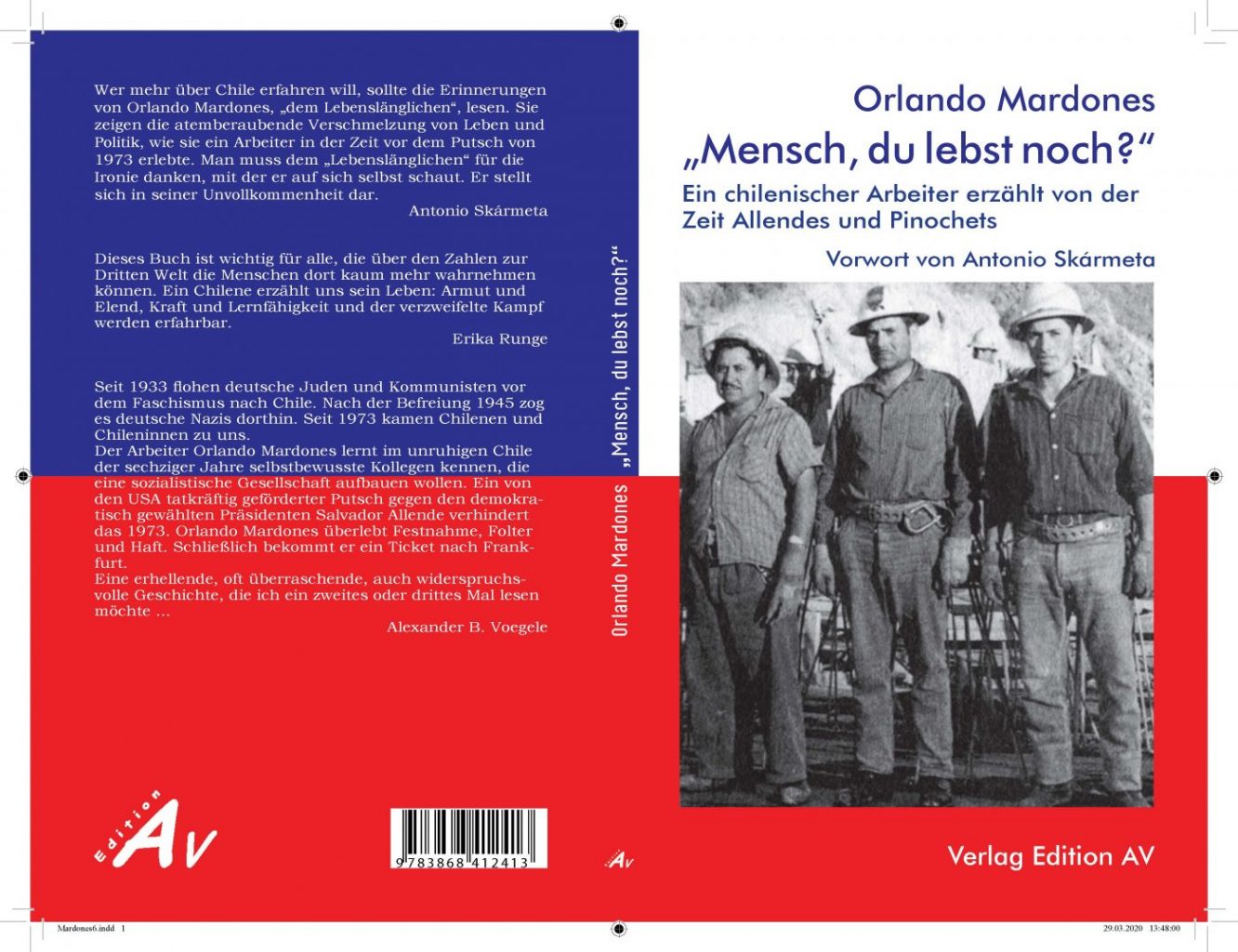Foto: Diego Reyes Vielma
Chile despertó, Chile aprobó („Chile ist aufgewacht, Chile hat zugestimmt“), tönt es am 25. Oktober durch Santiagos Straßen, als das Ergebnis des Referendums über eine neue Verfassung feststeht: Gut 78 Prozent der abgegebenen Stimmen sind auf das Apruebo, auf das „Ja“, entfallen.
„Adiós General“ heißt es auf einem Transparent an der Plaza de la Dignidad, dem Platz der Würde, womit der Abschied von einer Verfassung, die bereits unter General Augusto Pinochet während der Militärdiktuatur in Kraft getreten ist, zum Ausdruck kommen soll. Mit Hupkonzerten und Autokorsos, mit Parolen und cacerolazos (lautstarke Protestform, bei der auf Töpfe und Pfannen geschlagen wird), mit Trommeln und Gesang feiern die Chilen*innen diesen überwältigenden Sieg der Zustimmung zu einem Prozess, an dessen Ende das Land in zwanzig Monaten, Mitte 2022, sehr wahrscheinlich eine neue Verfassung verabschieden wird.
„Dieser Tag ist für uns sehr wichtig, ein historischer Prozess. Die Bevölkerung will einen Wandel, eine neue Verfassung, nicht mehr die aus unserer düstersten Zeit, der Pinochet-Diktatur“, sagt Luis Balboa mit strahlenden Augen. Er ist zusammen mit seiner Schwester Marta zwischen vielen anderen Feiernden auf der Plaza Ñuñoa in Santiago unterwegs. Die aktuell gültige Verfassung wurde 1980 unter der Führung des Diktaturideologen Jaime Guzmán ohne demokratische Legitimierung geschrieben. In ihr wird das das Recht auf Eigentum stärker gewichtet als Menschenrechte, wodurch damals auch der Grundstein für eine neoliberale Politik gelegt wurde, die bis heute in der chilenischen Wirtschaft verankert ist. Über die Zeit hat die aktuelle Verfassung jedoch immer stärker an Legitimität in der Bevölkerung eingebüßt, die endlich die langen Schatten der Diktatur abschütteln will. „Vor Jahren haben wir gegen Pinochet gestimmt“, erinnert sich Marta Balboa an das Referendum von 1988, in dessen Folge die Diktatur ein offizielles Ende fand. „Jetzt stimmen wir für eine Verfassung von der Bevölkerung für die Bevölkerung. Aber wir müssen weitermachen, denn es wird ein schwieriger Weg.“
Tausende Chilen*innen hatten seit dem 18. Oktober 2019 an vielen Orten Chiles demonstriert. Schüler*innen und Studierende, Feminist*innen, Mapuche und soziale Bewegungen kamen zunächst gegen die prekären Pensionsfonds AFP zusammen. Aus dieser Einheit erwuchs eine ungeahnte Stärke: Am 25. Oktober 2019 waren über eine Million Menschen in Santiagos Zentrum auf der Straße – trotz des von Präsident Sebastián Piñera verhängten Ausnahmezustandes. In Nachbarschaftsversammlungen wie asambleas territoriales oder cabildos entdeckten Menschen, dass sie mit ihren Problemen nicht allein waren.
„Dieser Tag ist für uns sehr wichtig, ein historischer Prozess“
Das Plebiszit war zunächst für April 2020 geplant. Covid-19 kam dazwischen, weshalb es auf Oktober verschoben werden musste (siehe LN 550). Im Oktober ist die Ansteckungsrate in Chile zwar erneut auf hohem Niveau, aber stabilisiert. Nachts gilt noch die Ausgangssperre, tagsüber gehen die Menschen aber wieder auf die Straße – und eben auch protestieren.
In den Wochen vor dem Referendum überschlagen sich die Ereignisse. Am 18. Oktober, dem Jahrestag des estallido social, wie die Massenproteste vor einem Jahr genannt werden, demonstrieren Zehntausende im Zentrum Santiagos. Am Abend brennen zwei Kirchen, die Bilder gehen in Windeseile um die Welt. Später wird bekannt, dass ein Militärangehöriger dabei gewesen sein soll. Weniger Beachtung fand der Tod des 26-jährigen Aníbal Villarroel durch die Kugel eines Polizisten im marginalisierten Stadtviertel La Victoria am selben Abend. Seine Familie hat Anzeige erstattet und fordert Aufklärung. Das chilenische Menschenrechtsinstitut INDH bezeichnet die von staatlichen Organen im vergangenen Jahr begangenen Menschenrechtsverletzungen als die schwersten seit Ende der Diktatur 1990. Der Staatsanwaltschaft liegen seither 8.575 Strafanzeigen in diesem Zusammenhang vor. Allein das INDH hat 2.520 Anzeigen, vor allem gegen die Militärpolizei Carabineros, erstattet. In nur ein Prozent dieser Fälle wird konkret gegen Angehörige der Sicherheitsorgane ermittelt.
Diskussionen um das Plebiszit waren derweil überall spürbar. Aus vielen Fenstern hängen Fahnen und Transparente, auf Häuserwänden und unzähligen Plakaten steht es geschrieben: Apruebo („Ich stimme zu“). Bei Kundgebungen wird erklärt, wie das Plebiszit funktioniert, um Transparenz zu schaffen, auch wenn es nur zwei Fragen zu beantworten gab. Das Ziel: Demokratisierung der Diskussion.
Schwerste Menschenrechtsverletzungen seit Ende der Diktatur
Vor dem Referendum mobilisierte die politische Rechte überwiegend für das Rechazo und das hauptsächlich in reichen Gegenden. Am Wochenende vor dem Plebiszit marschieren etwa 3.000 teils mit Helmen und Schilden mit religiösen Symbolen ausgerüstete Menschen durch Santiagos Nobelviertel Las Condes. „Solange Chile existiert, wird es niemals marxistisch sein“, rufen sie. Ein „zweites Venezuela“, fürchten ihre Teilnehmer*innen, manchen gilt auch schon Argentinien als sozialistisches Schreckensszenario, wo eine für ihre äußerst wirtschaftsliberale Politik bekannte Regierung an der Macht ist. Die Protestbewegung für eine neue Verfassung sehen sie als vom Ausland gesteuerte Aktion. Manche Rechazo-Anhänger*innen tragen T-Shirts mit Pinochet-Aufdruck. Zu sehen sind Zeichen rechtsextremer Gruppen wie der Patria y Libertad (Vaterland und Freiheit). Es ist sogar die Rede von einer Neugründung dieser nationalistischen Organisation, die 1973 den Putsch mit vorbereitete.
Am Morgen des 25. Oktober bilden sich vor vielen Wahllokalen lange Schlangen. Viele junge Leute, die nie zuvor gewählt haben, und ältere Menschen, die sich noch an die Zeit der demokratisch gewählten Regierung der Unidad Popular unter Salvador Allende und den Putsch 1973 erinnern, kommen hier zusammen. Nelda Aguilar (86), deren Bruder 1973 verhaftet wurde und seitdem verschwunden ist, lebte selbst jahrelang im Exil. „Ich gehe voller Freude zu dieser Wahl“, sagt sie bewegt. „Ich hoffe, dass das Apruebo gewinnt und dass etwas Positives für unser Land und für ganz Lateinamerika entsteht. Denn diese Wahl hat historische Bedeutung.“
Der Rechtsanwalt Francisco Rodríguez arbeitet als Freiwilliger in einem Wahllokal und hat bereits am Morgen seine Stimme abgegeben – für Rechazo: „Die Militärregierung hat ab 1973 die Bedingungen dafür geschaffen, dass Chile von einem der ärmsten Länder zur Nummer eins in Lateinamerika aufsteigen konnte“, sagt er. Venezuela hingegen sei durch strukturelle Änderungen vom reichsten Land des lateinamerikanischen Kontinents zu einem der ärmsten geworden. „Genau dieses Modell soll uns durch das Plebiszit aufgezwungen werden“, meint er. Tatsächlich hält ein Prozent der chilenischen Bevölkerung ein Drittel des Bruttoinlandsprodukts.
Am Ende des Tages kann das Rechazo-Lager sich nur in fünf Kommunen durchsetzen – nämlich genau dort, wo sich Reichtum und Macht konzentrieren. 78,27 Prozent der abgegebenen Stimmen entfallen auf das Apruebo, noch mehr (78,99 Prozent) für die Convención Constitucional, also ein verfassungsgebender Konvent, der von der Bevölkerung gewählt wird. Das deutliche Wahlergebnis bedeutet nicht nur einen starken Rückhalt weitreichender Veränderungen in der Verfassung, sondern beweist auch das große Misstrauen gegenüber den politischen Parteien und deren Klientelismus. So werden nun die 155 Mitglieder des Verfassungskonvents im April 2021 gewählt. Die Entscheidung, ob Sitze für Indigene reserviert werden, steht noch aus. Der Konvent hat dann maximal ein Jahr Zeit, um einen neuen Verfassungstext zu schreiben. Alle Artikel müssen mit Zweidrittelmehrheit beschlossen werden.
Die eigentliche Herausforderung beginnt also erst jetzt: Die sozialen Bewegungen beanspruchen eine möglichst große Beteiligung am verfassungsgebenden Prozess. So fordern etwa die 200 Organisationen, die in der Plattform Unidad Social vereint sind, die politischen Parteien auf, Plätze auf ihren Wahllisten für Vertreter*innen sozialer Bewegungen zu reservieren.
Es stellen sich nun zwei entscheidende Fragen. Zum einen, ob es der organisierten Rechten gelingt, ein Drittel der Plätze im verfassungsgebenden Konvent zu stellen. Damit hätte sie eine Sperrminorität und könnte – so kündigte es Pablo Longueira, Abgeordneter der rechtskonservativen Partei UDI, bereits an – durchsetzen, dass die neue Verfassung inhaltlich nicht grundlegend anders ausfallen würde als die jetzige. Und zweitens: Werden die Mitte-Links-Parteien eine faire Kooperation mit den sozialen Bewegungen eingehen und zusammen zumindest diesen kleinen Konsens durchsetzen, der in der Bevölkerung schon längst gesetzt ist: der Post-Pinochet-Ära und dem Credo des Neoliberalismus ein Ende zu setzen?
Klar scheint jedenfalls, dass es dazu Bündnisse und Druck von unten braucht. Mit Demonstrationen, kulturellen Aktivitäten, Diskussionen, Mobilisierung und breiter Organisierung in cabildos und asambleas. Wann, wenn nicht jetzt: „Adiós General!“