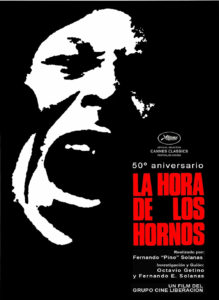Parsi:
Sa 09.02. 17:30 Kino Arsenal 1
So 10.02. 14:00 Werkstattkino@silent green
Vivir en junio con la lengua afuera:
Sa 09.02. 13:00 Kino Arsenal 1
So 10.02. 17:00 Werkstattkino@silent green
Sektion: Forum Expanded
 Foto: © Eduardo Williams, Mariano Blatt
Foto: © Eduardo Williams, Mariano Blatt
Bewegungen der Kamera in Vergangenheit und Zukunft. Das aufrichtige Wort kommt nicht aus der Mode, nutzt sich nicht ab, stirbt nicht. Die Erinnerung an den Dichter Reinaldo Arenas lebt stärker denn je im Gedächtnis der Kubaner*innen. Der Regisseur Coco Fusco in Bewusstsein darüber, integriert sie in seinen Kurzfilm Vivir en junio con la lengua afuera. In einem Kuba zu Zeiten des tiefgreifenden Wandels verfolgt und aufgrund seiner Homosexualität eingesperrt, kehrt Reinaldo Arenas nach Wiedererlangung der ersehnten Freiheit zum Lenin-Park zurück, wo er sich zuvor vor der Repression versteckt hatte. Und auf demselben Platz beginnen die Geschichte von seinem Leben und das Vorlesen seines bekanntesten Gedichtes, das den Titel trägt „Einführung des Glaubenssymbols“.
Auf herzzerreißende und zeitlose Weise rezitieren drei Personen das Gedicht, so als ob sie ihr ganzes Leben auf diesen Moment gewartet hätten. Aufrichtigkeit von der aufrichtigsten Sorte und Schmerz von der schmerzhaftesten Sorte. Kurios und fast paradox erscheint, dass zwei der Vortragenden, ein Paar, kurz davor steht aus ihrem Haus geworfen zu werden – Zwangsvertriebene im heutigen, “modernen” Kuba. Die offensichtliche Aktualität des Gedichts fällt auf. Es scheint beinahe, dass hier anstelle eines Gedichts das Manifest einer politischen Demonstration des laufenden Jahres verlesen wird. Dank einer unprätentiösen Kameraführung identifizieren sich die Zuschauer*innen fast sofort mit jedem einzelnen Wort von Reinaldo Arenas, der so lebendig ist wie nie.
Bewegungen der Kamera in Gegenwart und Vergangenheit. Durch ein Zusammenwirken wilder Bilder erreicht uns Parsi aus der Hand der Regisseure Eduardo Wiliams und Mariano Blatt. Begleitet von einer Kamera, die in einem stetigen Auf und Ab die Straßen durchkämmt, beginnt eine Stimme aus dem Off verschiedene virtuelle Bilder, Empfindungen und Erinnerungen aufzuzählen, die zu sein “scheinen” oder auch nicht. Ein frenetisches Gedicht und Wortspiel, das sich ebenso schnell bewegt wie die Kamera, die uns mit umrundenden Bewegungen das Gefühl gibt, in einem Hamsterrad zu sein. Gefilmt wird tief, etwa auf Schulterhöhe.
 © Eduardo Williams, Mariano Blatt
© Eduardo Williams, Mariano Blatt
Stadtviertel mit Prostituierten und Transvestiten, die die Kamera sehen und lachen. ”Sieht aus, als ob es hier einen Dreier geben wird”, sagt die Stimme aus dem Off. Frauen und Kinder nähern sich der Kamera und betrachten sie von der Seite, so als ob sie eine weitere Person wäre. Die Kamera fährt wie zum Herumschnüffeln in ein Haus hinein, dann wieder hinaus, ”Das ist ja wie beim Karneval”, sagt die Stimme, während die Kamera anfängt, sich wie ein rundes, betrunkenes Geschoss zu bewegen. Die Wortspielerei nimmt immer mehr an Bedeutung zu während die Minuten vergehen. Die Kamera hüpft von Hand zu Hand, gleitet wie auf Rollschuhen auf der Straße und zwischen den Autos hindurch, so schnell wie die Worte. Die Zuschauer*innen folgen wie gebannt den Bildern und versuchen sie mit den gehörten Worten zu assoziieren. Die Kamera steigt, steigt immer mehr. Der Blickwinkel vergrößert sich. “Es scheint etwas ästhetisch Schönes, aber moralisch Verwerfliches zu sein”, sagt die Stimme.
Man weiß nicht, ob es die Worte oder die Bilder sind, die das Bestechende an Parsi ausmachen; oder die Kombination beider, die Schärfen des Bildes oder die Unschärfen, die Aufrichtigkeit der einzelnen Sätze oder deren Unaufrichtigkeit.
Vivir en junio con la lengua afuera und Parsi laufen 2019 im Forum Expanded der Berlinale.

















 Auf den ersten Blick wirken die „Monos“ weniger wie Aufständische, sondern mehr wie gewöhnliche, überdrehte Teenager auf einer Klassenfahrt mit zugegeben hippieskem Charme: Umgeben von Bergspitzen und klarer Luft toben die Jugendlichen frei durch die Natur, sitzen gemeinsam am Feuer, erzählen, lachen und entwickeln ihre ersten romantischen Gefühle. Sehr eindrucksvoll sind auch ihre ausgelassenen Tänze und bunten Gesichtsbemalungen. Jedoch werden die vermeintlich idyllischen Szenen durchbrochen durch die harten Militärübungen der Kinder und die untereinander herrschende Hierarchie. Zum Spaß schießen die „Monos“ mit ihren Waffen wild in die Luft und sind ihrem Anführer „Lobo“ (Wolf) treu ergeben. Es lässt sich also nichts Gutes ahnen, als die Jugendlichen eines Morgens bewaffnet und schreiend einen ihrer Kameraden verfolgen, bis dieser ins Gras fällt. Sie geben ihm heftige Schläge auf das Hinterteil, während sie laut mitzählen. Erst beim 15. Schlag rufen sie dem am Boden Liegenden plötzlich lachend zu: („Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!“)
Auf den ersten Blick wirken die „Monos“ weniger wie Aufständische, sondern mehr wie gewöhnliche, überdrehte Teenager auf einer Klassenfahrt mit zugegeben hippieskem Charme: Umgeben von Bergspitzen und klarer Luft toben die Jugendlichen frei durch die Natur, sitzen gemeinsam am Feuer, erzählen, lachen und entwickeln ihre ersten romantischen Gefühle. Sehr eindrucksvoll sind auch ihre ausgelassenen Tänze und bunten Gesichtsbemalungen. Jedoch werden die vermeintlich idyllischen Szenen durchbrochen durch die harten Militärübungen der Kinder und die untereinander herrschende Hierarchie. Zum Spaß schießen die „Monos“ mit ihren Waffen wild in die Luft und sind ihrem Anführer „Lobo“ (Wolf) treu ergeben. Es lässt sich also nichts Gutes ahnen, als die Jugendlichen eines Morgens bewaffnet und schreiend einen ihrer Kameraden verfolgen, bis dieser ins Gras fällt. Sie geben ihm heftige Schläge auf das Hinterteil, während sie laut mitzählen. Erst beim 15. Schlag rufen sie dem am Boden Liegenden plötzlich lachend zu: („Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!“)